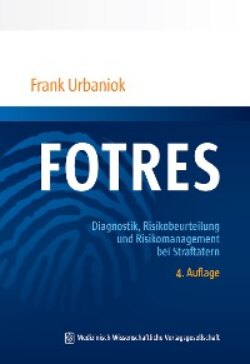Читать книгу Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter - Группа авторов - Страница 22
2.2 Definitorische Probleme in den aktuellen Klassifikationssystemen
ОглавлениеDie vorgestellte diagnostische Einteilung der ICD-10 in verschiedene Formen von Autismus wurde in den neuen Klassifikation-Systemen DSM-5 (APA, Deutsche Ausgabe 2015) und ICD-11 (WHO 2019; First et al. 2021) aufgegeben. Kritikpunkte waren beispielsweise, dass eine eigene diagnostische Kategorie für das AS im DSM-IV (APA 2000) fehlte und die Frage der Differenzierung zwischen HFA und AS damit im DSM-IV offen blieb. Außerdem sind diverse wissenschaftliche Studien beim Versuch gescheitert, die verschiedenen Autismus-Diagnosen nach validen und konsistenten Kriterien zu differenzieren. Daher wird in der gegenwärtigen klinischen Praxis hauptsächlich von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) gesprochen. Es wird damit ein umfassenderer Begriff gewählt, der die bislang kategorial unterschiedenen Autismusformen als ineinander übergehende Ausformungen eines Spektrums auffasst. Das DSM-5 und die ICD-11 (die im nächsten Jahr offiziell eingeführt werden wird) tragen dieser Entwicklung Rechnung, indem auf die Unterscheidung verschiedener Autismuskategorien verzichtet wird und die Bezeichnung ASS für alle Formen verwendet wird. ASS werden nun gemeinsam mit den intellektuellen Beeinträchtigungen, den Kommunikationsstörungen, der ADHS, den motorischen Entwicklungsstörungen und den spezifischen Lernstörungen in der Gruppe der „Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung“ zusammengefasst. Die individuellen Variationen der ASS werden über Zusatzkodierung (z.B. mit/ohne intellektuelle Behinderung und mit/ohne Sprachstörung) angegeben (APA, DSM-5). Folgende Eigenschaften haben alle diese Störungen gemeinsam:
die Evidenz eines starken und teilweise gemeinsamen „genetischen Hintergrunds“ (z.B. nur etwa 10% der phänotypischen Varianz des Autismus können durch Umweltfaktoren erklärt werden)
Überwiegen des männlichen Geschlechts
häufige Komorbiditäten wie externalisierende (z.B. Störungen des Sozialverhaltens) und/oder emotionale Störungen (z.B. Angststörungen, Depression, spezifische Phobien, Zwänge)
eine gewisse Kontinuität und/oder Überlappung zwischen den verschiedenen neuronalen Entwicklungsstörungen (z.B. ASS mit Sprachentwicklungsstörungen, teilweise mit Intelligenzminderung, mit motorischen Störungen oder auch mit ADHS)
Kontinuität zwischen typischer und atypischer Entwicklung
Tendenz zu Kompensation mit Verbesserung der Symptomatik, jedoch einem gewissen Grad an Funktionsbeeinträchtigung bis ins Erwachsenenalter
Die Hypothese einer Spektrumsstörung deckt sich auch mit eigenen Studienergebnissen: In katamnestischen Untersuchungen, die sich auf zwischen 2000 und 2005 diagnostizierte Fälle der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter des Freiburger Universitätsklinikums bezogen (Heß 2007; Reusch 2008; Steinmetz 2012), konnten keine reliablen und eindeutigen Unterschiede im Symptomprofil und -verlauf zwischen den vermeintlich unterschiedlichen Diagnosegruppen AS, HFA und AA gefunden werden. Weder bei den Autismus-spezifischen frühen Auffälligkeiten noch bei der aktuellen Symptomatik ließen sich die Gruppen zuverlässig voneinander abgrenzen. Gerade in der Kategorie atypischer Autismus konnte die ehemalige Diagnose in vielen Fällen nicht bestätigt werden, da die Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren die Kriterien für einen frühkindlichen Autismus oder ein Asperger-Syndrom anhand des diagnostischen Gold-Standard (s. Kap. I.2.4) durchaus erfüllt hatten. Darüber hinaus wiesen unsere Patienten mit atypischem Autismus nur in wenigen Fällen eine Intelligenzminderung auf, wie sie im ICD-10 als typischer Fall beschrieben wird. Letztendlich waren die Faktoren, die zur Heterogenität in den Stichproben beitrugen, in den intellektuellen Fähigkeiten, sprachlichen Fertigkeiten und in der Symptomausprägung zu erkennen.
Die im DSM-5 angegebenen diagnostischen Kriterien wurde bereits im einleitenden Kapitel I.1 vorgestellt. In Tabelle 1 werden die Kriterien für die Einteilung des Schweregrads der Symptomatik der ASS aufgelistet (APA, DSM-5 Deutsche Ausgabe 2015). Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und der Kommunikation werden dort nun in einem einzigen Symptomkomplex zusammengefasst. Diese Stufen des Schweregrads sind hilfreich als Grundlage für die Einleitung von unterstützenden und Fördermaßnahmen. Bisher bleibt ein ähnlicher Ansatz in der aktuell verabschiedeten Form der ICD-11 CDDG (Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines, First et al. 2015) leider aus (Freitag 2020).
Dagegen werden auch in der ICD-11 genaue Spezifikationen hinsichtlich kognitiver und sprachlicher Fertigkeiten angegeben, im Sinne von Subtypen der ASS. Es fehlen allerdings operationalisierte Kriterien für die genaue Feststellung der sprachlichen Beeinträchtigung in der aktuell online verfügbaren, englischen Version (Freitag 2020).
Es besteht außerdem eine deutliche Evidenz dafür, dass der Übergang von hochfunktionalen Formen des Autismus zu „autistischen Zügen ohne Krankheitswert“ fließend ist. ASS können bei manchen Individuen lange Zeit (auch bis zum Erwachsenenalter) unbemerkt oder undiagnostiziert bleiben, weil sie unterschwellig sind (bei Anwendung von diagnostischen Verfahren gibt es nur unzureichende Hinweise für das Vorliegen einer Störung), können jedoch irgendwann zu Leidensdruck oder Einschränkungen bei der Bewältigung von entwicklungstypischen Lebensaufgaben führen. Diese subliminalen Störungen („subtreshold disorders“) werden als „broader autism phenotype“ definiert. Das Kriterium für die Vergabe einer Diagnose ist in der neuen Klassifikation an die Feststellung von „in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen“ gebunden (APA, DSM-5, Deutsche Ausgabe 2015).
Tab. 1 Schweregrad der ASS
| Schweregrad | Soziale Kommunikation | Restriktive, repetitive Verhaltensweisen |
| Stufe 3 „Sehr Umfangreiche Unterstützung erforderlich“ | Starke Einschränkungen der verbalen und nonverbalen sozialen Kommunikationsfähigkeit verursachen beträchtliche Beeinträchtigungen im Funktionsniveau; minimale Fähigkeit zur Initiierung sozialer Interaktionen und minimale Reaktion auf soziale Angebote im Umfeld. | Unflexibilität des Verhaltens. Extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen oder andere repetitive, restriktive Verhaltensweisen mit ausgeprägter Funktionsbeeinträchtigung in allen Bereichen. Großes Unbehagen bzw. große Schwierigkeiten, den Fokus oder die Handlung zu verändern. |
| Stufe 2 „Umfangreiche Unterstützung erforderlich“ | Ausgeprägte Einschränkungen in der verbalen und nonverbalen sozialen Kommunikationsfähigkeit. Soziale Beeinträchtigungen auch mit Unterstützung deutlich erkennbar; reduzierte Initiierung sozialer Interaktionen oder abnormale Reaktionen auf soziale Angebote von anderen. | Unflexibilität des Verhaltens. Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen oder andere repetitive, restriktive Verhaltensweisen treten häufig genug auf, um auch für den ungeschulten Beobachter offensichtlich zu sein. Funktionsbeeinträchtigung in einer Vielzahl von Kontexten. Unbehagen bzw. Schwierigkeiten, den Fokus oder die Handlung zu verändern. |
| Stufe 1 „Unterstützung erforderlich“ | Die Einschränkungen in der sozialen Kommunikation verursachen ohne Unterstützung bemerkbare Beeinträchtigungen. Schwierigkeiten bei der Initiierung sozialer Interaktionen sowie einzelne deutliche Beispiele für unübliche oder erfolglose Reaktionen auf soziale Kontaktangebote anderer. Scheinbar vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen. | Unflexibilität des Verhaltens führt zu Funktionsbeeinträchtigungen in einem oder mehreren Bereichen. Schwierigkeiten, zwischen Aktivitäten zu wechseln. Probleme in der Organisation und Planung beeinträchtigen die Selbständigkeit. |