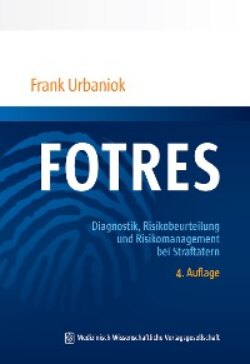Читать книгу Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter - Группа авторов - Страница 31
3.2.2 Präsentation im Erwachsenenalter
ОглавлениеIm Erwachsenenalter müssen zwei Konstellationen unterschieden werden:
Bei der ersten wird ein Patient mit bereits diagnostiziertem Autismus vorstellig. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den erwachsen gewordenen Patienten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dann bereitet die Diagnose keine Probleme und die Betroffenen selbst sind ebenso wie ihre Angehörigen und Bezugspersonen meist mit den Besonderheiten einer ASS vertraut.
Anders stellt sich die Situation allerdings dar, wenn Menschen mit Asperger-Syndrom bzw. einer hochfunktionalen ASS ihr Leben bis ins Erwachsenenalter gemeistert haben, ohne dass es zu Kontakten zum ärztlich-therapeutischen Hilfesystem gekommen ist. Denn die Tatsache, dass die betroffenen Personen trotz überzeugendem und stabilem Vorhandensein der Kerneigenschaften einer ASS ihr Leben bis ins Erwachsenenalter ohne größere psychosoziale Krisen meistern konnten, weist entweder auf einen geringeren Schweregrad der Symptome hin oder aber auf große Kompensationsressourcen wie z.B. eine hohe Intelligenz und gute kognitive Fähigkeiten, die geholfen haben, Umgehungsstrategien zu entwickeln, eine hohe Akzeptanz in Familie, Schule, Umfeld und Beruf und eher fehlende psychiatrische Komorbiditäten wie etwa eine ADHS oder Depressionen. Abbildung 1 veranschaulicht das komplexe Zusammenwirken all dieser Faktoren in der Entwicklung eines individuellen Lebens.
Menschen mit hochfunktionalem Autismus, die sich erst im Erwachsenenalter beim Arzt vorstellen
haben oft eine weniger schwer ausgeprägte Symptomatik,
verfügen oft über eine hohe Intelligenz und gute kognitive Kompensationsstrategien,
verfügen oft über ein gut strukturiertes Netzwerk an sozialer Unterstützung (Familie, soziales Umfeld, Schule, Beruf etc.) und
können dennoch wegen der ASS-Basisstörung in Beziehungen, Partnerschaft und Beruf komplett scheitern.
Aus dieser Zusammenschau von Einflussfaktoren im Hinblick auf eine psychosoziale Kompensation oder Dekompensation von Menschen mit ASS-Eigenschaften wird nun aber anschaulich klar, dass es einen Zusammenhang zwischen den Faktoren Schweregrad der Symptomatik, psychiatrische Komorbiditäten, Intelligenz, kognitive Kompensationsressourcen, psychosoziale Unterstützungsfaktoren auf der einen Seite und dem Präsentationsalter auf der anderen Seite gibt, zumindest wenn große Gruppen betroffener Menschen statistisch betrachtet werden. Je später sich Betroffene aufgrund einer psychosozialen Dekompensation dem medizinischen Hilfesystem präsentieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schweregrad der Symptomatik geringer ausgeprägt ist, der IQ und andere kognitive Ressourcen höher sind und ein unterstützendes soziales Umfeld gegeben ist. Umgekehrt sprechen eine hohe Symptombelastung, eine niedrige Intelligenz, geringe kognitive Kompensationsressourcen, psychiatrische Komorbiditäten wie eine ADHS oder depressive Syndrome und ein invalidierendes Umfeld für eine frühe psychosoziale Dekompensation der Betroffenen.
Abb. 1 Illustration des komplexen Zusammenwirkens unterschiedlicher Einflussfaktoren auf das Erstmanifestationsalter von Menschen mit hochfunktionalen Autismus-Spektrum-Störungen
Aus dieser Betrachtungsweise wird klar, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen systematischen Unterschied zwischen den Patienten gibt, die sich erstmalig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie auf der einen und der Erwachsenenpsychiatrie und -psychotherapie auf der anderen Seite vorstellen.
In diesem Zusammenhang ist es interessant, auf die Rolle der Schule als möglichen Belastungsfaktor für Menschen mit ASS zu reflektieren. Intuitiv könnte zunächst davon ausgegangen werden, dass die Schule für Menschen mit ASS in erster Linie einen Belastungsfaktor darstellt. Denn man bewegt sich permanent in der sozialen Gruppe der Klassengemeinschaft und ein Großteil der schulischen Beschäftigung findet in Gruppen statt.
Gerade für Menschen mit hochfunktionalem ASS stellt die Schule nach klinischer Erfahrung aber auch einen stabilisierenden Faktor dar. Denn sie ist geprägt durch Routinen und eine ausgesprochene Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit der alltäglichen Abläufe. Dies kommt dem Bedürfnis Betroffener nach erwartungsgemäßen Tagesabläufen sehr entgegen. Es gibt wenige Zeiten im Leben, in denen man schon im Frühjahr weiß, was Mitte November mittwochs vormittags auf der Agenda steht. Gerade dies aber ist während der Schulzeit der Fall. Die schulischen Jahre – und bedingt auch noch die Universität zumindest sofern ein verschultes Studienfach gewählt wird – gehören zu den geregeltsten Zeiten im Leben vieler Menschen. Und gerade dies kommt dem Stärke-Schwäche-Profil von Menschen mit ASS entgegen.
Zudem wird in den Schulen viel Wert auf rein kognitive Leistungen gelegt. Trotz steigender Anforderungen im Sinne der sozialen Kognition (vermehrte Gruppenarbeit etc.) stehen in den meisten Schulen nach wie vor Wissenserwerb sowie mathematisch-technische Fertigkeiten im Zentrum des Erziehungsziels. Und gerade in diesen Bereichen tun sich viele hochfunktionale Autisten sehr leicht, sodass sie über gute Schulnoten ihr Selbstwertgefühl weiter stabilisieren können. Vor allem dann, wenn das Klima in den Klassengemeinschaften geprägt ist von Akzeptanz und Toleranz und individuelle Eigenheiten und Schrulligkeiten hingenommen werden, kann die Schulzeit für hochfunktionale Autisten eine gute Zeit sein. Allenfalls die großen Pausen, in denen man in der Peergroup herumhängt und „quatscht“ wird dann oft als Belastung erlebt, für die sich aber rasch individuelle Umgehungsstrategien finden (z.B. in der Bibliothek Bücher lesen).