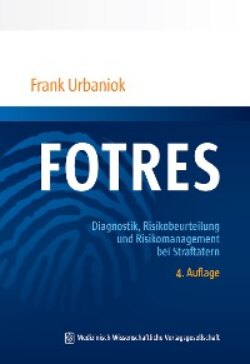Читать книгу Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter - Группа авторов - Страница 41
4.1 Vorbemerkungen
ОглавлениеDer wahrscheinlich weltweit bekannteste „Autist“ Kim Peek, der wegen seines außergewöhnlichen Gedächtnisses auch außerhalb der Fachwelt Beachtung fand und Vorbild des Raymond Babbitt in „Rain Man“ war, zeigte in kernspintomografischen Untersuchungen eine weitgehende Agenesie des Corpus callosum und litt – so wird gemutmaßt – an einem FG-Syndrom (auch bekannt als Opitz-Kaveggia-Syndrom; Opitz et al. 2008). Dabei handelt es sich um eine strukturelle Chromosomenanomalie des X-Chromosoms mit verschiedenen somatischen, skelettmorphologischen und psychiatrischen (und eben auch: autistischen) Symptomen. War er also – so stellt sich die Frage – doch kein „Autist“? Weder ICD-10 noch DSM-5 beinhalten klare Vorgehensweisen, wie autistische Symptome unterschiedlichen Ausmaßes, die im Rahmen von übergeordneten Syndromen auftreten, klassifiziert werden sollen.
Auch das bei Hans Asperger in dessen Habilitationsschrift beschriebene Kind Hellmuth L. zeigt keine reine „autistische Psychopathie“, sondern eine Asphyxie nach der Geburt, epileptische Anfälle, Zeichen einer generellen Entwicklungsverzögerung, trotz strenger Diät eine Adipositas permagna, einen beidseitigen Kryptorchismus, eine Schilddrüsenunterfunktion, deutlich überstreckbare Gelenke, Hypersalivation, Senkfüße und eine „groteske“ Schädelform (Asperger 1944). Man könnte bei Adipositas, Kryptorchismus, Entwicklungsverzögerung, Senkfüßen und Schilddrüsenproblemen z.B. an ein Prader-Willi-Syndrom denken – und dann etwas überspitzt fragen: Wäre ein Prader-Willi-Syndrom bei Hellmuth L. nachgewiesen worden, hätte Asperger ihn dann in seine Fallgeschichten überhaupt aufnehmen dürfen? Oder: Ab wann schließt der Verdacht auf ein „übergeordnetes“ Syndrom die Diagnose einer ASS eigentlich aus?
Diese Fragen stellen sich im klinischen Alltag gar nicht so selten und sind – das soll aus den beiden Beispielen deutlich werden – mit der gewünschten Eindeutigkeit häufig nicht zu beantworten. Insbesondere in denjenigen Fällen, in denen bei sehr wahrscheinlichem oder nachgewiesenem Vorhandensein eines übergeordneten Syndroms die autistischen Symptome im Zentrum der Auffälligkeiten stehen, muss die Entscheidung, ob eine ASS-Diagnose gestellt wird, immer wieder individuell abgewogen werden. Auch bei unvollständiger oder atypischer autistischer Symptomatik und einem vermuteten, aber nicht nachgewiesenen Syndrom stellt sich oft die Frage nach einer ASS-Diagnose – und zwar nicht zuletzt deswegen, weil alternativ oft gar keine Diagnose gestellt werden kann und störungsspezifische Hilfen dann vollständig ausbleiben. Ohne diese zweifellos schwierige Diskussion weiter vertiefen zu wollen, sei damit gleich zu Anfang dieses Kapitels illustriert, dass der Zusammenhang zwischen ASS und autistischen Symptomen auf der einen Seite und definierten genetischen (und gelegentlich auch erworbenen) Syndromen auf der anderen Seite bis heute nur teilweise beschrieben, ansatzweise verstanden und nosologisch noch nicht in eine allgemein anerkannte Form gegossen ist.
Relativ gut belegt ist dabei die Vermutung, dass manchen ASS monogenetische oder oligogenetische Ursachen zugrunde liegen und andere auf komplexen polygenetischen Erbgängen beruhen (Aitken 2010). Konkret gehen verschiedene Autoren davon aus, dass zwischen 10 und 20% der diagnostizierten ASS eine „syndromale“ Ursache haben (Cohen et al. 2005; Moss u. Howlin 2009), also im Rahmen meist monogenetisch verursachter vorbeschriebener Syndrome auftreten. Aufgrund dessen, dass genetische Reihenuntersuchungen von ASS bislang nur selten durchgeführt wurden (Gilman et al. 2011), ist diese Zahl aber relativ spekulativ und basiert auf der (von der Freiburger Arbeitsgruppe geteilten) Beobachtung, dass etwa ein Fünftel bis ein Zehntel der Sprechstundenpatienten mit ASS zusätzlich zu ihren autistischen Symptomen skelettmorphologische Auffälligkeiten, Bindegewebsprobleme, Ohrmuscheldysplasien, Herzfehler, Augenprobleme, Muskelhypotonie oder -spastik, Epilepsien, Beschleunigung oder Verlangsamung des Wachstums, Immundefekte, Hautveränderungen o.ä. aufweisen.
Nun ist für etwa hundert definierte genetische und einige erworbene Syndrome ein gehäuftes Auftreten autistischer Symptome nachgewiesen; in einigen Fällen kann die ASS auch Leitsymptom des jeweiligen Syndroms sein. Diese Konstellation macht (in Kombination mit den oben beschriebenen klassifikatorischen Schwierigkeiten) deutlich, dass die Diagnostik der mit Autismus assoziierten Syndrome durchaus schwierig und unübersichtlich werden kann. Nichtsdestotrotz ist es aus Sicht des Autors sinnvoll, in die Diagnostik von ASS Kenntnisse über potenziell ursächliche Syndrome einfließen zu lassen (s. folgende Aufzählung).
Syndromdiagnostik ist sinnvoll,
um (zum Beispiel bei Bindegewebserkrankungen) regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen einleiten zu können.
um die Vererbbarkeit einer Erkrankung besser einschätzen zu können.
um lange unklar gebliebenen Erkrankungen (oft Mischbilder aus ASS, ADHS, Depression, psychoseähnlichen Zuständen) einen unzweideutigen Namen geben zu können.
um (seltene) therapierbare Erkrankungen frühzeitig erkennen zu können.
um langfristig differenzierte Therapiemethoden entwickeln zu können.
Im Folgenden sollen nun einige Syndrome, die mit ASS oder autistischen Symptomen einhergehen, besprochen werden. Dabei sollen fünf Syndromkomplexe mit klaren genetischen Korrelaten paradigmatisch ausführlicher besprochen, andere – auch der Übersichtlichkeit halber – nur kurz zusammengefasst werden.