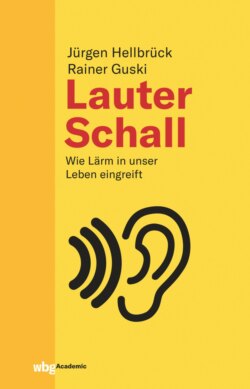Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 10
Lärm und Macht
ОглавлениеGott Enlil, Sohn des Gottkönigs An und nach jenem die zweithöchste Gottheit in der Genealogie der sumerischen Götterwelt, befahl, Sterbliche zu schaffen, welche die Arbeit verrichten mussten, der die Götter überdrüssig wurden. Anfangs nur sieben Frauen und Männer, vermehrten sich die Sterblichen jedoch bald so sehr, dass ihr Lärm und Geschrei bis zu den Göttern drangen: „Das Land lärmte wie ein schnaubender Stier und der Gott wurde ruhelos von dem Getöse“. Gott Enlil – sein Name bedeutet „Herr des lauten Wortes“ – schickte eine große Flut, um die Menschen zu ertränken und mit der Flut einen Sturm, dessen Heulen ihr Geschrei übertönte; denn allein der Gott verfügt über die Macht und das Recht, laut zu sein. So steht es im Atrahasis-Epos, niedergeschrieben etwa 1800 v. Chr. (LAMBERT, MILLARD & CIVIL, 1969).
Wer die anderen übertönt, ist mächtiger als sie, und diejenigen, die unterlegen sind, ducken sich und schweigen. Götter sind die mächtigsten von allen. Sie sprechen zu den Menschen durch Vulkaneruptionen, durch das tosende Meer und den krachenden Donner. Thor, auch Donar genannt, ist der mächtige germanische Gott des Donners. Der keltische Gott Taranis und der griechische Göttervater Zeus schleudern im Blitz den „Donnerkeil“ auf die Erde. Sie demonstrieren Macht und Willkür im alles umfassenden und erdrückenden lauten Geräusch. Dem vermag keiner der Menschen auszuweichen und jeder respektiert es. Raymond Murray SCHAFER (geb. 1933), kanadischer Komponist und Klangforscher, nannte dies den „heiligen Lärm“, in den er auch das Dröhnen der Kirchenglocken und der Orgel einschloss.
Auch heute neigen wir nicht dazu, den Donner eines Gewitters, das Heulen des Sturms oder das Tosen der Flut als Lärm zu bezeichnen. War dies früher die Sprache der Götter, so können wir deren Entstehen naturwissenschaftlich erklären und verstehen es als Teil der Natur, also dessen, was ohne das Zutun des Menschen besteht und sich entwickelt. Was Menschen absichtlich oder unabsichtlich an Geräuschen herbeiführen, kann zu „Lärm“ werden, zu Geräuschen, die uns lästig sind, die wir für überflüssig erachten und über die wir uns ärgern. Und meist ärgern wir uns dann auch über jene, die das Lärmen verursachen.
Menschen demonstrieren, ähnlich wie früher die Götter, über Lautstärke ihre Macht, wenn sie andere Menschen „niederbrüllen“, mit Geschrei also unterwerfen, oder mit Trillerpfeifen, Hupen und Blechtrommeln auf Straßen und Plätzen ihre Ansprüche durchzusetzen versuchen. Krawall gehört dazu und wird leicht zum Selbstläufer, verstärkt sich und reißt mit, erfasst die Massen und vereint sie. Hitler und seine Nazi-Schergen brüllten und die Masse brüllte im Gleichklang zurück. Im Lärm der Masse „tritt der Einzelne aus sich heraus“, gerät in „Ekstase“, ist zu keinem eigenständigen Denken mehr in der Lage. Von „Deindividuation“ spricht in solchen Fällen die Sozialpsychologie.
Natürlich ist nicht jede Diktatur mit Lärm verbunden. Es gibt auch subtilere Formen der unterdrückenden Machtausübung. Macht, Volksmasse, Lautstärke und Lärm scheinen jedoch zusammenzugehören. Aber auch dort, wo Massen zum Feiern zusammenkommen, in Bierzelten und auf Rockkonzerten, geht der Einzelne in der Lautstärke unter und gibt seine Individualität und Souveränität auf. „Lärm“ und „Masse“ haben daher bei den „feineren Menschen“ keinen guten Ruf. Der feinsinnige, gebildete Mensch lärmt nicht, meidet den Lärm und verbindet sich auch nicht mit der lärmenden Masse. Er ist besorgt um seine Unabhängigkeit und Freiheit. „Kultur ist Entwicklung zu Schweigen! – Selige Ruhe liegt über allem Vollendeten“, sinniert der Philosoph und streitbare Lärmbekämpfer Theodor LESSING. LESSING, 1872 geboren, von den Nazis verfolgt und 1933 ermordet, publizierte 1908 eine „Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens“, wo auch dieses Zitat zu finden ist. Er gründete in Hannover den „Antilärmverein“, der mit der Zeitschrift „Der Antirüpel“ eine Plattform bereitstellte, um das Unbehagen am Lärm zum Ausdruck zu bringen. Für Lessing ging es aber um mehr als nur um den Kampf gegen den Lärm. Er schimpfte auf alles, was ungehobelt, ungebildet, schreiend und grölend daherkommt. Lärm war für ihn plebejisch, ordinär, ungeschliffen, eben rüpelhaft, jedenfalls nichts, womit vornehme, gebildete Menschen etwas gemein haben sollen. Wie wir oben schon andeuteten: Lärm ist mehr als ein akustisches Phänomen!
Weniger kulturkritisch, eher pragmatisch äußerte sich die New Yorkerin Julia Barnett RICE, die 1906 im fortschrittsgläubigen Amerika die „Society for Suppression of Unnecessary Noise“ gründete. Sie bekämpfte die unnötigen Geräusche und machte Vorschläge, wie man sie vermeiden könne. Sie empfahl Gummireifen für die scheppernden Milchwagen und Gummiüberzüge für die Pferdehufe, Lichtsignale anstatt der Trillerpfeifen der Verkehrspolizisten und kämpfte gegen das Hupen der Schiffe auf dem Hudson River, das, wie sie herausgefunden hatte, weniger als achtungsgebietendes Signal eingesetzt wurde, sondern meist zum Grüßen (vgl. GEISEL, 2010, S. 74).
Lärm greift in den Raum ein, in dem Einzelne oder Gruppen souverän agieren können und beschränkt dadurch ihre Freiheit. Psychologisch gesehen gibt es zwei Arten von Räumen, welche die Souveränität gewährleisten. Zum einen sind das feste, ortsgebundene Räume, die wir als Territorien bezeichnen, und zum anderen solche, die sich wie eine Blase um den Einzelnen legen, an ihn gebunden sind und sich mit ihm bewegen. Letztere bezeichnet man laut dem Anthropologen Edward T. HALL als „persönliche Räume“ (personal space). Sie stellen eine verborgene Dimension – „The Hidden Dimension“, so der Titel von HALLS 1966 erschienenem Buch – des sozialen Zusammenlebens dar.
Es gibt für den Menschen primäre Territorien, wie das Haus und die Wohnung, darin das „eigene“ Zimmer oder das Schlafzimmer; es gibt außerhalb der primären Territorien sekundäre Territorien, die wir mit Freunden teilen, wie die Stammkneipe, und tertiäre, öffentliche Territorien, wo man sich mit anderen – Freunden oder Fremden – zuhause fühlt, wie die Heimatgemeinde oder der Stadtteil, in dem man wohnt.
Abb. 1: Theodor LESSING (1872–1933), Gründer des „Antilärmvereins“. (Quelle: akg-images/TT News Agency/SVT).
Der persönliche Raum reguliert die zwischenmenschliche Kommunikationsdistanz, je nach der Kommunikationsfunktion. Die Lautstärke der Stimme spielt hierbei eine wichtige Rolle. Die intime Distanz, die nur wenige Zentimeter betragen kann, verträgt nur das Flüstern, die private Distanz beim Gespräch zweier gegenüberstehender Personen die normale Lautstärke mit entspannter Sprechstimme, und die öffentliche Distanz reicht so weit, wie lautes Rufen trägt. Zu lautes Sprechen bei geringer Distanz wird als aufdringlich empfunden, die Anspannung steigt aufgrund der bedrohten Freiheit und die Distanz wird durch Zurückweichen oder Wegdrücken des Gegenübers vergrößert. Zu geringe Lautstärke strengt beim Zuhören an und erhöht ebenfalls die Anspannung durch Fokussierung der Aufmerksamkeit und vermehrte Höranstrengung. Anbrüllen vergrößert die Distanz und erniedrigt, Flüstern dagegen lockt, verführt zum Lauschen.
Territorien werden markiert, im Tierreich häufig durch Duftspuren, aber auch durch Lautäußerungen. Ob der Gesang der Vögel oder das nächtliche Brüllen der Löwen – die Reichweite der Stimme markiert die territorialen Ansprüche. Kein Artgenosse und Futterkonkurrent soll es wagen, „in Rufnähe“ zu kommen.
Wer Lärm, also laute, unangenehme Geräusche, einschließlich Musik, die durch Art, Lautstärke und Wiederholung als unangenehm empfunden wird, absichtlich einsetzt, verfolgt damit das Ziel, andere Menschen gezielt zu belästigen, einzuschüchtern oder zu vertreiben. Dies kann auch auf subtile Weise erfolgen, wie die Beschallung von U-Bahnhöfen mit klassischer Musik, die pöbelnden Jugendlichen, die eher das Hard-Rock-Genre favorisieren, signalisiert, dass dies nicht ihr Territorium ist, in dem sie sich auf Dauer aufhalten und Passagiere belästigen können. Umgekehrt schallt aus den Ghetto-Blastern von Jugendlichen, die auf der Straße leben, Musik von einer Art und Lautstärke, die andere Personen nicht animiert, näher zu kommen. Auch das ist eine Art akustischer Territorialmarkierung.
Mit Lärm verbannen wir auch böse Geister aus dem Territorium der Lebenden. An Silvester sollen Böller und Kracher böse Geister daran hindern, mit in das neue Jahr zu ziehen. Auch in der Walpurgisnacht oder beispielsweise beim schwäbisch-alemannischen Klausentreiben soll viel Lärm die Geister bannen. Der Brauch, einem „Brautauto“ Blechbüchsen an die hintere Stoßstange zu binden und im Konvoi laut hupend durch die Straßen zu fahren, kommt ebenfalls daher, böse Geister, die dem Glück eines jungen Paares im Wege stehen könnten, durch Krach zu vertreiben. Heute „vertreibt“ man damit eher die Passanten und verärgert die Anwohner. Auch der „Polterabend“ vor dem eigentlichen Hochzeitstag geht auf diesen Brauch zurück. Man schlägt damit Geister und Gespenster mit ihren eigenen Waffen, favorisieren sie doch selbst – die Polter- und Klopfgeister – Lärm, lautes Klagen und Kettenrasseln, um Menschen Angst einzujagen.
Wir empfinden es als impertinent, wenn Lärm durch Wände und Fenster in unsere Territorien dringt. Es ist, als würde der Lärmverursacher ungefragt und unerlaubt unsere Wohnung betreten und sich in unsere Gespräche, in unsere Gedanken einmischen, uns den Musikgenuss oder den Fernsehabend vermiesen oder unsere Tagträume und Nachtruhe stören. Lärm, der von außen in unsere Territorien eindringt, verletzt unsere Rechte auf Freiheit, Autarkie und Souveränität innerhalb unseres eigenen Territoriums, erzeugt Ärger und Wut und ist nicht selten Anlass von Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn, die manchmal auch gewalttätig enden. Auch Verkehrslärm, der in primäre, halböffentliche oder öffentliche Territorien dringt, wird vielfach als Zumutung empfunden. Hier richtet sich der Zorn jedoch häufig gegen die Regierenden, die dies zulassen, mit der Folge, dass das Verhältnis zwischen „denen da oben“ und dem Volk oftmals von Misstrauen geprägt ist.
Nicht um sich Konkurrenz vom Leib zu halten, sondern um das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken, läuten die Kirchenglocken. Sie rufen die Gläubigen eines Pfarrsprengels zusammen, dienen der Information über besondere Ereignisse und markieren akustisch die Grenzen der Pfarrei. Wenn wir früher in den ländlichen Regionen die heimischen Glocken nicht mehr hören konnten, hatten wir die primäre Heimat verlassen und fremden Boden betreten (vgl. CORBIN, 1995). Eine ähnliche Funktion wie die christlichen Kirchenglocken erfüllt der Ruf des Muezzins in den islamischen Ländern. Nur die Juden – so GEISEL (2004, S. 28) – haben kein Klangzeichen, um den Geltungsbereich ihres Glaubens räumlich anzuzeigen. Sie hatten ja auch über zwei Jahrtausende kein eigenes Territorium. Sie waren eher gezwungen, sich still zu verhalten und nicht aufzufallen.
Auch die Kirchenglocken sind heute oft Grund für Lärmbeschwerden. In einer säkularen Welt gestehen wir den Kirchen keinen „heiligen Lärm“ mehr zu, und ihre Funktion als Zeitanzeige und Informationsmedium haben die Glocken auch schon längst verloren.