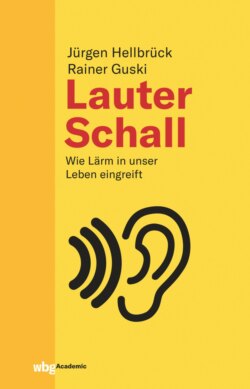Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 12
„Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall“
ОглавлениеFür den einen Eule, für den anderen Nachtigall: Laute Hardrock-Musik kann den einen euphorisieren, den anderen in den Wahnsinn treiben. Der Puls ist bei beiden erhöht. Die ausgelöste Emotion hängt also von der Bewertung und dem situativen Kontext ab. Nach der Zwei-Komponenten-Theorie des amerikanischen Sozialpsychologen Stanley SCHACHTER aus den 1960er Jahren sind Emotionen das Resultat zweier zusammenwirkender Faktoren, nämlich der physiologischen Erregung einerseits und der vom Kontext abhängigen kognitiven Bewertung andererseits. Das gleiche Herzrasen kann je nach Zusammenhang mit Freude oder Furcht einhergehen, je nachdem, wie die Situation interpretiert wird.
Laute Musik, Singen, Lachen und Grölen heizen die Teilnehmer einer Party zusätzlich an, enthemmen, stimulieren und schaukeln sich immer mehr auf. Das Nervenkostüm des Nachbarn vibriert ebenfalls, allerdings aus anderen Gründen. Jetzt wäre es vorteilhaft, wenn der Nachbar vom Party-Veranstalter freundlich auf das Ereignis vorbereitet worden wäre, sodass er den Partylärm kognitiv so bewerten und einordnen könnte, dass er sich nicht angegriffen fühlt, und seine Erregung nicht in aggressive Gefühle oder gar gewalttätige Handlungen mündet.
Hohe Lautstärke ist oft Ausdruck purer Lebensfreude. „Schrei vor Glück“ lautete der Slogan eines Einkaufsportals im Internet. Anwohner von Kinderspielplätzen und natürlich auch Eltern wissen, mit welcher Lautstärke das Herumtoben von Kindern verbunden sein kann. Auch der große Komponist Richard WAGNER war damit vertraut und soll allen Ernstes vor seinem Haus Glasscherben verstreut haben, um Kindern dort das Spielen und Lärmen zu verleiden (PAUL & SCHOCK, 2014). Und heute? „80-Jährige droht wegen Kinderlärm mit Pistole“, so eine Schlagzeile von BILD am 07.05.2018.
Das Recht auf eine kindgemäße Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit einerseits und der Anspruch auf Ruhe andererseits kommen nicht selten in Konflikt und wurden in den letzten Jahren verstärkt Gegenstand juristischer und politischer Diskussionen. Diese führten zu einem Toleranzgebot, demzufolge üblicher Kinderlärm „keine schädliche Umwelteinwirkung“ sei und daher toleriert werden müsse. Freilich gibt es in Einzelfällen Spielraum für Interpretation, etwa, was „üblicher“ Kinderlärm ist. Fest steht, dass Kindern unter sieben Jahren die Einsichtsfähigkeit fehlt (§ 104 BGB), dass aber Spiellärm in den üblichen Ruhezeiten auch Nachbarn stören kann.
Auch für den eingefleischten Motorrad- oder Sportwagenfahrer ist es ein Stück Lebensqualität, die Kraft seines Boliden zu spüren – und zu hören. Was für diejenigen, die auf der Terrasse ihren Sonntagnachmittagskaffee genießen wollen, ein Höllenlärm ist, ist für ihn Musik in den Ohren.
Lärm ist janusköpfig, ambivalent, immer konfliktträchtig und damit ein gesellschaftliches Problem. Mag es sich bei lärmenden Motorradfahrern oder rasenmähenden Nachbarn noch um vereinzelte, individuell zu lösende Probleme handeln, betreten wir bei Industrie- und Verkehrslärm Problemfelder mit politischen Dimensionen. Hier stehen sich oft massive wirtschaftliche Interessen und der Schutz des Wohlbefindens und der Gesundheit gegenüber.
Wir wollen nun aber endlich der Frage nachgehen: Was ist Lärm eigentlich? Können wir Lärm in einem Satz definieren?