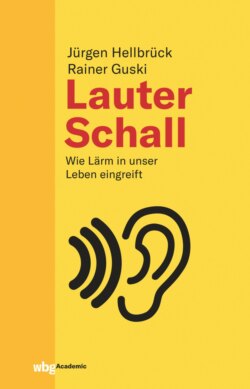Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 13
Was ist Lärm?
ОглавлениеLärm ist Schall, aber natürlich ist nicht jeder Schall Lärm. Schall ist Gegenstand der Physik und ihres Teilgebiets Akustik. Schall wird durch Bewegungen erzeugt, durch die Luftmoleküle angestoßen und in Schwingung versetzt werden, die ihrerseits wieder benachbarte Luftmoleküle zu Schwingungen anregen. So entsteht eine Schallwelle (→ Kap. 3). Diese Schallwelle dringt in unser Ohr, bringt das Trommelfell zum Schwingen, regt die Gehör-Rezeptoren und Fasern des Hörnervs an und wird von unserem Gehirn „ausgewertet“ und emotional bewertet (→ Kap. 4). Ist diese Bewertung negativ, dann wird der Schall für uns zu Lärm. Lärm ist also ein Geräusch, das uns unangenehm ist, unsere Aufmerksamkeit ablenkt, die Konzentration stört und das Denken behindert (→ Kap. 5), unser Verhalten beeinträchtigt, unsere Handlungen unterbricht und dadurch lästig wird (→ Kap. 7). Das macht Lärm zu einem Gegenstand der Psychologie, der Wissenschaft vom Erleben und Verhalten. Lärm kann auch, wie wir später noch sehen werden, uns die Ruhe und den Schlaf rauben (→ Kap. 6), Vermögenswerte vernichten und unsere Gesundheit gefährden (→ Kap. 8). Das macht ihn zu einem Gegenstand von Volkswirtschaft und Medizin. Lärm will man akustisch vermeiden oder mindern. Das macht Lärm zu einem Anwendungsgebiet der Ingenieurakustik. Lärm sollte, wenn nicht vermeidbar, gedämmt und an seiner Ausbreitung gehindert werden. Das macht ihn zu einem Gegenstand der Bauakustik. Lärm bringt viele Wissenschaften zusammen. Das Bemühen, ihn zu bekämpfen, verbindet Ursachenforschung und Praxis (→ Kap. 9).
Das Wort „Lärm“ leitet sich ab von „Alarm“. Dieses Wort geht auf das italienische „all’arme“ zurück, den Kampfruf „Zu den Waffen!“. Dass Lärm den Organismus alarmiert, auf Kampf oder auch Flucht vorbereitet und dabei Energiereserven aktiviert, dürften einige der oben beschriebenen Beispiele verdeutlicht haben.
Wir alle haben ein gewisses Alltagsverständnis von Lärm. Wir verbinden mit diesem Begriff Geräusche von hoher Lautstärke. Unter Geräuschen verstehen wir Hörempfindungen, die wir nicht als Ton oder Klang bezeichnen würden, die keine Konturen aufweisen, eher unstrukturierte Zusammensetzungen von Schallschwingungen darstellen und in der Regel keine periodischen Muster aufweisen wie beispielsweise musikalische Klänge. Geräusche von Verbrennungsmotoren können, wenn sie laut sind, für uns zum Lärm werden. Eine einzelne Stimme, auch wenn sie laut ist und wir uns über sie ärgern, würden wir im Alltag eher nicht als Lärm bezeichnen, denn es handelt sich für unser Hörerleben um ein klar erkennbares, konturiertes Hörphänomen. Lautes Stimmengewirr, wie es an einem Sommerabend aus einem nahe gelegenen Biergarten in unser Wohnzimmer schallt, wäre dagegen für uns Lärm.
Doch die hörakustischen Merkmale eines Schalls sind nicht allein ausschlaggebend dafür, dass ein Schall zu Lärm wird. Unter Lärm verstehen wir, wie schon gesagt, Geräusche, die lästig und unangenehm sind, die uns von unserem eigentlichen Tun ablenken und stören. Bei unserem alltäglichen Grundverständnis von Lärm handelt es sich um laute, unstrukturierte Geräusche, die eine unerwünschte Wirkung auf uns ausüben. Dies heißt aber auch, dass wir, wie oben bereits angedeutet, nicht jedes Geräusch, das uns belästigt, in unserem Alltag als Lärm bezeichnen würden. Auch der sirrende Ton einer Stechfliege, der tropfende Wasserhahn oder die knackende Heizung können uns extrem stören und lästig werden. Aber „Lärm“ ist das in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nicht. Eine gewisse Lautstärke und Geräuschcharakteristik gehören schon dazu und auch, dass das Geräusch von Menschen verursacht ist und wir es für unnötig und vermeidbar halten. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass man über eine Definition von Lärm lange diskutieren kann.
Die Wissenschaft muss sich nicht an der Alltagssprache orientieren, um ihren Gegenstand abzugrenzen und zu definieren. Dies ist sogar oft hinderlich und kontraproduktiv, da die Alltagssprache meist ungenau und widersprüchlich ist. Die wissenschaftliche Lärmwirkungsforschung versteht unter Lärm unerwünschten Schall. Schall kann aus mehreren Gründen unerwünscht sein: Schall kann allein aufgrund seiner wahrgenommenen akustischen Attribute, also aufgrund hoher Lautstärke, oder seiner schrillen, kratzigen oder rauen ▸ Klangfarbe unangenehm sein. Er kann aber auch unerwünscht sein, weil er mit unserer jeweiligen Tätigkeit interferiert, sie unterbricht und stört. Bei Letzterem kann es sich auch um akustische Ereignisse handeln, die unter anderen Umständen als angenehm empfunden würden, wie etwa Musik. Schall kann uns aber auch an Unangenehmes erinnern, Gedanken auslösen, die ihrerseits unsere Tätigkeiten beeinträchtigen. Der tropfende Wasserhahn des Nachts ist nicht nur wegen seines repetitiven Charakters lästig, sondern auch deshalb, weil er uns an den unnötigen Wasserverbrauch denken lässt und daran, dass wir am nächsten Tag dringend für Abhilfe sorgen müssen – aber eigentlich keine Zeit dafür haben. Das Geräusch der Stechfliege lässt einen schmerzhaften, juckenden Stich erwarten. Da ist an Schlaf nicht zu denken. In diesem Fall besteht die lästige Wirkung in der Warnfunktion des Schalls, die uns keine Ruhe lässt.
An diesen Beispielen kann auch deutlich werden, dass unerwünschter Schall unterschiedliche Grade von Individualität aufweisen kann. Während das laute Kreischen einer Metallsäge jeden zusammenzucken und reflexartig die Hände an die Ohren pressen lässt, sind Geräuschbelästigungen durch haustechnische Anlagen auch davon abhängig, ob wir Hauseigentümer oder Mieter sind, ob wir mehr oder weniger skrupulös bezüglich Wasserbrauch oder möglicher technischer Defekte, emotional eher labil oder robust sind. Die interindividuelle Variabilität und der große Einfluss nicht-akustischer Faktoren der Lärmwirkung stellt für die Lärmwirkungsforschung ein weites Feld dar, in dem sich viele wissenschaftliche Disziplinen tummeln. Und natürlich auch Interessensvertreter, die sich aus ihrer jeweiligen Perspektive oftmals in den wissenschaftlichen Diskurs einmischen, dabei Ergebnisse eigenwillig oder einseitig interpretieren oder Methoden in Frage stellen und insgesamt den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen das Leben nicht immer leicht machen. Das muss jedoch kein Nachteil für den Forschungsprozess sein. Kritik ist wichtig und notwendig, und Lärmwirkungsforschung kein Selbstzweck, sondern zum Nutzen für die Allgemeinheit.
Oft – manchmal auch von den selbstbewussten, sich ihrer Exaktheit rühmenden Naturwissenschaftlern etwas geringschätzig vorgetragen – wird betont, dass Lärm im Gegensatz zum objektiv messbaren Schall „etwas Subjektives“ sei. Man begründet dies gerne mit dem individuell unterschiedlichen Lärmerleben. So wie oben etwas plakativ formuliert: „Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall.“ Das ist richtig und falsch. Richtig ist, dass Lärm ein subjektives Phänomen ist, also etwas vom Menschen Erlebtes darstellt, das sich auf sein Verhalten auswirkt. Dass das Erleben des Lärms individuell unterschiedlich ausfallen kann, ist selbstverständlich und kein Problem, das den Forschungsgegenstand substanziell berührt oder ein wertendes Abgrenzungskriterium gegenüber „objektiv“ begründet. Ein und derselbe Schall, objektiv, also physikalisch gemessen, kann in der Tat für den einen „Uhl“ und für den anderen „Nachtigall“ sein. Es gibt aber auch Schallereignisse, wie das oben erwähnte Kreischen einer Metallsäge, die von keinem als „Nachtigallengesang“ wahrgenommen werden. Auch haben wir jedenfalls noch keinen getroffen, der beispielsweise im unmittelbaren Nahbereich des Frankfurter Flughafens oder der Bahntrassen im mittleren Rheintal wohnt und diesen „Sound“ als wohltuend und angenehm empfindet.