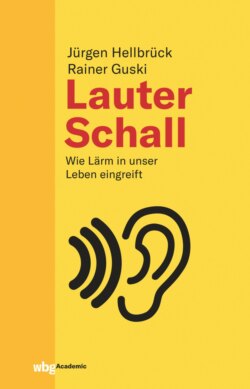Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 21
Schallplatte, Verstärker, Lautsprecher und Co
ОглавлениеDer Teufel kam hinauf zu Gott
und brachte ihm sein Grammophon
und sprach zu ihm, nicht ohne Spott
Hier bring ich Dir der Sphären Ton.
(Christian MORGENSTERN, Galgenlieder; wiedergegeben nach PAUL & SCHOCK, 2014)
Der große Philosoph Immanuel KANT (1724–1804) hat die janusköpfige Erscheinung der Musik in seiner 1790 erschienen „Kritik der Urteilskraft“ erkannt: „Diejenigen, welche zu den häuslichen Andachtsübungen auch das Singen geistlicher Lieder empfohlen haben, bedachten nicht, dass sie dem Publikum durch eine solche lärmende … Andacht eine große Beschwerde auflegten, indem sie die Nachbarschaft entweder mitzusingen oder ihr Gedankengeschäft niederzulegen nötigten.“ (KANT, 2004; § 53).
Die Freiheit, nach Lust und Laune zu leben, hört dort auf, wo sie die Freiheit der anderen begrenzt. In kaum einem anderen Bereich der Akustik wird dies so deutlich wie in der Welt der Musik, die zur Freude und – um bei KANT zu bleiben – der Erbauung der einen zu dienen vermag und gleichzeitig zum Verdruss der anderen beiträgt. Rücksichtnahme, aber auch Toleranz sind hier gefragt. Und Toleranz zu üben fällt manchmal schwer, denn unerwünschte Musik kann schon sehr auf die Nerven gehen.
Am 18. Juni 1821 wurde Carl Maria VON WEBERS Oper „Der Freischütz“ am Königlichen Schauspielhaus zu Berlin uraufgeführt. Schon kurze Zeit danach klagte Heinrich HEINE, seit eben diesem Jahr Student an der Berliner Universität, in seinen „Briefe[n] aus Berlin“, die 1822 im „Rheinisch-Westfälischen Anzeiger“ erschienen: „Wenn Sie vom Hallischen bis zum Oranienburger Tore gehen, hören Sie jetzt immer und ewig dieselbe Melodie, das Lied aller Lieder: Den ‚Jungfernkranz‘„:
Wir winden Dir den Jungfernkranz
mit veilchenblauer Seide;
wir führen dich zu Spiel und Tanz, zu Lust und Hochzeitsfreude.
Schöner, schöner, schöner grüner Jungfernkranz,
mit veilchenblauer Seide, mit veilchenblauer Seide!
Es war vielleicht der erste Pop-Song, das erste populäre Lied, das nahezu jedem bekannt war und das jeder und jede singen, pfeifen oder am Klavier spielen wollte, und das, wie HEINE ausführte, zu seinem Ärger aus jeder Gasse und aus jedem Fenster schallte. Was hätte HEINE wohl erst gesagt, wenn es damals schon Tonträger, Verstärker und Lautsprecher gegeben hätte? Auch Antōnio Carlos JOBIM soll es ähnlich wie HEINE ergangen sein, nur, dass er seiner eigenen Komposition überdrüssig wurde. Er wollte seinen 1962 komponierten Welthit „The Girl from Ipanema“ selbst nicht mehr hören, weil er ihm in jeder Hotelbar, in jedem Fahrstuhl und in jedem Kaufhaus begegnete.
Was wäre Musik heute ohne elektronische Verstärker? Wie sähe die Welt aus ohne Radio und ohne Lautsprecher? Wir können es uns nicht mehr vorstellen. Wie hat das alles begonnen?
Thomas Alva EDISON (1847–1931) erfand 1877 den Phonographen. Eine Sensation! Niemals hatte man es für möglich gehalten, diese flüchtige Erscheinung „Schall“ festzuhalten und „aufzuschreiben“ (Phonograph bedeutet wörtlich „Tonschreiber“). Aus dem Phonographen ging später das Grammophon hervor. Es zeichnete sich durch die von Emil BERLINER (1851–1929) entwickelten runden Schelllackplatten aus, die den Schall durch horizontale Ausschläge aufzeichneten. Gegenüber EDISONS zylinderförmigen Tonträgern hatte die von BERLINER sogenannte „Schallplatte“ den Vorteil, dass sie leicht zu reproduzieren war. Damit war dieser Tonträger, der im Gegensatz zu dem Phonographen nur abspielen und nicht aufnehmen konnte, auch für die breite Masse erschwinglich.
Mittels der 1906 von Lee DE FOREST (1873–1961) entwickelten Elektronen- bzw. Vakuumröhre, von DE FOREST „Audionröhre“ genannt, gelang ein weiterer Schritt. Durch sie ließen sich schwache elektrische Signale verstärken. DE FOREST gilt als einer der Väter des Elektronikzeitalters. Die Elektronenröhre wurde erst durch den Transistor überflüssig.
Der bereits erwähnte Emil BERLINER lieferte auch bedeutsame Beiträge zur technischen Entwicklung von Mikrofonen. Als dessen Erfinder gelten Alexander Graham BELL und Philipp REIS. Die Entwicklung des Mikrofons ging Hand in Hand mit der des Telefons. Die Entwicklung der Lautsprecher ging ebenfalls mit der des Telefons einher und ist in der frühen Entwicklungszeit mit den oben bereits genannten Namen BELL, REIS und EDISON verbunden. Kopfhörer oder zumindest Vorläufer davon waren ebenfalls seit Beginn der Telefonentwicklung vorhanden. Radio hörte man in den Anfangszeiten vorwiegend über Kopfhörer.
Lautsprecher können in Kombination mit Verstärkern Lautstärken erreichen, die das Gehör schädigen können. Gleiches gilt auch für Kopfhörer, die das ▸ Schallfeld auf das Volumen des äußeren Gehörgangs reduzieren und den Schall ganz in der Nähe des Trommelfells abstrahlen (→ Kap. 4). Kopfhörer können ein sehr intensives Musikerlebnis ermöglichen, da die Musik quasi innerhalb des Kopfes stattfindet, der Hörer von der übrigen Welt akustisch getrennt wird und ganz in der Musik aufgehen kann.
Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher sowie die verschiedenen Tonträger emanzipierten die Musik und die Sprache. Sie lösten die bis dahin herrschende enge Verbindung zwischen Konzertsaal und Musik, machten Musik und Sprache zeitlich und räumlich unabhängig. Sie erlaubten auch „schwachen Stimmen“ Lieder vorzutragen und ein großes Publikum zu erreichen. Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher ermöglichten neue Darstellungsformen, wie Flüstern, Säuseln und Raunen. Und mittels Tonträgern kann Musik überall und zu jeder Zeit abgespielt werden. Damit war Musik nicht nur für diejenigen da, die sie hören wollten und dafür früher genötigt waren ins Konzert- oder Opernhaus zu gehen, sondern drang auch jenen ins Ohr, die nicht auf sie erpicht waren und für die diese Musik ein Ärgernis darstellte. Belästigung durch Musik, die Wände durchdringt, und Partylärm sind ein häufiger Anlass für Nachbarschaftsstreit.
Musik wird Menschen auch in Restaurants, Kaufhäusern, Wartesälen und Fahrstühlen aufgenötigt. Meist eine belanglose, speziell arrangierte Musik, ohne Thema, ohne Anfang und Ende, ein Musikgeplätscher, das einen angenehmen Hintergrund bilden soll, ohne die Aufmerksamkeit zu fordern. „Muzak“ nennt man diese „Klangtapeten“, benannt nach der in den 1930er Jahren gegründeten amerikanischen Firma Muzak Holdings, die Geschäfte, Büros und andere Einrichtungen mit Gebrauchsmusik, auch „funktionale Musik“ genannt, versorgte, ursprünglich über Telefonkabel.
An lauen Sommerabenden zieht es das Volk in die Biergärten. Mit lautstarker Musik und dem Lärm zechender Menschen in Gastwirtschaften müssen sich dann mit schöner Regelmäßigkeit die städtischen Ordnungsämter befassen. Dabei geht es nicht nur um die Musik und die Stimmen, die Anwohner nachts nicht schlafen lassen, sondern auch um den „Kollateral“-Lärm des Zuschlagens von Autotüren und anfahrender Autos. Genehmigungen zur Ausweitung des Gastbetriebs in die Nachtstunden hinein werden oft mit dem Argument erteilt, dass der Gaststättenbetrieb in Vergnügungsstraßen und vor allem der Biergartenausschank ein Teil der Kultur und Tradition sei – auch wenn moderner Biergarten-„Betrieb“ kaum noch etwas mit traditioneller Biergarten-„Kultur“ gemein hat.