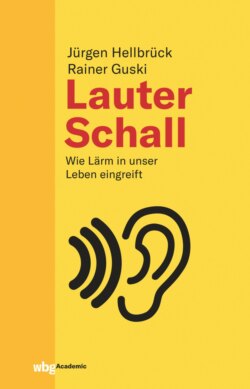Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 17
Ein neuer Klang macht sich breit
ОглавлениеMitten hindurch der Maschinen Geächz
und der Lokomotiven
geht im betäubenden Lärm einsam der sinnende Geist …
(Friedrich RÜCKERT; zitiert nach BARBEY & DAIBER, 2014)
Alles begann mit Metall. Ohne Metall gäbe es keine industrielle Entwicklung. Und es begann vor 5000 Jahren, als mit einer Legierung aus Kupfer und Zinn ein hartes, gebrauchstüchtiges Metall, nämlich Bronze, aufkam und mit ihm ein neuer Klang, der zuvor noch nicht gehört wurde. Wenn Metall an Metall schlägt, Eisen an Eisen reibt, sich in Holz frisst oder Steine zertrümmert, entstehen Geräusche, die an Intensität und Qualität bis dahin unbekannt waren. Weiter war es die maschinelle Entwicklung, die neue Geräusche entstehen ließ, da die von Maschinen freigesetzten Kräfte Geschwindigkeiten, Rotationen, Drücke und Stöße ermöglichten, die zuvor undenkbar erschienen. Mit diesen maschinell erzeugten Bewegungen gingen Geräusche, Klänge und Töne einher, die diese Überlegenheit, Macht und Gewalt reflektierten. Das erste Knattern benzinbetriebener Autos, das Zischen des ausströmenden Dampfes, die unterschiedlichen Signalhörner, Hupen und Klingeln waren achtungsgebietend und in dieser Art und diesem Ausmaß zuvor unbekannt gewesen.
Am Anfang war die Wasserkraft, gewonnen mit Hilfe von Wasserrädern, die durch fließendes Wasser angetrieben wurden. Sie war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine wichtige Energiequelle, vor allem für den Antrieb von Getreidemühlen oder Hammerwerken. Das „Klappern der Mühle am rauschenden Bach“ steht jedoch eher für Idylle und war in der dünn besiedelten ländlichen Umgebung kein allgemeines Lärmproblem, über das viele Menschen geklagt hätten. Wir nehmen darin eher ein von Naturkräften bewirktes Geräusch wahr, auch wenn es durch geschickte Eingriffe des Menschen in natürliche Prozesse hervorgerufen wird. Ob allerdings auch die Müller das ständige Rauschen und Klappern als Idylle empfunden haben, mag bezweifelt werden. Wenn einem das Rauschen des Baches aufgenötigt wird, man es nicht abstellen kann, vermag auch die Natur zur Quelle der Belästigung werden. SENECA berichtete gar in seinen Briefen an LUCILIUS, dass „ein gewisses Volk seine Stadt einst aus keiner anderen Ursache verlegte, als weil es das Tosen des Wasserfalls des Nils nicht ertragen konnte“ (Epistulae morales 56).
Das moderne Lärmproblem nahm seinen Anfang mit der durch die Dampfmaschine freigesetzten Kräfte und der dadurch eingeleiteten ersten industriellen Revolution. Es begann mit der Erfindung der Kolbendampfpumpe durch Thomas NEWCOMEN im Jahr 1712, der knapp 60 Jahre später die Dampfmaschine von James WATT folgte. Die Dampfmaschine ermöglichte die Konzentration großer Energie an einem Ort und damit die Gründung von Fabriken. Diese waren nicht wie die Wasserkraft auf das Vorhandensein natürlicher Energiequellen angewiesen, sondern konnten dort gegründet werden, wo beispielsweise das zu verarbeitende Rohmaterial vorhanden war. An den Kohle- und Erzlagerstätten im Ruhrgebiet, Saarland und Lothringen erlebte die Schwerindustrie – also Bergbau, Eisenverhüttung und Stahlindustrie – eine fulminante Entwicklung, die in Deutschland über etwa 100 Jahre andauerte, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
In der „Gründerzeit“ nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 entstanden in Deutschland viele Fabriken. Ausschlaggebend war der weltweite, gigantische Bedarf der Eisenbahnen, des Schiffbaus und natürlich auch der Rüstungsindustrie an Eisen und Stahl. So entstanden riesige Eisenhüttenwerke, Stahlschmieden, Hammerwerke und Maschinenbau-Fabriken, in denen Tausende von Menschen teils unter unmenschlichen Bedingungen arbeiteten. Dabei war neben der Hitze, der giftigen Gase und der allgemein großen Verletzungsgefahr vor allem der Lärm ein hohes Gesundheitsrisiko. Lärmschwerhörig wurde nahezu jeder, der über Jahre in einem Eisenhüttenwerk arbeitete. „Kesselschmiedkrankheit“ wurde die Lärmschwerhörigkeit genannt.
Das Zeitalter der ersten Industrialisierung zeichnete sich durch einen von Optimismus und Fortschrittsglauben geprägten Zeitgeist aus. Die Betriebsamkeit der Großstadt und der damit verbundene Lärm waren Ausdruck dieses Fortschrittsdenkens. Nur die sensibleren Gemüter litten unter der Rastlosigkeit, dem Gestank und dem Lärm und beklagten ein zu Ende gehendes Jahrhundert frei von Hektik und Betriebsamkeit und den Verfall der Kultur (Fin de Siècle).
Für die überreizten und nervösen Menschen fand sich bald eine Krankheit, nämlich Neurasthenie, also Nervenschwäche. Lärmempfindlichkeit galt als ein herausragendes Merkmal dieser heute als Modekrankheit entlarvten Befindlichkeit des Bildungsbürgertums.
Marcel PROUST (1871–1922), der hypersensible französische Schriftsteller auf der Suche nach den Erinnerungen an seine Kindheit, soll sein Schreibzimmer – eine „Schallschutzkammer des Geistes“ (Florian ILLIES, 2012) – nicht nur mit schweren Vorhängen verdunkelt, sondern die Wände auch mit schalldämmendem Kork ausgekleidet haben. Der überkultivierte Feingeist Hugo von HOFMANNSTHAL (1874–1929), österreichischer Schriftsteller des Fin de Siècle, hat das Bauernhaus, das er im ländlichen Altaussee im Salzkammergut erstanden hat, sofort mit Doppeltüren abschotten lassen. Dennoch soll er wegen des Kuhglockengeläuts ausgerastet sein und wütend Geschirr an der Wand zerschmettert haben (PAYER, 2014). Auch die damals so beliebte „Sommerfrische“ brachte dem von stickiger Großstadtluft und Großstadtlärm Geplagten offensichtlich keine ungetrübte Erholung.
Die „Macher“ in Industrie und Technik hatten für diese in ihren Augen blassen und schwachen, rückwärtsgewandten Mitmenschen nur Hohn und Verachtung übrig. „Raste nie und haste nie, sonst haste die Neurasthenie“ spottete man, wie Florian ILLIES in seinem Buch „1913: Der Sommer des Jahrhunderts“ ausführt. Auch die Elektrifizierung, die übrigens vielfach als (Mit-)Ursache für die Entstehung der Neurasthenie galt, trug ab den 1880er Jahren zur industriellen Revolution bei. Während die Dampfmaschine die Energie an einem Ort bündelte, wurde durch die Elektrifizierung die Energie über weite Strecken verteilt. Dies führte wiederum zu einer Aufwertung der Handwerksbetriebe gegenüber den Fabriken, da praktisch überall Energie für das Betreiben von Maschinen verfügbar war. Der Lärm der Maschinen war damit auch in den Werkstätten der Schreinereien und anderer Betriebe angelangt.
Dampfmaschine und Elektrizität haben die Mechanisierung der Arbeit und die Produktionsleistung vehement vorangetrieben. Mechanisierung bedeutet keine Befreiung des Menschen von der Arbeit, sondern eine Unterstützung der Arbeit durch Kräfte, zu denen der Mensch allein nicht fähig ist. Der Mensch ist immer noch in den Arbeitsprozess eingebunden, nun aber auch vermehrt den schädlichen „Nebenprodukten“ dieser Produktionsprozesse, wie Hitze, giftigen Gasen und eben auch Lärm, ausgesetzt. Die Mechanisierung diente der Verbesserung von Produkten und der Steigerung der Produktion, schadete jedoch in weiten Bereichen der physischen und psychischen Gesundheit des Menschen. Der Lärm in Schmiedehammerwerken und an den mechanischen Webstühlen der Textilindustrie war unerträglich und der Gehörschutz gering oder wurde gering geachtet. So wurde Lärmschwerhörigkeit zu einem der hauptsächlichen Gesundheitsprobleme. Dass Lärm als ein großes Problem erkannt wurde, zeigte sich auch in der Entwicklung und dem Verkaufserfolg kleiner mit Paraffinwachs und Vaseline getränkter Kugeln aus Baumwollwatte, die schmiegsam genug waren, um das Ohr dicht abzuschließen. Der Apotheker Maximilian NEGWER erfand diese Kügelchen und vertrieb sie ab 1907 unter dem Namen „Ohropax“ („Ohr-Frieden“), unter dem sie bis heute bekannt sind. Angeregt wurde er durch die Geschichte aus Homers Odyssee, in der Odysseus seinen Gefährten die Ohren mit Wachs verschloss, damit sie nicht dem lockenden Gesang der todbringenden Sirenen erliegen. Der damalige Werbespruch der Firma lautete: „Hast du Ohropax im Ohr, kommt dir Lärm wie Stille vor“. Der stets von Lärm geplagte und über Lärm lamentierende Franz KAFKA (DAIBER, 2015) war unter den ersten, die dieses Produkt orderten und ohne es nicht mehr leben wollten. Auch bei Industriearbeitern und bei den vom Kanonendonner zermürbten Soldaten des Ersten Weltkriegs fand Ohropax seine Anwendung. Heute produziert die Firma jährlich 30 Millionen Ohrstöpsel. Die Sehnsucht nach Stille scheint ungebrochen.