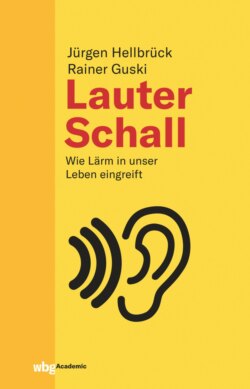Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 18
Die Arbeit und der Lärm
ОглавлениеDie Mechanisierung unterstützt den Menschen bei der Arbeit und belastet ihn gleichzeitig; Automatisierung allerdings nimmt dem Menschen mühselige und gesundheitsbelastende Arbeit ab. Bei der Automatisierung übernehmen Maschinen auch die Werkzeugführung bei der Herstellung von Produkten. Zwar gab es im 18. Jahrhundert bereits Vorläufer der Automatisierung wie den automatischen Webstuhl („Power Loom“), doch erst mit der Kybernetik, der Wissenschaft von Steuerungs- und Regelungsprozessen sowie den Entwicklungen in der Elektrotechnik, der Elektronik und der Transistoren mit immer kleineren Schaltkreisen bis hin zur Digitalisierung und den Computerwissenschaften begann allmählich der Siegeszug der Automatisierung von Produktionsprozessen und des Einsatzes von Industrierobotern. Die Automatisierung an Produktionsstätten deutete sich etwa ab den 1970er Jahren an. Heute sind Produktionsstraßen oft weitgehend menschenleer, während zu Henry FORDS Zeiten dort noch Hunderte von Menschen beschäftigt waren, die ebenfalls gleichsam wie Automaten immer die gleichen Handgriffe durchführten. Charly CHAPLINS Film „Modern Times“ demonstriert dies auf unterhaltsame und doch auch bedrückende Weise. Automaten und Roboter haben viele Vorteile. Sie sind genauer und zuverlässiger als Menschen, werden nicht müde, lassen sich nicht ablenken und werden nicht krank – und auch nicht lärmschwerhörig. Die Arbeit des Menschen dagegen verlagert sich zunehmend in Büroräume, in denen nicht mehr körperlich, sondern geistig gearbeitet wird. Dort herrscht kein Geräuschpegel, der eine Schwerhörigkeit zur Folge haben kann, der jedoch psychisch belasten kann. Warum? Um dies zu verstehen, müssen wir uns kurz einige Prinzipien und Unterscheidungsmerkmale für die menschliche Arbeit vor Augen führen. Dies wird uns auch ein weiteres Mal deutlich machen, dass das Lärmproblem kein reines Schallproblem ist, sondern auch ein Problem der sich wandelnden Welt und der sich mit ihr verändernden Menschen.
Wir unterscheiden nach dem Schwerpunkt der Tätigkeit körperliche und geistige Arbeit. Die Ergonomie, die Wissenschaft von der Arbeit, differenziert detaillierter. Zur ersteren, der körperlichen Arbeit, zählt die Aktivierung muskulärer Kräfte, etwa beim Heben und Tragen von Lasten oder beim Hacken und Schaufeln. Diese Arbeit belastet vor allem Muskeln, Sehnen, Skelett, Atmung und Kreislauf. Des Weiteren gehören hierzu sensumotorische Tätigkeiten, bei denen es nicht auf Muskelkraft, aber auf Präzision der Ausführung und auf die Koordination von Sinnesapparat und Motorik ankommt. Unter geistiger Arbeit verstehen wir heute die Verarbeitung und Erzeugung von Informationen. Dabei unterscheidet man das einfache Registrieren und Reagieren auf Informationen, wie etwa bei reinen Kontroll- und Überwachungstätigkeiten; ferner das Zusammenfügen und Vergleichen von Informationen, also die Aufnahme von Informationen von außen und deren Kombination mit im Gedächtnis gespeicherten Informationen, z.B. bei Telefongesprächen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Call-Centers mit Kunden; außerdem das kreative Erzeugen neuer Informationen, etwa bei schriftstellerischen Arbeiten oder beim Lösen von Problemen, für die es keinen fertigen Lösungsalgorithmus gibt. Mit diesen unterschiedlichen Tätigkeiten sind auch unterschiedliche kognitive Anforderungen verbunden. Bei reinen Überwachungstätigkeiten sind Wahrnehmungs-, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfunktionen, gegebenenfalls auch einfache motorische Leistungen gefragt. Beim Kombinieren von Informationen werden Sinnesleistungen und Gedächtnisfunktionen erforderlich und beim kreativen Lösen von Problemen sind in der Regel rein geistige (mentale) Funktionen nötig, aber auch innere Ruhe, damit sich Gedanken und Assoziationen entfalten können.
Während schwere körperliche Arbeit schon seit vielen Jahren immer weniger benötigt, durch Maschinen erleichtert und durch Roboter ersetzt wird, steigt der Bedarf an qualifizierter geistiger Arbeit, bei der Informationen verarbeitet und erzeugt werden. Dieser Bedarf wird weiter steigen und im Zuge der Entwicklung zur Industrie 4.0 neue Dimensionen annehmen, deren Ausmaß heute, da dieses Buch geschrieben wird, noch nicht richtig abgeschätzt werden kann. Feststehen dürfte jedoch, dass viele derjenigen Menschen, die im Zeitalter von Industrie 4.0 Arbeit haben, in Bereichen arbeiten werden, in denen kreative Problemlösungen angesagt sind. Für diese werden optimale Umgebungsbedingungen gefordert werden, darunter auch die Abwesenheit störender, ablenkender Geräusche (→ Kap. 5).
Wie ist die heutige Situation? In Deutschland arbeiten mittlerweile über 17 Millionen Menschen in Büros. Dabei handelt es sich in aller Regel um Mehrplatzbüros mit 5 bis 20 Arbeitsplätzen bis zu Großraumbüros mit weit über 100 Arbeitsplätzen. Großraumbüros weisen für den Arbeitgeber Vorteile auf, wie Flexibilität bei der Gestaltung und Aufteilung des Raumes. Die wichtigste und auch teuerste Ressource ist jedoch der Mensch, seine Leistung und sein Wohlbefinden. Für die Mitarbeiter hat das Großraumbüro gravierende Nachteile. Zu den häufigsten Beschwerdegründen zählt der Hintergrundlärm. Dabei ist das kein Lärm, wie ihn die Arbeiter in der Schwerindustrie erlebt haben, der das Gehör schädigt. Es handelt sich vielmehr um das Reden, Telefonklingeln und sonstige bürotypischen Geräusche, die Gedanken unterbrechen, die Aufmerksamkeit ablenken, dadurch stärkere Konzentration einfordern und insgesamt die Beanspruchung, also den Stress, erhöhen.
Stress ist eines der Hauptübel der heutigen Zeit. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht ein erneuter Anstieg psychischer Leiden wie Burn-out und Depressionen aufgrund von erhöhtem Stress bei der Arbeit konstatiert wird. Nicht nur die Arbeitsbedingungen erzeugen zunehmend Stress, auch die Vereinbarkeit des Berufs mit dem Familienleben und die gefühlte Notwendigkeit, gesellschaftlichen Leistungsansprüchen zu genügen, beanspruchen den Einzelnen. So wie Neurasthenie die Krankheit des 19. Jahrhunderts war, ist Stress und „Ausgebranntsein“ das große gesundheitliche Thema unserer Zeit. Und so wie Neurasthenie in der Rückschau als Modekrankheit galt, wird die Zukunft darüber urteilen, ob Burn-out eine Diagnose à la mode ist. Unabhängig davon jedoch steht fest, dass sich die Arbeitswelt drastisch geändert hat, muskuläre Beanspruchungen abgenommen und psychische Belastungen deutlich zugenommen haben.
So ist es kein Wunder, wenn bei dieser fiebrigen Anspannung auch das leise Piepsen, Summen und Vibrieren von Smartphones zu „Lärm“ werden können, ein Lärm, dessen wir uns eigentlich gar nicht als Lärm bewusst werden. Dennoch ist es im Sinne der Wortbedeutung „Lärm“, denn es sind Signale, dazu gemacht, uns zu „alarmieren“, Gespräche und Nachrichten anzukündigen, an Termine und Aufgaben zu erinnern. Signale, die uns unter Spannung halten und nicht zur Ruhe kommen lassen.