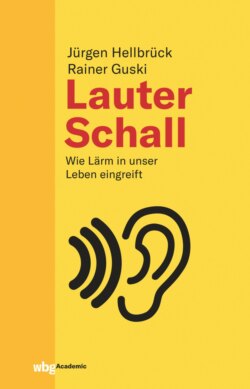Читать книгу Lauter Schall - Jürgen Hellbrück - Страница 19
„Lärmkloake“ Verkehr
ОглавлениеAm 28. August 2016 ging ein bemerkenswertes Experiment zu Ende. Ein ganzes Jahr verbrachten sechs Wissenschaftler, drei Frauen und drei Männer, isoliert von der übrigen Welt in einer Kuppel auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii, um das Leben in einer Umgebung zu erproben, die einem möglichen zukünftigen Leben auf dem Mars ähnelt. Unter den sechs Forschern war auch die deutsche Wissenschaftlerin Christiane HEINICKE. Als sie die extraterrestrischen Bedingungen verlassen und die „Erde wieder betreten hatte“, wurde ihr in den Interviews unter anderem die Frage gestellt, was sie während dieses langen Aufenthaltes nicht vermisst habe. An erster Stelle nannte sie den „Verkehrslärm“ (BAYERISCHER RUNDFUNK, 2016).
Dieser spontanen Einzelaussage kommt natürlich keine wissenschaftliche Bedeutung zu, doch gibt sie paradigmatisch das Unbehagen vieler Menschen wieder, die den Verkehrslärm für eine der übelsten Erscheinungen der modernen Welt halten. Aber ist Verkehrslärm wirklich ein Phänomen der Moderne? Nein! Julius CÄSAR hatte veranlasst, dass die Ochsenkarren, die Rom mit Lebensmitteln versorgten, nur noch nachts durch die Straßen Roms fahren durften, da tagsüber die Straßen so voll waren, dass sie zu einer Gefahr für Leib und Leben der Passanten wurden. Die Folge war ein enormer Krach in der Nacht, zu dem auch das Geschrei der Knechte beitrug, die das Schlachtvieh durch die engen Gassen trieben. Laut dem römischen Satiredichter JUVENAL (um 100 n. Chr.) litten viele Einwohner Roms an Schlaflosigkeit. Manche habe der nächtliche Lärm so krank gemacht, dass sie sogar daran gestorben seien (NEUMEISTER, 2010). Ironie der Geschichte: Auch in Deutschland werden heute auf der Schiene Güter vorwiegend nachts transportiert, da tagsüber das Schienennetz in erster Linie für den Personenverkehr reserviert ist – Deutschland verfügt über kein getrenntes Schienennetz für Personen- und Gütertransport. Nächtlicher Schienenverkehrslärm wird nach neueren Forschungserkenntnissen tatsächlich auch heute als ein großes Gesundheitsrisiko erachtet. Das Getrappel von eisenbeschlagenen Pferdehufen, das Poltern von Leiterwagenrädern mit Eisenreifen über Kopfsteinpflaster, das Quietschen der Deichseln und das Peitschenknallen und Schreien der Fuhrknechte bestimmten die Geräusche der Stadt des 19. Jahrhunderts. Richtig unangenehm laut wurde es jedoch mit dem „Wimmergeheul“ und dem Kurvenquietschen der elektrischen Straßenbahnen, dem Knattern und Hupen der Automobile und dem Klingeln von Fahrrädern. So beschreibt Peter PAYER (2007) am Beispiel Wiens die „Klanglandschaften“ der damaligen Großstädte.
Der Lärm war ursprünglich ein Problem der Großstadt. Menschen, die in Handwerksbetrieben gewerkelt hatten, sammelten sich im 19. Jahrhundert als Industriearbeiter in den Städten, deren Einwohnerzahl schnell anwuchs. Ende des 18. Jahrhunderts zählte Berlin 170.000 Einwohner; 1871, als Berlin Hauptstadt des neu gegründeten Deutschen Reiches wurde, verzeichnete man bereits über 800.000 Einwohner, zehn Jahre später wurde die Million überschritten und 1914, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, war die Einwohnerzahl auf knapp zwei Millionen angewachsen. Am Potsdamer Platz, 1913 der lauteste Platz Europas, saß tagtäglich der Maler Ernst Ludwig KIRCHNER und dokumentierte mit steilen Pinselstrichen die Hektik und den Lärm der Großstadt auf Leinwand und Papier (ILLIES, 2012).
In den Großstädten wurden Massentransportmittel benötigt, um die Vielzahl der Menschen, denen immer weniger Zeit zur Verfügung stand, auf ihrem Weg zur Arbeit zu befördern. Zunächst machten sich Pferdeomnibus und Pferdetrambahn mit Schellen bemerkbar. Von Pferden gezogene Beförderungsmittel stießen jedoch bald an ihre Kapazitätsgrenzen. Sie wurden durch Wagen mit Elektromotoren oder Verbrennungsmotoren abgelöst.
Der Verkehr emanzipierte sich vom Reitpferd und der Pferdedroschke ab der Zeit, als Karl Friedrich DRAIS Anfang des 19. Jahrhunderts eine Frühform des Fahrrads erfand. Ausgehend von der „Draisine“ wurde 1880 von Gottlieb DAIMLER und Wilhelm MAYBACH das erste Motorrad, damals „Reitwagen“ genannt, entwickelt und letztlich dann 1885 das benzinbetriebene Automobil durch Carl BENZ.
Das Transportwesen wandelte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts grundlegend. Wurden früher Personen und Güter mit Pferde- und Ochsengespannen oder im Fernverkehr mit Treidelkähnen über Flüsse und mit Segelschiffen über die Ozeane transportiert, steigerten Dampfturbine und Verbrennungsmotor die Effizienz des Transportwesens enorm. Die Eisenbahn wurde weltweit so bedeutend, dass sie einer ganzen Epoche den Namen „Eisenbahnzeitalter“ verlieh. Und es war das „Feuerross“, das den Lärm schnaubend und fauchend in die ländlichen Regionen und in die Natur brachte.
Die mit der Industrialisierung verknüpfte höhere Warenproduktion benötigte eine effizientere Infrastruktur für die Handelswege, die mit Pferdefuhrwerken allein nicht zu bewältigen war. Die Städte wurden über die Eisenbahn miteinander verbunden. Nach der Entwicklung erster betriebstauglicher Lokomotiven nahmen in Deutschland bereits in den 1830er Jahren der öffentliche Personenverkehr und auch der Güterverkehr auf Schienen Fahrt auf. Erste Fernstrecken entstanden ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und heute? Im Jahr 2017 beförderte die Deutsche Bahn täglich 7 Millionen Passagiere (DEUTSCHE BAHN AG, 2018).
DAIMLERS „Reitwagen“ und die ersten „Patent-Motorwagen“ von BENZ liefen noch auf eisenbeschlagenen Rädern über Kopfsteinpflaster. Aber 1888 stellten John Boyd DUNLOP und zwei Jahre später die Gebrüder MICHELIN pneumatische Gummireifen vor, die außerdem immer öfter auf glattem Asphalt rollten. Dieser fand ab Mitte des 19. Jahrhunderts im Straßenbau Verwendung, zunächst in Paris, dann auch in Berlin. Gummireifen und Asphalt reduzierten deutlich das Rollgeräusch und wurden von Ärzten und Hygienikern als „nervenhygienische Notwendigkeit“ gefordert (PAYER, 2014). Allerdings ermöglichen Gummireifen und Asphalt auch höhere Geschwindigkeiten und damit auch mehr Lärm.
Heute ist eines der großen Probleme der Fluglärm. Die Geschichte der Luftfahrt beginnt mit den ersten Motorflügen der Brüder WRIGHT 1903 in Kitty Hawk, einer kleinen Stadt an der Küste von North Carolina. Für die weitere Entwicklung der Luftfahrttechnik waren die Etablierung der Luftpost in Deutschland ab 1912 und der Erste Weltkrieg, der den technischen Fortschritt erheblich forcierte, von Bedeutung. Hugo JUNKERS, ein begnadeter Ingenieur, der zunächst Gasthermen und Heizlüfter entwickelte und produzierte, konstruierte 1915 das erste Ganzmetallflugzeug. Er gründete auch eine Luftfahrtgesellschaft, die 1926 zusammen mit der „Deutschen Aero Lloyd“ zur „Deutschen Luft Hansa“ fusionierte. Der Zweite Weltkrieg gab der Luftfahrttechnik einen weiteren technischen Entwicklungsschub. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Ära der Passagierflüge und des Luftfahrttourismus. Ab Mitte der 1960er Jahre gab es die ersten Charterflüge – und auch die neuen Düsenjets, deren kreischende Geräusche den Lärmpegel der sonor klingenden Propellermaschinen um ein Vielfaches übertrafen.
Der Luftverkehr wuchs bis heute beträchtlich an. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) kontrollierte in Deutschland im Jahr 2016 über 3,1 Millionen Flüge (DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH, 2017). Für die Menschen, die im Nahbereich der großen Flughäfen leben, stellt der Fluglärm eine extreme Einschränkung ihrer Lebensqualität und eine gesundheitliche Belastung dar (→ Kap. 8).
Auf Flugrouten, Autobahnen und Schienentrassen hielt der Lärm nach dem Krieg, in der Zeit des Wiederaufbaus in Deutschland, Einzug in die unmittelbaren Wohngebiete – in der Regel ohne Absprache mit den Bürgern. Wen scherte in der allgemeinen Euphorie das Ruhebedürfnis der Bevölkerung? „Autogerecht“ sollten die Städte werden, bequemer die Einkaufswege und immer kürzer die Distanzen zwischen den Kontinenten – Überschallflugzeuge wurden in der zivilen Luftfahrt eingesetzt. Lautstark war die „Begleitmusik“ von Wirtschaftskraft und Fortschritt. Und die „Wirtschaftswunderkinder“ von damals ahnten wahrscheinlich nicht, was da auf sie zukommen sollte, und dass „Otto Normalverbraucher“ eines Tages zum „Wutbürger“ mutieren würde.
Verkehrslärm wurde zu einem selbstverständlichen Teil der wahrgenommenen Umwelt. Wie ein Teppich liegt er heute über Stadt und Land. Waren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Lärmquellen noch einzelne Ereignisse, gewiss ärgerlich und nervtötend, wie beispielsweise die peitschenknallenden Fuhrknechte, über die SCHOPENHAUER schimpfte (→ Kap. 5), aber doch erkennbar und konturiert und von ruhigen Phasen unterbrochen, so breitet sich heute mit der zunehmenden Mobilität ein diffuses Gemisch von Geräuschen aus. Es schiebt sich wie eine schmutzige Flut zwischen alle Laute. In einer „Lärmkloake“ weiß sich der Journalist und Rundfunkautor Helmut KOPETZKY (geb. 1940). Wer Klänge, Naturlaute sammeln und konservieren will, so der „Ohrenmensch“ KOPETZKY, muss sie „ausgraben“ und „freilegen“, von akustischem Müll befreien. Und der Verkehr produziert den schlimmsten. Er breitet sich bis in den hintersten Wald aus. „Ein Klangbrei aus vorwiegend niederen Frequenzen, der alles überlagert und verschluckt, grundiert unsere Umwelt. Die meisten der natürlichen Geräusche, also Lebensäußerungen, sind in einem Sud aus Lärm verschwunden“ (KOPETZKY, 2013).