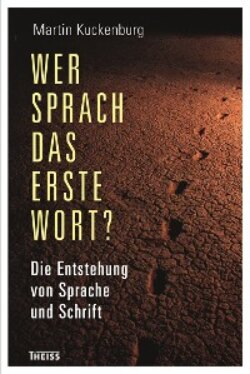Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 10
„IM ANFANG WAR DAS WORT“
ОглавлениеAm stärksten wurde unser Kulturkreis natürlich durch den biblischen Schöpfungsmythos geprägt. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“, heißt es zu Beginn des Johannes-Evangeliums. „Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist“. Die Genesis schildert im Einzelnen, wie Gott die Welt und alle Dinge durch sein Wort erschuf und sie benannte. „Und Gott sprach: Es werde Licht! Und so ward Licht. (…) Und Gott … nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.“ Bei der Erschaffung Adams – des ersten Menschen – „zu seinem Bilde“ gab Gott ihm auch die Sprache: Er führte Adam „alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel“ vor, „dass er sähe, wie er sie nannte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden … seinen Namen“ – so die Genesis. Gott aber blieb der Herr über die Dinge und damit auch über das Wort: Als Adams und Evas Nachkommen, die zu Anfang auf der ganzen Welt „einerlei Zunge und Sprache“ geredet hatten, den Turm zu Babel erbauten, „verwirrte“ Gott als Strafe für diese Anmaßung ihre Sprache, so dass sie einander nicht mehr verstehen konnten, und „zerstreute“ sie „in alle Länder“. Damit begann die Sprachen- und Völkervielfalt.5
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“. Holzstich zur Schöpfungsgeschichte von Gustave Doré (1832–83).
Die biblische Überlieferung steckte auch den Rahmen ab, in dem sich die Sprachphilosophie des christlichen Abendlandes bis zur Zeit der Aufklärung überwiegend bewegte. Zwar gab es vereinzelt Häretiker, unabhängige Geister und Querdenker, die einen natürlichen oder menschlichen Sprachursprung erwogen (unter ihnen Thomas von Aquin), insgesamt aber standen die Erörterungen des christlichen Mittelalters ganz im Zeichen der göttlichen Offenbarungslehre und der biblischen Exegese. Diskutiert wurde über Einzelheiten, die die Bibel offen ließ – etwa, ob Gott den Menschen nur mit einer allgemeinen Sprachfähigkeit oder aber mit einer konkreten Sprache ausgestattet hatte und ob dies tatsächlich das Hebräische war, wie man traditionsgemäß annahm. Die göttliche Herkunft der Sprache als solche wurde aber nicht in Zweifel gezogen, so dass auch kaum jemand über alternative Möglichkeiten nachdachte. Die christlichen Dogmen hemmten hier, wie auf vielen anderen Gebieten, die Neugier, den Forschungsdrang und die schöpferische Phantasie der mittelalterlichen Denker und Gelehrten.
Die kreative Phantasie wurde dagegen freigesetzt, wo kritische, vernunftgemäße Betrachtung der Dinge die Oberhand über religiöse Dogmen gewann. Dies geschah erstmals in der antiken Philosophie, und so entwickelte sich schon hier eine jahrhundertelange, kontroverse und fruchtbare Diskussion über sprachphilosophische Fragen. Zwar galt auch im alten Griechenland der Überlieferung nach ein Gott, nämlich Hermes, als der Bringer der Sprache, doch schon unter den klassischen Philosophen des 4. Jahrhunderts v. Chr. war von diesem göttlichen Ursprung kaum mehr die Rede. Statt dessen entbrannte ein heftiger Streit (wiedergegeben in Platons Dialog Kratylos) über die Frage, ob die Wörter und Begriffe der Sprache ihre Geltung physei hätten, das heißt mit Naturnotwendigkeit aus dem Wesen der Dinge selbst resultierten, oder ob sie thesei, also durch menschliche Übereinkunft gesetzt seien.
Die hellenistischen Philosophenschulen der Epikureer und der Stoiker verfochten dann mit Nachdruck die Lehre einer Sprachentstehung aus der Natur bzw. aus dem menschlichen Wesen, und die Legende vom Sprachbringer Hermes war für die Epikureer nurmehr „unnützes Gerede“. Der in ihrer Tradition stehende römische Dichter Lukrez schrieb im 1. Jahrhundert v. Chr. in seinem Lehrgedicht De rerum natura, dass „der Zwang der Natur verschiedene Laute der Sprache bildete und das Bedürfnis die Namen der Dinge hervorrief“, so dass es „Wahnsinn“ sei, „an einen Erfinder zu glauben, der einst Namen den Dingen verliehn und die Menschen die ersten Wörter gelehrt“.6
Diodor von Sizilien schließlich, der ebenfalls im 1. Jahrhundert v. Chr. lebte, gab in seiner „Bibliothek der Geschichte“ zeitgenössische Auffassungen wieder, die man bereits als eine regelrechte Entwicklungstheorie der Sprache bezeichnen kann. „Die Menschen, die im Anfang entstanden waren“, so schrieb er, „hatten eine ungeregelte, tierische Lebensweise. (…) Ihre Stimme war ein Gemisch von undeutlichen Tönen, die aber allmählich in artikulierte Laute übergingen, und indem sie sich über bestimmte Zeichen für jeden Gegenstand einigten, fanden sie ein Mittel, sich gegenseitig über alles verständlich auszudrücken. Weil solche Gesellschaften überall auf der Erde zerstreut waren, hatten sie nicht alle eine gleichlautende Sprache; denn jede derselben setzte, wie es der Zufall gab, die Laute zusammen. Daher entstanden die vielerlei Arten von Sprachen, und jene ersten Gesellschaften machten die Urstämme aller Völker aus.“7