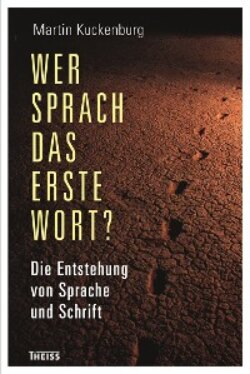Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 12
SPEKULATIVE UND WISSENSCHAFTLICHE SPRACHURSPRUNGSHYPOTHESEN
ОглавлениеDie von Herder hier vertretene „Nachahmungstheorie“, die den Ursprung der Sprache in der Nachempfindung von Naturlauten (griech. onomatopöie) sah und daher später spöttisch auch als Wau-Wau- oder Mäh-Mäh-Hypothese bezeichnet wurde, war nur eines von mehreren im 18. Jahrhundert gängigen Erklärungsmodellen der Sprachentstehung. Daneben gab es die bei Herder gleichfalls anklingende „Interjektionstheorie“, die eine Entstehung der ersten Wörter aus emotionalen Ausrufen der Freude, der Angst, des Schmerzes, der Lust usw. annahm und deshalb von Spöttern Puh-Puh- oder Aua-Aua-Hypothese genannt wurde. Zahlreiche Anhänger hatte auch die sog. „Gestentheorie“, der zufolge die früheste menschliche Verständigung überhaupt nicht aus Lauten, sondern aus stummen Handzeichen und Gebärden bestand. Diese drei „klassischen“ Theorien tauchten in der an Ideen und Positionen reichen Sprachursprungsdebatte des 18. Jahrhunderts immer wieder in den unterschiedlichsten Kombinationen und Variationen auf.
Allen diesen Erklärungsmodellen war gemeinsam, dass sie sich mehr auf allgemeine philosophische Erwägungen stützten als auf konkretes Tatsachenmaterial, das damals noch kaum verfügbar war. Dies begann sich im 19. Jahrhundert allmählich zu ändern: War die Beschäftigung mit der Sprachentstehung – der Glottogenese – bis dahin fast ausschließlich eine Domäne universal gebildeter Philosophen, Gelehrter und Literaten gewesen, so nahmen sich nun verschiedene wissenschaftliche Spezialdisziplinen einzelner Teilaspekte des Problems an und versuchten, auf dem Wege empirischer Forschungen einer Lösung näher zu kommen.
Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts begründete historisch-vergleichende Sprachwissenschaft bemühte sich, durch die Analyse von Aufbau und Wortschatz die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den verschiedenen modernen und historisch überlieferten Sprachen auf der Welt zu klären. Sie identifizierte auf diese Weise eine ganze Reihe unterschiedlicher „Sprachfamilien“ und versuchte bei einigen von ihnen, die den Einzelsprachen ursprünglich zugrunde liegende gemeinsame „Stammsprache“ zu rekonstruieren (vgl. S. 21–23). Darüber hinaus hofften viele Linguisten des 19. Jahrhunderts aber, noch weiter ins Dunkel der Vergangenheit – in Richtung auf die gemeinsame Ursprache der Menschheit – vordringen zu können. „Die Sprachwissenschaft“, schwärmte 1866 etwa der in Oxford lehrende Professor Max Müller, „führt uns so zu jenem höchsten Gipfelpunkt empor, von dem wir in das erste Frührot des Menschenlebens auf Erden hinabblicken und wo die Worte ‚Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache‘ eine natürlichere, verständlichere, überzeugendere Bedeutung annehmen, als sie je zuvor besaßen.“11
Solche hochfliegenden Erwartungen wichen jedoch bald der Ernüchterung. Je größer die Fortschritte bei der Erforschung konkreter Sprachfamilien wie der „indoeuropäischen“ waren, desto deutlicher wurde, dass ihre „Stammsprachen“ vor höchstens 6000 oder 8000 Jahren existiert haben konnten und nichts mit der vermuteten „Ursprache der Menschheit“ zu tun hatten (vgl. S. 23–25). Der Versuch, mit vergleichenden Analysen noch weiter in die Vergangenheit vorzustoßen, scheiterte völlig, und um die Jahrhundertwende stellte der Sprachforscher Berthold Delbrück desillusioniert fest: „Ob es eine Ursprache des Menschengeschlechts gegeben hat, wissen wir nicht; das aber wissen wir sicher, dass wir sie durch Vergleichung nicht wiederherstellen können.“12 Dieses Urteil wird bis heute von den meisten Sprachwissenschaftlern geteilt, und neuere Versuche einer Minderheit unter ihnen, der postulierten Ursprache doch noch auf die Spur zu kommen (vgl. S. 89–92), werden überwiegend mit Skepsis und Ablehnung betrachtet.
Ebenso zerschlug sich die nicht zuletzt aus ethnozentrischen Vorurteilen gespeiste Hoffnung, man könne unter den sog. „wilden“ Völkern vielleicht Relikte einer primitiven, älteren Stufe der Sprachentwicklung finden und so die Erforschung urtümlicher Verständigungsweisen gleichsam „am lebenden Objekt“ vornehmen. Dieser Forschungsansatz war, wie eine Reihe von völkerkundlichen und linguistischen Studien zeigte, schon von seinen Voraussetzungen her verfehlt, denn die Sprachen der überlebenden „Naturvölker“ erwiesen sich in ihrer Grundstruktur als ebenso hoch entwickelt wie diejenigen der sog. zivilisierten Welt und waren also keineswegs urtümliche Überbleibsel. „Was die linguistische Form anbelangt, geht Plato Seite an Seite mit dem mazedonischen Schweinehirten, Konfuzius mit dem Kopfjäger von Assam“, fasste der amerikanische Linguist Edward Sapir diese Einsicht 1921 zusammen.13 Insgesamt trugen die genannten Studien daher viel zur Entwicklung der Sprachwissenschaft als Disziplin bei, erbrachten im Hinblick auf das Problem der Sprachentstehung aber eher enttäuschende Ergebnisse.
Neue Hoffnungen wurden dagegen von naturwissenschaftlicher Seite geweckt. Zwei medizinische Teildisziplinen, die Anatomie und die Neurologie, befassten sich eingehend mit den Sprachorganen und dem Gehirn des Menschen, um ihre Funktionsweise und ihr Zusammenwirken beim Sprechen zu ergründen. Dies schien die Möglichkeit zu eröffnen, durch einen Vergleich mit den entsprechenden Organen der Tiere – und später mit fossilen Frühmenschenfunden – Hinweise auf die Entwicklungsgeschichte der anatomischen Sprachgrundlagen, sozusagen auf die Phylogenese (Stammesgeschichte) der Sprachfähigkeit, zu gewinnen. Und dass es eine solche Phylogenese gegeben haben musste, war ein nahezu unvermeidlicher Schluss aus der 1859 von Charles Darwin veröffentlichten biologischen Evolutionstheorie, deren rascher Siegeszug die Forschung dazu zwang (und zugleich dazu befähigte), über die Entwicklung aller Erscheinungen in der Natur – auch der Kommunikation und der Sprache – von niederen zu höheren Formen nachzudenken.
Dieser naturwissenschaftliche Zugang zum Sprachursprungsproblem sollte sich als äußerst zukunftsträchtig erweisen. Man beginnt die in ihm steckenden Möglichkeiten erst heute richtig auszuschöpfen, wie wir an anderer Stelle noch genauer sehen werden (vgl. S. 56ff.).