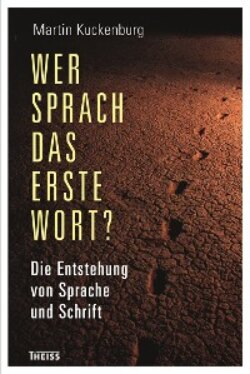Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 18
REINE REFLEXLAUTE?
ОглавлениеDer Streit um die Sprachfähigkeit der Tiere, den dieser kurze Blick in die Forschungsgeschichte hat deutlich werden lassen, dauert im Prinzip bis heute an. Auch in der modernen Kommunikationsforschung stehen sich in dieser Frage zwei Lager gegenüber: Das eine sieht, ohne die prinzipielle Überlegenheit der menschlichen Sprache in Zweifel zu ziehen, Vorstufen, Ansätze und Elemente sprachlicher Verständigung bereits im Tierreich und hofft, durch ihre Erforschung Hinweise auf eine stufenweise Entwicklung unserer artikulierten Sprache aus solchen tierischen Anfängen gewinnen zu können (sog. „Kontinuitätstheorie“). Die Vertreter der anderen Forschungsrichtung lehnen die Vorstellung eines Entwicklungskontinuums und einer letztlich nur graduellen Abstufung dagegen strikt ab und bestreiten die Existenz jeglicher wirklich sprachlicher Elemente in der tierischen Kommunikation. Ihnen gilt die menschliche Sprache als ein völlig anders strukturiertes und einzigartiges System, das nicht auf irgendwelche Vorläufer im Tierreich zurückgeführt werden könne (sog. „Diskontinuitätstheorie“).
Bis in die 1960er Jahre hinein war die letztgenannte Denkrichtung weithin vorherrschend. Nach ihr beruhen fast alle Signale in der Tierwelt auf gleichsam automatisch ablaufenden Reiz-Reaktions-Mechanismen, deren Auslöser besondere emotionale Zustände wie Angst oder Lust sein können, aber auch äußere Faktoren wie die Annäherung natürlicher Feinde, und die Lautsignale als begleitenden Ausdruck einer entsprechenden Empfindungsreaktion auslösen. In jedem Fall erfolgt die Signalaussendung nach diesem Modell aus dem Gefühl heraus (= emotional) bzw. im Affekt (= affektiv) und ohne bewusste Kommunikationsabsicht (= nichtintentional). Als Beleg dafür werden etwa Beispiele von Tieren ins Feld geführt, die beim Anblick von Futter oder in Gefahrensituationen auch dann Freuden- oder Alarmlaute ausstoßen, wenn kein Artgenosse als Adressat und Kommunikationspartner in der Nähe ist. Gehirnuntersuchungen an Rhesusaffen schienen diese Sichtweise ebenfalls zu stützen: Sie ergaben, dass die Lautäußerungen dieser Tiere nicht vom Neocortex gesteuert werden – also von der Großhirnrinde, die die meisten intellektuellen Prozesse lenkt –, sondern vom sog. Limbischen System, das mehr für den Gefühls- und Instinktbereich zuständig ist. Dementsprechend gingen die Anhänger dieser Schule auch zumeist davon aus, dass die Kommunikationssignale der Tiere zum angeborenen Instinktverhalten gehören und nicht von ihnen erlernt zu werden brauchen, sondern vollständig genetisch verankert sind.
Feldheuschrecken erzeugen charakteristische Gesangsmuster, indem sie eine „Feile“ an der Innenseite ihrer Hinterbeine gegen die „Schrilladern“ der Vorderflügel reiben.
(Oben: Oszillogramme der Beinbewegung, unten: Oszillogramm des „Gesangs“.)