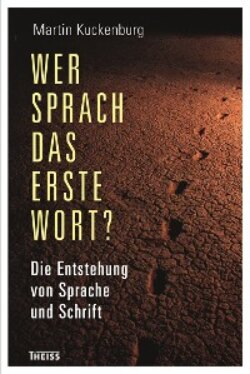Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 19
KOMPLEXE TIERKOMMUNIKATION
ОглавлениеDas in den letzten Jahrzehnten von der Zoosemiotik zusammengetragene Material hat indessen gezeigt, dass das beschriebene Modell die tatsächlichen Sachverhalte unverhältnismäßig vergröbert und dass viele tierische Kommunikationssignale auf sehr viel komplexeren Vorgängen und Wirkungsmechanismen beruhen. So vermögen diese Signale den Artgenossen beispielsweise nicht nur wichtige Informationen über Gefühlszustände wie Paarungsbereitschaft, Hunger oder Aggressivität zu vermitteln (sog. Empfindungs- und Motivationsübermittlung), sondern auch Hinweise auf äußere Faktoren wie Bedrohungen, Futterquellen und anderes mehr (sog. Umweltinformation). Und diese Informationen werden zum Teil in sehr viel präziserer Form gegeben, als es bei reinen Stimmungsäußerungen und Gefühlsbekundungen zu erwarten wäre. So reagieren etwa viele Vogelarten auf das Herannahen eines Feindes nicht mit einem unspezifischen Angstlaut, sondern verfügen über verschiedene Warnrufe für Luft- und Bodenfeinde, die bei den Artgenossen jeweils ein unterschiedliches Verhalten auslösen. Auch bei einer Affenart, der afrikanischen Meerkatze, wurden drei derartige spezifische Alarmrufe nachgewiesen: Einer warnt vor Leoparden und anderen am Boden jagenden Raubtieren und veranlasst die Affen zur Flucht auf die Bäume; ein zweiter meldet Raubvögel, wie beispielsweise Adler, vor denen sie im Gebüsch Schutz suchen; und ein dritter macht die Artgenossen auf Schlangen aufmerksam, die in der Folge nicht mehr aus den Augen gelassen oder gemeinsam attackiert werden.
Die Primatenforscher Peter Marler, Dorothy L. Cheney und Robert M. Seyfarth haben diese Laute der Meerkatzen intensiv studiert und jahrelange Versuche mit den Tieren durchgeführt, die nach ihrer Auffassung nahezu alle früheren Annahmen über den Charakter derartiger Kommunikationssignale hinfällig machen. So beobachteten die Wissenschaftler etwa, dass einzeln umherschweifende Meerkatzen beim Zusammentreffen mit einem Raubtier keinerlei Alarmrufe von sich gaben und dass die Häufigkeit und Intensität der Signale auch sonst von der Art und Zusammensetzung der jeweils anwesenden „Zuhörerschaft“ abhing – Meerkatzenmütter gaben beispielsweise „signifikant häufiger Alarm, wenn sie ihre Kinder bei sich hatten, als wenn sie mit nichtverwandten Jugendlichen zusammen waren.“
Die Forscher schlossen aus diesen Beobachtungen, dass „die Erzeugung von Alarmrufen nicht obligatorisch geschieht, sondern durch die Anwesenheit von Nachkommen, möglichen Geschlechtspartnern und ranghöheren Rivalen beeinflusst wird.“7 Offenkundig handelt es sich also keineswegs um einen starren Reflexmechanismus, sondern um ein bewusst kontrolliertes, modifiziert und abgestuft angewandtes Signalinventar, und eine ähnliche Modifizierung von Alarmlauten je nach der anwesenden Zuhörerschaft wurde jüngst auch bei so unterschiedlichen anderen Tieren wie Erdhörnchen und Hühnern festgestellt.
Die Meerkatzen scheinen auch keineswegs von Geburt an zur richtigen Anwendung des Lautrepertoires in der Lage zu sein, denn Affenkinder stoßen nach den Beobachtungen Cheneys und Seyfarths die Alarmrufe anfangs beim Auftauchen aller möglichen Tiere aus und lernen erst später, die gefährlichen von den ungefährlichen Arten zu unterscheiden, das heißt richtige Kategorien zu bilden. Hier fällt einem unwillkürlich die Bedeutungsüberdehnung bei unseren eigenen Kindern ein, die in den ersten Monaten des Sprechenlernens ja gleichfalls jeden Vierbeiner als „Wauwau“ zu bezeichnen pflegen – wohl kaum eine rein zufällige Analogie. Hirnuntersuchungen an Affen haben darüber hinaus gezeigt, dass bei ihrer Lautwahrnehmung der linke Schläfenlappen des Gehirns eine wichtige Rolle spielt, der ja auch einen Teil der Sprachzentren des Menschen beherbergt (vgl. S. 56f.).
Diese Forschungsergebnisse haben die Diskussion über mögliche sprachliche Ansätze im Tierreich wieder ins Rollen und viele jahrzehntelang als gesichert geltende Lehrsätze ins Wanken gebracht. Doch auch jenseits dieser neuen Erkenntnisse gibt es viele schon seit langem bekannte Beispiele, die zeigen, dass die tierische Verständigung sehr viel komplexer sein kann als in den simplen Reiz-Reflex-Theorien angenommen und dass sie in der Tat verschiedentlich Züge aufweist, die lange Zeit als ausschließliches Merkmal der menschlichen Sprache galten.