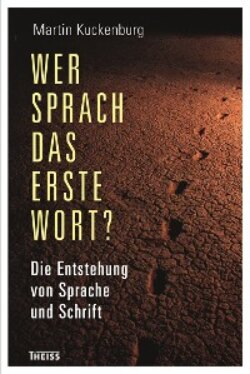Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 13
EIN FORSCHUNGSZWEIG GERÄT INS ZWIELICHT
ОглавлениеAuch die philosophischen Spekulationen und Debatten über den Sprachursprung waren im 19. Jahrhundert aber keineswegs beendet, sie schossen vielmehr geradezu ins Kraut. Neben den bereits erwähnten „klassischen“ Theorien und Erklärungsmodellen (vgl. S. 17) entstanden zu dieser Zeit eine Reihe weiterer, deren Spannweite vom Einleuchtend-Genialen bis zum Skurrilen reichte. So erklärte man die Sprachentstehung beispielsweise aus unwillkürlichen Begleitlauten bei körperlicher Bewegung und Arbeit (wegen des vermuteten physiologischen Zusammenspiels unterschiedlicher Körperorgane als „Sympathie-Theorie“ bezeichnet), aus koordinierenden Lauten oder Gesängen bei kollektiver Tätigkeit (sog. „Arbeitsgesang-Hypothese“ oder „Yo-he-ho“- bzw. „Hauruck-Theorie“), aber auch aus der gesanglichen Begleitung von Tänzen und der Anbetung des Mondes.
Die Spekulationen nahmen derart überhand und bewegten sich zum Teil auf einem solch „phantastischen“ Niveau, dass die Beschäftigung mit dem Sprachursprung schließlich einen unseriösen Beigeschmack bekam und in Verruf geriet, besonders bei der nunmehr streng positivistisch und empirisch ausgerichteten Sprachwissenschaft. So verbot 1866 die Linguistische Gesellschaft von Paris in ihren Statuten alle Erörterungen dieses Themas, ebenso wie die Diskussion von Vorschlägen für eine Weltsprache. Und 1873 erklärte der Präsident der Philologischen Gesellschaft in London, Alexander J. Ellis, derartige Fragen lägen „außerhalb des Arbeitsgebiets der seriösen Philologie“. – „Wir leisten mehr“, so fuhr der Gelehrte fort, „wenn wir die historische Entwicklung eines einzigen Alltagsdialekts zurückverfolgen, als wenn wir Papierkörbe mit spekulativen Abhandlungen über den Ursprung aller Sprachen füllen.“14 Bei dieser selbst auferlegten Zurückhaltung der Linguistik ist es bis heute im wesentlichen geblieben – nur in den USA wird die Sprachursprungsforschung seit einiger Zeit auch von angesehenen Sprachwissenschaftlern wieder betrieben (vgl. S. 74 und 92).
Nun ist es ja in der Tat unbestreitbar, dass viele der erwähnten Theorien mit Wissenschaft nur wenig oder gar nichts zu tun haben. Sie stützen sich jeweils auf sehr spezielle Erscheinungen des heutigen Sprach- und Kommunikationsverhaltens wie lautmalerische Wörter, Empfindungslaute, Zeichensprache oder begleitendes Singen bei körperlicher Arbeit, und projizieren diese recht unbekümmert in die frühe Entwicklungsperiode der Gattung Mensch zurück, um sie als die dort maßgeblichen Triebkräfte der Sprachentstehung zu proklamieren. Überdies lassen sich alle diese Theorien weder beweisen noch widerlegen, sind also rein spekulativ. Denn die ersten Sprachäußerungen des Menschen haben nun einmal keinerlei Spuren hinterlassen, sie sind für alle Zeiten verklungen, und keine Methode ermöglicht es herauszufinden, ob sie sich aus Empfindungslauten entwickelten, Naturtöne nachahmten, von einem Arbeitsrhythmus inspiriert wurden oder vorwiegend aus Gesten bestanden. Mehr als gewisse Anregungen geben und Möglichkeitsfelder abstecken können diese Theorien also nicht, und deshalb wird im Folgenden auch kaum mehr von ihnen die Rede sein.