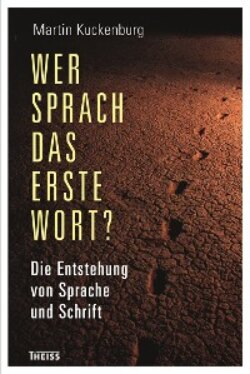Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 17
DIE PHILOSOPHEN UND DIE TIERSPRACHE
ОглавлениеDiese Auffassung lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Der griechische Philosoph Aristoteles schrieb im 4. Jahrhundert v. Chr., dass „der Mensch unter allen tierischen Wesen allein im Besitz der Sprache [ist], während die Stimme, das Organ für Äußerungen von Lust und Unlust, auch den Tieren eigen ist. Denn soweit ist ihre Natur gelangt, dass sie Lust- und Unlustempfindungen haben und dies einander mitteilen können. (…) Tierische Rufe lassen sich aber“, so führte er weiter aus, „nicht zu Silben vereinigen, noch lassen sie sich – wie die menschliche Sprache – auf Silben zurückführen“. Und: „Ein Laut ist nicht durch sich selbst ein Wort, sondern wird es erst, wenn er vom Menschen als Zeichen verwendet wird.“1
Waren diese bemerkenswerten Einsichten bei Aristoteles das Resultat sorgfältiger Beobachtung, so verfocht das christliche Mittelalter die Lehre von der Einzigartigkeit der menschlichen Sprache auf dogmatischer Grundlage: Gott habe den Menschen als sein Ebenbild geschaffen und nur ihn, als die Krone der Schöpfung, mit Bewusstsein, Sprache und Religiosität ausgestattet. Dadurch sei er weit aus der Tierwelt herausgehoben, und es komme einer Gotteslästerung gleich, irgendein anderes Wesen mit ihm auf eine Stufe zu stellen.
In der Zeit der Aufklärung wurden viele tradierte Dogmen zerstört; die Überzeugung, dass allein der Mensch über Sprache und Vernunft verfüge, blieb dagegen unangetastet – sie wurde nur in ein anderes Gewand gekleidet. Der Vater des modernen Rationalismus, der französische Philosoph René Descartes, begründete sie im 17. Jahrhundert neu, indem er die Tiere als vernunft- und seelenlose, allein nach den mechanischen Gesetzen ihres Körpers funktionierende „Automaten“ bzw. „Maschinen“ beschrieb und nur dem Menschen eine „vernünftige Seele“ zubilligte, „deren Natur das Denken ist“. In seinem 1637 veröffentlichten „Discours de la Méthode“ führte er als Beweis dafür die Sprache ins Feld: „Denn es ist ganz auffällig, dass es keinen so stumpfsinnigen und dummen Menschen gibt (…), dass er nicht fähig wäre, verschiedene Worte zusammenzuordnen und daraus eine Rede aufzubauen, mit der er seine Gedanken verständlich macht; und dass es im Gegenteil kein anderes Tier gibt, so vollkommen und glücklich veranlagt es sein mag, das ähnliches leistet.“ Descartes‘ Schlussfolgerung: „Dies zeigt nicht bloß, dass Tiere weniger Verstand haben als Menschen, sondern vielmehr, dass sie gar keinen haben.“2
In eine ähnliche Kerbe hieb Mitte des 19. Jahrhunderts der Sprachwissenschaftler Max Müller, der den Evolutionstheoretikern entgegenhielt: „So weit nun auch die Grenzen des Tierreichs ausgedehnt worden sind, so dass zu Zeiten die Demarkationslinie zwischen Tier und Mensch nur von einer Falte im Gehirn abzuhängen schien, eine Schranke ist doch stehen geblieben, an der bisher noch niemand zu rütteln gewagt hat – die Schranke der Sprache.“ Selbst die ärgsten Zweifler sähen sich nämlich „gezwungen einzugestehen, dass bis jetzt noch keine Tierrasse irgendeine Sprache hervorzubringen vermocht hat“, und dabei werde es auch bleiben3 – eine Auffassung, die bis in unsere Tage hinein weit verbreitet ist.
Ganz unangefochten war diese Position freilich nie. Der Volksglaube neigte immer dazu, den Tieren menschenähnliche Züge zuzuschreiben, wie eine Unzahl von Sagen, Märchen und Geschichten bezeugen, in denen Tiere sich wie selbstverständlich nicht nur untereinander, sondern ebenso mit den Menschen unterhalten. Und auch unter den Philosophen, Literaten und Naturforschern regte sich hier und dort Widerstand gegen die menschliche Überheblichkeit den anderen Geschöpfen gegenüber. Wenn wir die Tiere nicht verstehen, so fragte im 16. Jahrhundert etwa der französische Schriftsteller Michel de Montaigne, warum unterstellen wir ihnen dann Sprachlosigkeit, wo die Ursache doch auch in unserem eigenen Unvermögen liegen kann? „Wenn die Tiere sprechen, dann sicher nicht mittels einer [der unseren] ähnlichen Sprache“, bemerkte der jesuitische Gelehrte Abbé Guillaume Bougeant 1739 in einem Büchlein, das ihm einen Skandalerfolg und beträchtliche Schwierigkeiten mit seinen geistlichen Vorgesetzten einbrachte. „Aber kann man sich“, so fragte er weiter, „nicht auch ohne dieses Hilfsmittel hinreichend verständigen und im wahrhaften Sinne sprechen?“4 Diese Sichtweise wurde von manchem Zeitgenossen und später Lebenden geteilt, und so veröffentlichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts der französische Adlige Dupont de Nemours zwei Wörterbücher für „Krähensprache-Französisch“ und „Nachtigallensprache-Französisch“ – es sollten nicht die einzigen derartigen Werke bleiben.
Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus rückten dann seit 1859 Charles Darwin und seine Mitstreiter dem Dogma von der unüberbrückbaren Kluft zwischen Mensch und Tier zu Leibe. Darwin selbst belegte in einem 1874 erschienenen Werk mit dem Titel „Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren“ ausführlich, dass die menschliche Körpersprache und Mimik Vorläufer und Parallelen im Tierreich hat, und er nahm solche Vorstufen auch für die Sprache an, ohne die „unendlich größere Fähigkeit“ des Menschen in diesem Bereich zu leugnen.5 Der deutsche Zoologe Ernst Haeckel, einer der glühendsten Verfechter der Entwicklungstheorie in damaliger Zeit, ging noch einen Schritt weiter. „Die verschiedenen Laute, durch welche die Affen ihre Empfindungen und Wünsche, Zuneigung und Abneigung mitteilen“, schrieb er, „müssen von der vergleichenden Physiologie ebenso als ‚Sprache‘ bezeichnet werden wie die gleich unvollkommenen Laute, welche kleine Kinder beim Sprechenlernen bilden, und wie die mannigfaltigen Töne, durch welche soziale Säugetiere und Vögel sich ihre Vorstellungen mitteilen. (…) Das alte Dogma, dass nur der Mensch mit Sprache und Vernunft begabt sei, wird auch heute noch bisweilen von angesehenen Sprachforschern verteidigt. (…) Es wäre hohe Zeit, dass diese irrtümliche, auf Mangel an zoologischen Kenntnissen beruhende Behauptung endlich aufgegeben würde.“6