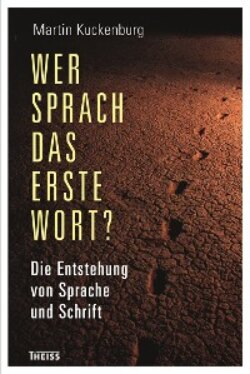Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 14
NEUE FRAGESTELLUNGEN
ОглавлениеDie Beschäftigung mit den Ursprüngen der Sprache ist heute dennoch wieder lohnend und auf fundierter Grundlage möglich, wenn man weniger die Frage nach dem „Wie“ als vielmehr die nach dem „Wann“ und dem „Warum“ der Sprachentstehung in den Vordergrund stellt – die Frage also, mit welcher Zeittiefe für die artikulierte menschliche Verständigung zu rechnen ist und aus welchen Bedürfnissen heraus sie am wahrscheinlichsten entstand. Zu diesen Fragen haben unterschiedliche Wissenschaftszweige wie die Biologie und die Archäologie, die Paläoanthropologie (Wissenschaft von den fossilen Menschenfunden) und die Gehirn- und Kehlkopfforschung in den letzten Jahrzehnten ein reiches Wissensmaterial zusammengetragen, das die Grundlage aller aktuellen Forschungsdiskussionen bildet – ohne einen solchen fächerübergreifenden Ansatz ist an eine sinnvolle Erörterung des Sprachentstehungsproblems heute überhaupt nicht mehr zu denken. Einigkeit und endgültige Klarheit hat zwar auch dieses Material bislang nicht erbracht, denn wesentliche Fragen sind umstrittener denn je – doch anders als früher kreist die Debatte nicht mehr nur um Spekulationen und Hypothesen, sondern um Fakten und ihre Interpretation.
Zu den wichtigsten unter ihnen gehören die Erkenntnisse, die die Biologie und die Verhaltensforschung mittlerweile über die Verständigungweisen im Tierreich gewonnen haben. Sie vermitteln ein Bild davon, was die menschliche Sprache von der tierischen Kommunikation unterscheidet und was sie mit ihr gemeinsam hat – wie also gewissermaßen der Ausgangspunkt aussieht, von dem aus sich unsere Sprache in den frühesten Anfängen der Menschwerdung einmal entwickelt haben muss. Und sie helfen die Frage zu klären, ob der Mensch tatsächlich das einzige Wesen ist, das Sprache besitzt, oder ob es bereits im Tierreich Verständigungsformen gibt, die diese Bezeichnung verdienen – Themen, denen wir uns im nächsten Kapitel zuwenden wollen.
Die Debatte um das Indoeuropäische
Im Jahr 1786 schrieb Sir William Jones, ein britischer Richter in Indien, über die alte Sprache dieses Landes: „Wie alt das Sanskrit auch sein mag – es ist eine Sprache mit einer wunderbaren Struktur: Vollkommener als Griechisch, reichhaltiger als Latein, von erlesenerer Feinheit als beide. Und doch ist die Ähnlichkeit mit diesen beiden Sprachen (…) zu groß, als dass sie auf einem Zufall beruhen könnte, ja so groß, (…) dass alle drei einer gemeinsamen Quelle entsprungen sein müssen, die vielleicht nicht mehr existiert. Es gibt einen vergleichbaren (…) Grund zu der Annahme, dass Gotisch und Keltisch (…) denselben Ursprung haben wie Sanskrit, und auch Altpersisch könnte man der gleichen Familie zurechnen.“15
Diese mittlerweile berühmt gewordenen Sätze gelten als die Geburtsurkunde eines ganzen Forschungszweiges – der vergleichenden Sprachwissenschaft. Dieser Disziplin gelang es im Verlauf des 19. Jahrhunderts, die tatsächliche Verwandtschaft zwischen den von Jones genannten Sprachen durch minutiöse Vergleiche ihres Wortschatzes und ihrer Grammatik hieb- und stichfest zu beweisen. Nicht nur das Altindische, das Altiranische, das Griechische, Lateinische, Keltische und Germanische gehörten – wie die linguistischen Studien ergaben – zu der von dem Richter entdeckten Sprachfamilie, die man nach ihren östlichsten und westlichsten Vertretern bald als „indogermanisch“ bzw. „indoeuropäisch“ bezeichnete; ihr waren darüber hinaus auch das im antiken Anatolien beheimatete Hethitisch, die slawischen und baltischen Sprachen sowie eine Anzahl kleinerer Sprachgruppen und Einzelidiome zuzurechnen (Abb. oben).
Stark vereinfachter Stammbaum der indoeuropäischen Sprachfamilie, wie ihn der Linguist August Schleicher im 19. Jahrhundert rekonstruierte.
Alle diese Sprachen stammten, wie die vergleichenden Forschungen vermuten ließen, von einer gemeinsamen Vorläuferin ab – der sog. indoeuropäischen Ursprache, die sich noch in vorgeschichtlicher Zeit über einen weiten Raum ausgebreitet haben muss und dabei offenbar in eine Reihe regionaler Idiome zerfiel. Diese „Tochtersprachen“ entwickelten sich dann nach Vermutung der Sprachwissenschaftler immer weiter auseinander, woraus im Laufe mehrerer Jahrtausende die verschiedenen modernen und historisch bekannten Sprachgruppen entstanden. Es wäre ein ganz ähnlicher Prozess gewesen wie jener, der in historischer Zeit zur Entstehung der romanischen Sprachen aus ihrer gemeinsamen Ursprungssprache, dem Latein, führte.
So wie das heutige Italienisch, Französisch und Spanisch bewahrten aber auch die indoeuropäischen Sprachen eine ganze Menge an Gemeinsamkeiten im Vokabular und in den grammatischen Strukturen, und das schien die Möglichkeit zu eröffnen, die den einzelsprachlichen Wörtern zugrunde liegenden gemeinsamen Ursprungsformen („Wurzeln“) durch vergleichende Studien zu rekonstruieren. Das Wort ‚Vater‘ beispielsweise lautete im Altindischen pitár, im Lateinischen pater, im Altirischen athir und im Gotischen fadar – unter Berücksichtigung gewisser Gesetzmäßigkeiten in der Lautentwicklung der einzelnen Sprachen folgerten die Fachleute, dass seine gemein-indoeuropäische Ursprungsform vermutlich patér gelautet hatte. Aus den einzelsprachlichen Worten für ‚Schaf‘ – altindisch avis, griechisch o(w)is, lateinisch ovis, altirisch oi, englisch ewe – erschloss man die indoeuropäische Wurzel owis, und ähnliche Rekonstruktionen ließen sich für Hunderte weiterer Wörter vornehmen.
Da man überdies bestimmte grammatische Strukturen der vermuteten Ursprache rekonstruieren zu können glaubte, schien dieses längst verschwundene Idiom plötzlich in Umrissen wiedererschließbar zu sein. Über den Realitätsgehalt dieses rekonstruierten Ur-Indoeuropäisch, in dem die Pioniere der vergleichenden Sprachforschung sogar Gedichte verfassten, sind die Meinungen heute allerdings geteilt. Während manche Sprachwissenschaftler es für ein bloßes gelehrtes Konstrukt halten, betrachten andere Experten es als weitgehend authentische Blaupause einer einstmals real existierenden Sprache.
Eine solche Sprache muss natürlich zu irgend einem Zeitpunkt einmal von Menschen aus Fleisch und Blut gesprochen worden sein, und daher ist die Suche nach dem indoeuropäischen Urvolk und seiner Heimat so alt wie die indoeuropäische Sprachforschung. Das linguistische Material selbst lieferte in dieser Hinsicht einige Fingerzeige. So legten die rekonstruierten Naturbezeichnungen beispielsweise die Vermutung nahe, dass die indoeuropäische Ursprache irgendwo in der gemäßigten Klimazone entstanden sein muss, denn unter den Pflanzennamen sind zwar Birke, Ulme und Weide in ihrem Vokabular vertreten, nicht aber Olive oder Palme, und auch die Tiernamen verweisen mit Bär, Hirsch oder Elch eher in nördliche Breiten.
Die ur-indoeuropäischen Kulturbegriffe wiederum deuten auf eine Gesellschaft, in der der Ackerbau zwar bekannt war, wie Wortwurzeln für ‚Getreide‘, ‚Pflug‘ oder ‚Sichel‘ belegen, an Bedeutung jedoch offenbar bei weitem von der Viehzucht übertroffen wurde, der ein reiches und vielfältiges Vokabular entstammt. Man hielt danach vor allem ‚Herden‘ von ‚Rindern‘ und ‚Schafen‘, doch auch das ‚Schwein‘ ist im Wortschatz präsent. Für die Lokalisierungsfrage als besonders aufschlussreich gilt jedoch der Umstand, dass das Pferd von Anbeginn eine besondere Rolle im Weltbild der Indoeuropäer gespielt zu haben scheint, taucht sein Name (ekwos) doch als Wortelement in zahlreichen Personen- und Götternamen auf.
Da das Pferd nach Vermutung vieler Archäologen aber im 5. Jahrtausend v. Chr. in der Zone nördlich des Schwarzen Meeres domestiziert wurde und die dortigen prähistorischen Kulturen überdies vorwiegend von der Viehzucht lebten, sahen und sehen viele Fachleute die weiten Steppengebiete der Ukraine und Südrusslands als die wahrscheinlichste Ursprungsheimat der indoeuropäischen Sprache und Kultur an. Die aus Litauen stammende und bis zu ihrem Tod 1994 in den USA lehrende Prähistorikerin Marija Gimbutas hat diese Hypothese in den 1970er und 1980er Jahren zu einem umfassenden und spektakulär aufbereiteten Modell ausgebaut.
Nach ihrer Auffassung handelte es sich bei den nordpontischen Viehzüchtern um halbnomadische, patriarchalisch strukturierte und ausgesprochen expansive Gruppen, die „wie alle historisch bekannten Indoeuropäer die todbringende Macht der scharfen Klinge verherrlichten“. In drei Wellen, so Gimbutas, überrollten berittene Krieger aus diesen Kulturen zwischen 4400 und 2800 v. Chr. die umliegenden Regionen Europas und Asiens, vertrieben und unterjochten die dortigen Bevölkerungen und zwangen ihnen ihre Sprache, Lebensweise und Kultur auf. „Der Prozess der Indoeuropäisierung“ müsse, wie die Forscherin hervorhob, also „verstanden werden als ein militärischer Sieg, durch den den einheimischen Gruppen ein neues administratives System sowie eine neue Sprache und Kultur aufgezwungen wurden.“16 Als Folge dieser Unterjochung seien vielerorts in Europa die angestammte Ackerbauwirtschaft und sesshafte Lebensweise einer eher halbnomadisch-viehzüchterischen Kultur gewichen und jahrtausendealte Traditionen der Geschlechtergleichheit und des friedlichen Zusammenlebens durch eine aggressive, von Männern dominierte Gesellschaftsordnung verdrängt worden. Der Begriff „indoeuropäisch“ erhält in diesem Szenario also einen wenig schmeichelhaften kriegerisch-expansiven Beigeschmack.
Seit etwa drei Jahrzehnten macht indessen ein gänzlich anders gearteter Erklärungsansatz des britischen Prähistorikers Colin Renfrew von sich reden. Gleichsam als Gegenentwurf zu Gimbutas’ kriegerischem Szenario präsentierte der Forscher 1987 ein Modell, das ganz auf der Annahme einer friedlichen, durch wirtschaftliche Faktoren bedingten Sprachund Kulturausbreitung basiert. Nach Renfrew gab es „in der europäischen Vorgeschichte nur ein Ereignis, das weitreichend und in den Folgen radikal genug war“, um als Auslöser für die Ausbreitung der indoeuropäischen Sprachen in Frage zu kommen, nämlich „die Einführung der Landwirtschaft“.17 Diese löste erstmals um 8000 v. Chr. im Nahen Osten die zuvor überall auf der Welt praktizierte Nahrungsgewinnung durch Jagen und Sammeln ab (vgl. S. 153f.) und breitete sich in den folgenden 2500 Jahren über Anatolien, Griechenland und den Balkan bis nach Mitteleuropa aus – um 5500 v. Chr. war die bäuerliche Kultur am Rhein angelangt und im Laufe des 5. und 4. Jahrtausends fasste sie auch in Nordeuropa Fuß.18
Ist dies alles bereits seit langem wohlbekannt, so war Renfrews Verknüpfung dieses weiträumigen „Neolithisierungsprozesses“ mit der indoeuropäischen Frage ein neuer und faszinierender Gedanke. Nach seiner Theorie wurde die früheste indoeuropäische Sprache um 7000 v. Chr. von Bauern in Anatolien gesprochen, die sie 500 Jahre später zusammen mit dem Ackerbau nach Griechenland und von dort aus donauaufwärts nach Mitteleuropa trugen. Im Verlauf dieser Ausbreitung bildeten sich nach Renfrew unterschiedliche regionale Dialekte heraus, aus denen später die verschiedenen indoeuropäischen Sprachen und Sprachgruppen hervorgingen. Nicht aggressive Reiterkrieger, sondern friedliche Bauern hätten also die „Indoeuropäisierung“ Europas vollzogen, und dieser Vorgang wäre nicht in Form einer abrupten Invasion, sondern als allmählicher, fast unmerklicher Prozess erfolgt – der Gegensatz zu Gimbutas’ Unterwerfungsszenario könnte kaum größer sein.
Unterstützung hat diese Theorie in jüngster Zeit durch eine computergestützte statistische Auswertung von 87 indoeuropäischen Einzelsprachen gefunden. Die neuseeländischen Evolutionsbiologen Russell D. Gray und Quentin D. Atkinson untersuchten im Jahr 2003 die Gemeinsamkeiten im Vokabular dieser 87 Idiome nach einer allerdings umstrittenen linguistischen Methode namens „Lexikostatistik“ und konstruierten danach mit Computerprogrammen, wie sie in der Evolutionsbiologie Verwendung finden, den wahrscheinlichsten Entwicklungsstammbaum der indoeuropäischen Sprachen. Auch bei ihnen befindet sich das einst in Anatolien gesprochene Hethitisch ganz an der Wurzel, und bei der Datierung des Stammbaums mit einer gleichfalls umstrittenen Methode namens „Glottochronologie“ ergab sich auch bei ihnen ein Alter der hethitischen „Ursprache“ von „zwischen 7800 und 9800 Jahren“.19
Viele Sprachwissenschaftler stehen dieser „anatolischen Theorie“ aber nach wie vor ablehnend gegenüber, weil sie die von der vergleichenden Linguistik erschlossenen Fakten zu wenig berücksichtige. So seien dem erst im 2. Jahrtausend v. Chr. durch Schriftfunde belegten Hethitisch in Anatolien nichtindoeuropäische Sprachen vorausgegangen, und das Altgriechische besitze weniger Ähnlichkeit mit dem Hethitischen als mit dem Altiranischen, was unerklärlich sei, wenn die Sprachausbreitung von Anatolien aus über Griechenland erfolgt wäre.
Der gewichtigste Einwand ergibt sich aber aus dem rekonstruierten urindo europäischen Wortschatz selbst. Dieser enthält nämlich eine ganze Reihe von Bezeichnungen für Kulturgüter, die nach heutigem Wissen erst seit dem 5. oder 4. Jahrtausend v. Chr. bekannt waren bzw. genutzt wurden – neben dem bereits erwähnten domestizierten Pferd zum Beispiel auch Begriffe wie ‚Kupfer‘, ‚Silber‘, ‚Rad‘, ‚Wagen‘, ‚Pflug‘, ‚Joch‘ und andere. Wenn die Ur-Indoeuropäer diese erst im 5./4. Jahrtausend erfundenen bzw. verwendeten Dinge aber bereits kannten und benannten, dann kann ihre Kultur auch erst um diese Zeit existiert haben und nicht mit der Erfindung und frühesten Ausbreitung der Landwirtschaft im 8. bis 6. Jahrtausend v. Chr. in Verbindung gebracht werden – so lautet das einfache, aber schlagende Gegenargument.
Die indoeuropäische Frage bleibt also vorläufig offen und der Ursprung dieser großen asiatisch-europäischen Sprachfamilie rätselhaft – Gott sei dank, möchte man fast sagen, denn sonst käme womöglich einem ganzen Wissenschaftszweig und zahlreichen Spezialisten ihr spannendster Diskussionsstoff abhanden.