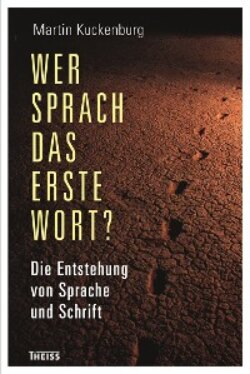Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 24
KREATIVITÄT UND ORDNUNG
ОглавлениеDieses Strukturprinzip, der „unendliche Gebrauch von endlichen Mitteln“,8 hat die menschliche Sprache zu einem einzigartig rationellen, anpassungs- und ausbaufähigen Kommunikationsinstrument gemacht. Da die Beziehung zwischen einem Ding oder einem Begriff und dem Lautgebilde, durch das sie symbolisiert werden, allein auf gesellschaftlicher Übereinkunft beruht (in der Linguistik bezeichnet man das als die „Willkürlichkeit“ der Wortsymbole – eine Ausnahme bilden lediglich lautmalerische Wörter), ist es ebenso einfach möglich, hochkomplexe Gedankengänge und abstrakte Kategorien in Worte zu fassen wie die alltäglichen Dinge des Hier und Jetzt. Dank der Sprache können wir uns über alle nur erdenklichen Themen miteinander verständigen – über Liebe und Hass ebenso wie über Computerviren oder die neuesten Smartphones, über Lust und Leid ebenso wie über den Weltfrieden, den Urknall oder die Entstehung unseres Sonnensystems. Und sollte es in irgendeiner Sprache noch kein Wort für einen dieser Begriffe geben, so kann es bei Bedarf jederzeit problemlos erfunden werden, denn die menschliche Sprache ist fast unbegrenzt produktiv und kreativ.
Doch sie leistet noch mehr: Die Sprache schärft, systematisiert und strukturiert unser Denken, sie hilft uns, die vielfältigen Erscheinungen der Welt, in der wir leben, sinnvoll zu gliedern und zu ordnen, indem wir uns von den einzelnen Dingen und Vorgängen „einen Begriff machen“ – übrigens in den verschiedenen Kulturen auf zum Teil ganz unterschiedliche Weise, wie linguistische Studien gezeigt haben. Die gesprochene Sprache lässt sich außerdem in diverse abgeleitete, sekundäre Kommunikationsformen übertragen und umsetzen – etwa in unterschiedliche Gesten- und Gebärdensprachen, in Trommel- oder Funksignale (man denke an das Morsealphabet) und in verschiedenartige graphische Aufzeichnungssysteme, also die Schrift in ihren vielfältigen Ausformungen (vgl. Teil II dieses Buches).
Die Entstehung der Sprache war also die erstmalige Herausbildung eines in seiner Grundstruktur offenen und beliebig erweiterbaren Kommunikationssystems, das auf der konventionellen Verknüpfung bestimmter Lautfolgen mit bestimmten Bedeutungsinhalten beruht. Ausgangspunkt ihrer Entwicklung dürften bereits recht komplexe, aber im Prinzip noch geschlossene Verständigungssysteme ähnlich denen der heutigen Menschenaffen gewesen sein. Im Verlaufe der Sprachevolution fand vermutlich eine allmähliche Schwerpunktverlagerung von zunächst vorwiegend visuellen Kommunikationssignalen, wie sie noch bei den heutigen Menschenaffen zu beobachten sind (vgl. S. 36f.), zur überwiegend lautlichen Verständigung statt. Der Begriff der Lautsprache darf jedoch nicht zwangsläufig an ein gleichartiges Artikulationsvermögen und eine vergleichbare Laut- und Wortfülle, Syntax und Sprechgeschwindigkeit gebunden werden, wie wir sie heute kennen, denn ein sich erst allmählich herausbildendes System besitzt selbstredend in seinen Anfängen noch nicht die gleiche Vollkommenheit wie an seinem (vorläufigen) Endpunkt (vgl. S. 93).
Auch wenn also die Lautäußerungen unserer frühen Vorfahren in unseren Ohren vielleicht noch schwerfällig und roh geklungen hätten – sie waren Sprache von dem Augenblick an, wo sie bewusst hervorgebracht wurden, um nach kollektiver Übereinkunft verschiedene Dinge zu benennen und unterschiedliche Bedeutungsinhalte auszudrücken.
Ab welchem Zeitpunkt in der Entwicklungsgeschichte des Menschen dürfen wir damit rechnen? Diese Frage soll uns in den folgenden beiden Kapiteln beschäftigen.
Sprachversuche mit Menschenaffen
Im Streit um die Einzigartigkeit des menschlichen Sprachvermögens hat seit jeher die Frage eine große Rolle gespielt, ob unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die Menschenaffen, zum Erlernen einer Sprache in der Lage seien oder nicht. 1747 vertrat der französische Philosoph Julien de La Mettrie die Auffassung, dass ein in der Taubstummensprache erfahrener Lehrer einen Menschenaffen sprechen lehren und ihn in einen „perfekten kleinen Gentleman“ verwandeln könne. 1925 griff der amerikanische Primatenforscher Robert Yerkes diesen Gedanken wieder auf und schrieb: „Vielleicht kann man Schimpansen beibringen, ihre Finger zu gebrauchen, etwa in der Weise, wie es Taubstumme machen, und so eine einfache Zeichensprache ohne Laute zu erlernen.“9 Im Jahr 1784 hatte dagegen Johann Gottfried Herder (vgl. S. 17) genau diese Hoffnung verworfen und notiert: „Denn ob sie gleich den Inhalt der menschlichen Sprache fassen, so hat noch kein Affe, da er doch immer gestikuliert, sich ein Vermögen erworben, mit seinem Herrn pantomimisch zu sprechen und durch Gebärden menschlich zu diskutieren.“10 Und im 19. Jahrhundert stellte der Sprachforscher Max Müller mit Nachdruck fest: „Die Sprache ist der Rubicon, welcher das Tier vom Menschen scheidet, welchen kein Tier jemals überschreiten wird. (…) Man versuche es und bringe den intelligentesten Affen in menschliche Pflege und Lehre, er wird nicht sprechen, er wird Tier bleiben, während das roheste Menschenkind (…) frühzeitig dieses Charakteristikum der Menschheit sich aneignen wird.“11
Ernsthafte Versuche, diese Gedankenspiele im praktischen Experiment zu erproben, wurden erst seit den 1950er Jahren unternommen, und sie schienen zunächst die Zweifel am Sprachlernvermögen der Affen zu bestätigen. So vermochte etwa die Schimpansin Viki trotz intensiver Bemühungen ihrer amerikanischen Pflegeeltern Catherine und Keith Hayes, ihr die englische Lautsprache beizubringen, nach jahrelangem Training nur mit Mühe die vier Wörter mama, papa, cup und up hervorzubringen. Die meisten Fachleute zogen aus diesem bis 1954 durchgeführten Experiment den Schluss, dass den Affen der für eine Lautsprache erforderliche Stimmapparat fehle. Alle nachfolgenden Versuche zielten daher, wie schon von La Mettrie und Yerkes erwogen, auf die Unterrichtung der Tiere in visuellen bzw. gestischen Zeichensprachen ab, und sie verliefen sehr viel erfolgreicher.
Seit 1966 machte die von dem amerikanischen Psychologenehepaar Gardner aufgezogene Schimpansin Washoe weltweit Schlagzeilen, die nach Angaben ihrer Pflegeeltern mehr als 160 Zeichen der amerikanischen Taubstummensprache ASL – bei der jeder Begriff durch eine Geste bzw. Handbewegung symbolisiert wird – erlernte und im Dialog mit ihren Betreuern sinnvoll und korrekt anwandte. Seit Beginn der 1970er Jahre wurden dann unter Leitung der Gardners und ihres früheren Chefassistenten Roger Fouts weitere Schimpansen, darunter Moja, Lucy und Bruno, in dieser Verständigungstechnik unterrichtet. Bald gab es eine ganze „Kolonie der sprechenden Schimpansen“ (so der Titel eines damals populären Buches), die die Öffentlichkeit immer aufs Neue in Erstaunen versetzte. Die Tiere verknüpften nach den Berichten ihrer Betreuer nicht nur bis zu vier verschiedene Zeichen zu komplexeren Aussagen, sie bevorzugten auch bestimmte Wortstellungen und machten beispielsweise einen Unterschied zwischen „Lucy kitzeln Roger“ und „Roger kitzeln Lucy“, was als Ansatz eines Sinns für Grammatik und Syntax gedeutet wurde. Vor allem aber erweiterten sie, wie ihre Lehrer hervorhoben, selbständig und kreativ ihr Zeichenvokabular, indem sie für bislang unbenannte Dinge eigene Symbole erfanden oder bereits bekannte in neuer und zum Teil sehr origineller Weise kombinierten. So reihte etwa Washoe beim Anblick eines Schwans die Zeichen für ‚Wasser‘ und ‚Vogel‘ aneinander, und in ähnlicher Weise kreierten die Tiere auch andere Zeichenkombinationen wie ‚Stein-Beere‘ für eine Paranuss (Washoe), ‚Heiß-Metall‘ für ein Feuerzeug, ‚Horchen-Getränk‘ für Alka Seltzer in einem Glas (Moja) oder ‚Schrei-Schmerz-Frucht‘ für ein Radieschen nach dem Hineinbeißen (Lucy). Washoe erfasste anscheinend sogar die Mehrdeutigkeit eines Begriffs wie ‚schmutzig‘, der ihr im Zusammenhang mit Kot beigebracht worden war, und produzierte beim Anblick von Makaken-Äffchen mehrfach die Zeichenfolge ‚Affe‘ und ‚schmutzig‘, ja bedachte sogar ihren Trainer Roger Fouts verschiedentlich mit den Handsignalen für ‚schmutzig‘ und ‚Roger‘.
Die Taubstummensprache ASL war jedoch nicht das einzige Kommunikationssystem, das man Schimpansen in den 1970er Jahren beizubringen versuchte. Der Psychologe David Premack erfand ein eigenes Zeichensystem aus farbigen Plastiksymbolen mit Wort-Bedeutung, die seine Schimpansin Sarah zu sinnvollen Sequenzen von mehreren Zeichen anzuordnen vermochte (Abb. unten). Und Duane Rumbaugh entwickelte eine andere artifizielle Symbolsprache namens „Yerkisch“, mittels deren die Schimpansin Lana über eine Tastatur Wünsche in einen Computer eintippen konnte, die nur bei korrekter „Formulierung“ erfüllt wurden. Auch mit einem Gorilla und einem Orang-Utan führte man zu dieser Zeit Sprachexperimente durch.
Schon früh stellten freilich eine Reihe von Wissenschaftlern diese Experimente in Frage, und in den 1980er Jahren gewannen Skepsis und Ablehnung zumindest in der amerikanischen Fachwelt die Oberhand. Eine wichtige Rolle bei diesem Stimmungsumschwung spielte der Psychologe Herbert Terrace, der in den 1970er Jahren selbst Sprachversuche mit einem jungen Schimpansen namens Nim durchgeführt hatte, um die experimentellen Erfolge der Gardners nachzuvollziehen. Doch nach viel versprechenden Anfängen (Nim erlernte über 100 ASL-Zeichen) blieben die Lernerfolge des Schimpansen zunehmend hinter den hoch gesteckten Erwartungen von Terrace zurück, so dass dieser das Projekt schließlich abbrach. In einem 1979 veröffentlichten Buch und in einer Serie von Aufsätzen verwarf er anschließend fast alles, was bis dahin über die sprachlichen Leistungen der Menschenaffen gesagt und geschrieben worden war.
Einige „Sätze“ in dem Zeichensystem aus farbigen Plastiksymbolen, das der Psychologe David Premack in den 1970er Jahren für die Kommunikation mit der Schimpansin Sarah erfand.
Die Versuchstiere hätten – so urteilten Terrace und bald darauf zahlreiche andere Kritiker – die von ihnen verwendeten Zeichen gar nicht in ihrer Symbolfunktion erkannt, sondern nur in einem ihren Betreuern unbewussten Dressurakt erlernt; sie hätten also gar nicht bewusst kommuniziert, sondern nur ein erfolgreiches, weil zu einer Belohnung führendes Verhalten immer wieder reproduziert. Auch eine wirklich spontane und kreative Verwendung der Zeichen habe, so die Kritiker weiter, niemals stattgefunden. Die Schimpansen hätten vielmehr nur auf die Fragen ihrer Trainer reagiert und seien kaum einmal von sich aus sprachlich initiativ geworden. Ihre Zeichenfolgen seien überdies weit weniger umfangreich geblieben als die sprachlichen Äußerungen von Kleinkindern selbst in den frühesten Phasen des Sprechenlernens, und schließlich sei in ihnen keinerlei grammatikalische Ordnung, keine Syntax erkennbar gewesen, die doch das A und O einer jeden echten Sprache bilde.
Eine Forscherin bei der Verständigung mit dem Schimpansen Nim mittels Zeichensprache.
Die Auswirkungen dieser Kritik, die die an den Experimenten beteiligten Wissenschaftler in die Rolle unfreiwilliger Dompteure versetzte, waren wissenschaftlich wie finanziell vernichtend. Erst in den 1990er Jahren gelang es dem so jäh in Verruf geratenen Forschungszweig allmählich wieder, sich von dem Rückschlag zu erholen.
Das war vor allem das Verdienst der Psychologin Sue Savage-Rumbaugh und des von ihr betreuten Zwergschimpansen (Bonobo) Kanzi. Schon zu Beginn der 1980er Jahre hatte die Forscherin damit begonnen, Kanzis Adoptivmutter Matata in der ursprünglich für die Schimpansin Lana entwickelten Symbolsprache „Yerkisch“ (vgl. S. 42) zu unterrichten. Doch während alle Bemühungen bei Matata erfolglos blieben, erlernte ihr kleiner Adoptivsohn Kanzi, der stets bei ihr war, völlig unbeabsichtigt und gleichsam beiläufig die abstrakten geometrischen Symbole („Lexigramme“) und darüber hinaus viele Worte des gesprochenen Englisch seiner Betreuer. Das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass diesen Tieren – ebenso wie dem Menschen – der Spracherwerb im Kindesalter am leichtesten fällt und dass ihnen Sprachelemente zu dieser Zeit keineswegs eingetrichtert zu werden brauchen, sondern sich gleichsam von selbst entwickeln, wenn in der Umwelt genügend sprachliche Reize vorhanden sind.
Diese Erkenntnis wirkte sich auch auf die weitere Gestaltung der Arbeit mit Kanzi aus. Während die früheren Schimpansenprojekte sich zum Teil in Laborräumen abgespielt hatten, fanden die Versuche mit Kanzi größtenteils in einem ausgedehnten Waldstück im Freien statt. Die Betreuer begleiteten den Zwergschimpansen dort rund um die Uhr bei seinen Streifzügen, „unterhielten“ sich mit ihm mit Hilfe von Lexigrammen, Ges ten und gesprochener Sprache über die alltäglichen Ereignisse und ermutigten ihn, das Gleiche zu tun. Ein darüber hinausgehender Unterricht fand nicht statt, und auch Belohnungen wurden nicht vergeben – insgesamt also eine entspannt-kommunikative Atmosphäre ähnlich derjenigen, in der Kinder Sprache erlernen, und die jede Art von Dressur so gut wie ausschloss.
Als Ergebnis dieses zwanglosen Trainings benutzte Kanzi bald regelmäßig Lexigramme, um sich in bestimmten Situationen spontan verständlich zu machen, und gruppierte diese zum Teil in einer Weise, die sich an die Wortfolge im Englischen anlehnte, zu sinnvollen Zwei- und Drei-Wort-Sätzen. Noch sehr viel erstaunlicher waren seine Fähigkeiten zum Verstehen von Sprache, und zwar auch von gesprochener Sprache. Sein passiver Wortschatz umfasste nach strengen Kriterien schließlich mindestens 150 Wörter der englischen Lautsprache, und er vermochte den Satz „Geh zum Kühlschrank und hol eine Orange heraus“ problemlos von dem Satz „Tu die Orange in den Kühlschrank“ zu unterscheiden. Bei einer Testreihe, in der er mit zahlreichen derartigen (ihm zuvor unbekannten) Anweisungen konfrontiert wurde, reagierte er in etwa 80 Prozent der Fälle richtig – bei einem zweijährigen Mädchen, das zu Vergleichszwecken die gleichen Aufgaben lösen sollte, lag die Erfolgsquote „nur“ bei 64 Prozent.
Kanzis Fähigkeiten übertrafen damit noch die früher für Washoe, Lucy und ihre Kollegen in Anspruch genommenen und können daher wohl auch als eine gewisse Rehabilitierung dieser in den 1980er Jahren so pauschal abqualifizierten Projekte gelten. Möglich ist dies freilich nur, weil Savage-Rumbaugh im Gegensatz zu den früheren Versuchsleitern sämtliche Sprachäußerungen Kanzis und den Kontext, in dem sie stattfanden, minutiös dokumentierte und statistisch auswertete. So ist nicht nur der Verdacht der Dressur vom Tisch, sondern ebenso der Vorwurf einer bloßen Wiedergabe ausgewählter Anekdoten und einer Überschätzung zufälliger Einzelleistungen.
Kein Zweifel: Die „sprechenden Affen“ sind nach einem Jahrzehnt des Schweigens wieder da – und mit ihnen auch die Frage nach den bis ins Tierreich zurückreichenden Wurzeln unserer Verstandes organisation.