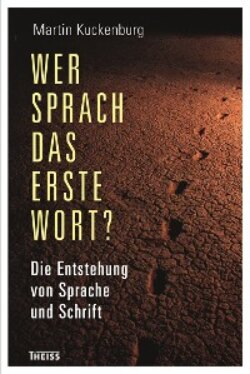Читать книгу Wer sprach das erste Wort? - Martin Kuckenburg - Страница 22
ÜBERRASCHENDE BEOBACHTUNGEN
ОглавлениеWas schließlich unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die Menschenaffen, betrifft, so haben die langjährigen Studien Jane Goodalls und anderer Forscher unter frei lebenden Schimpansen und Gorillas unsere Perspektive seit den 1960er Jahren von Grund auf verändert. Wir wissen heute, dass diese Tiere für den Nahkontakt innerhalb der Gruppe über ein reiches Arsenal an ausdrucksvollen Körperhaltungen, Gebärden und Variationen des Gesichtsausdrucks verfügen – von Signalen der Gestik und Mimik also, die ja auch bei uns Menschen eine überaus wichtige und oftmals unterschätzte Rolle spielt. So wie wir uns durch unsere Körpersprache, durch Gesten, Blicke und unser Mienenspiel (Lächeln, Stirnrunzeln, zusammengebissene Zähne usw.) wortlos verständigen können, und zwar zumindest zum Teil weltweit auf der Basis angeborener „Programme“, so können das auch die Menschenaffen (Abb. S. 37). Ihre visuellen Signale sind dabei mit verschiedenen Lautäußerungen und Berührungsreizen verbunden, so dass sich insgesamt ein sehr fein abgestuftes System von kombinierten Reizen zur Mitteilung von Stimmungen, Motivationen und anderen Informationen ergibt.
Dieses System ist in seiner Anwendung bemerkenswert flexibel und vielschichtig, und ein und dasselbe Signal kann darin je nach Kontext eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben. So drückt etwa die sehr beliebte gegenseitige Fellpflege (grooming) normalerweise liebevolle Zuwendung unter Partnern und Verwandten aus, kann aber auch zur Beschwichtigung eines Gegenspielers in einer aggressiven Situation dienen. Und das Präsentieren des Hinterteils – eigentlich ein Paarungssignal – fungiert des öfteren auch als Begrüßungs- oder Unterwerfungsgeste.
Beispiele für das Mienenspiel wild lebender Schimpansen.
Ein solches Signal löst beim Kommunikationspartner auch keineswegs immer denselben Reflex aus – vielmehr existiert ein weiter Reaktionsspielraum, bei dem nicht zuletzt auch die Umstände von großer Bedeutung sind. So kann beispielsweise das durch Imponiergehabe, dramatische Gesten und manchmal auch körperliche Attacken gekennzeichnete Herausforderungs- und Angriffsverhalten eines Schimpansenmännchens gegenüber einem anderen ebenso gut eine aggressive Gegenreaktion wie eine Unterwerfungs- und Beschwichtigungsgebärde auslösen – je nach Stärke, Stimmung, Alter und sozialem Status der beiden Individuen. Und auch die akustische Kommunikation scheint durch Erfahrungswerte und soziale Faktoren beeinflusst zu sein, denn ähnlich wie die Alarmrufe der Meerkatzen finden auch die Lautäußerungen der Schimpansen unterschiedlich starke Beachtung, je nachdem, welches Individuum sie von sich gibt.
Unsere Primatenverwandten handhaben das ihnen im Grundsatz angeborene Signalinventar also je nach Situation durchaus flexibel, was ohne ein starkes Lernelement unmöglich wäre – auf diesem anpassungs- und leistungsfähigen Verständigungssystem beruht zu einem guten Teil die hoch entwickelte Gruppenstruktur und soziale Hierarchie der Menschenaffengemeinschaften. Vervollständigt wird dieses komplexe Bild durch die Aufsehen erregenden und großenteils erfolgreichen Versuche, domestizierten Schimpansen und Gorillas Zeichensprachen mit zum Teil Hunderten von abstrakten Symbolen beizubringen und mit ihnen in diesen Zeichensprachen zu kommunizieren (vgl. S. 41–44). In der Natur wurde derartiges allerdings niemals beobachtet, so dass es sich anscheinend um ein nur unter menschlicher Anleitung zutage tretendes Potenzial handelt.
Die Tierkommunikationsforschung ist ein noch vergleichsweise junger Wissenschaftszweig, und weitere überraschende Ergebnisse sind jederzeit möglich. Dies gilt beispielsweise für die mittlerweile schon berühmten Gesänge der Buckelwale – minutenlang andauernde und oft über Stunden hinweg wiederholte charakteristische Lautfolgen, deren Struktur besser bekannt ist als ihre Funktion. Doch schon heute erweist sich die tierische Kommunikation als weitaus komplizierter und leistungsfähiger, als dies noch vor fünfzig Jahren irgend jemand für möglich gehalten hätte. Sie erschöpft sich, wie zahllose Forschungsergebnisse gezeigt haben, keineswegs in den früher vermuteten simplen Reiz-Reaktions-Mechanismen (vgl. S. 31), und manche starre definitorische Grenze, die man lange Zeit zwischen ihr und der menschlichen Sprache errichten zu können glaubte, ist mittlerweile gefallen oder zumindest fragwürdig geworden. Viele Fachleute vertreten heute sogar die Auffassung, es gebe kaum ein einzelnes Merkmal, das unsere Sprache allein besitze und das sie nicht mit dem einen oder anderen tierischen Kommunikationssystem teile. Die Einzigartigkeit der menschlichen Sprache liegt nach Meinung dieser Forscher daher nicht in einzelnen Unterscheidungskriterien mit absoluter Gültigkeit, sondern in der Art und Weise, wie in ihr viele solcher auch im Tierreich anzutreffenden Einzelmerkmale und -leistungen miteinander kombiniert und zu einem neuen System verknüpft sind.