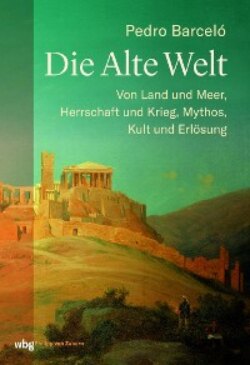Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 25
1 Homer und kein Ende Homerische Welten
ОглавлениеIm Vergleich zu dem Quellenmaterial der mykenischen Ära und der Dark Ages gestatten die homerischen Epen tiefere Einblicke in die sozialen und politischen Verhältnisse der archaischen Zeit. Es ist so, als ob in einem dunklen Raum plötzlich das Licht aufginge, womit der Schauplatz der griechischen Geschichte hell beleuchtet, ja im neuen Glanz erstrahlen würde. Aufgrund der Auskünfte, die Homer bietet, sind wir erstmalig in der Lage, fundierte Einschätzungen über die Triebkräfte und Lebensbedingungen der Menschen abzugeben, die im Mittelpunkt der dargestellten Episoden stehen. Nicht nur ihre öffentlichen Auftritte, sondern auch ihre Privatsphäre, Gefühlswelt und Wertmaßstäbe werden in epischer Breite ausgemalt. Sie rücken in unsere Nähe, was uns durchaus tangiert, weil wir trotz der großen zeitlichen Distanz in ihnen einen Teil von uns selbst erkennen. Dies ist bereits in den ersten Versen des Epos, das den Trojanischen Krieg besingt, der Fall. Hier begegnen wir einem überaus dramatischen Appell, der auf einen verzwickten Streitfall Bezug nimmt, der den Zusammenhalt der Expedition in Frage stellen konnte: Singe den Zorn, o Göttin, des Peleiaden Achilleus, ihn, der entbrannt, den Achaiern unnennbaren Jammer erregte und viel tapfere Seelen der Heldensöhne zum Aides sandte, aber sie selbst zum Raub gewährte den Hunden und den Vögeln umher zum Fraß. So ward Zeus’ Wille vollendet seit dem Tag, als erst durch bitteren Zank sich entzweiten Atreus’ Sohn, der Herrscher des Volks, und der edle Achilleus.1
Die unzähmbare Leidenschaft eines berühmten Kriegers, der zusammen mit seinen Gefährten nach Troja gezogen war, um neben reicher Beute unsterblichen Ruhm und Ehre zu erwerben, steht am Anfang der Ilias, ein literarisches Meisterwerk der griechischen Archaik. Sein Schöpfer, Homer, ruft in der Einleitung seines farbenprächtigen Epos die Göttin auf, vom Zorn eines gekränkten Mannes zu singen. Was war vorausgegangen? Agamemnon, der Führer des griechischen Belagerungsheeres vor Troja, geriet mit seinem tapfersten Kämpfer, Achilleus, wegen der gefangenen Briseis in einen heftigen Disput. Die Situation kommt uns reichlich bekannt vor: Zwei Männer stritten sich um eine Frau. Beide wollten sie besitzen. Agamemnon blieb unnachgiebig, nahm Achilleus das Mädchen weg und führte es in sein Zelt ab. Aber seine Autorität litt darunter, denn der Unterlegene verweigerte nun die Gefolgschaft und der Oberbefehlshaber vermochte ihn nicht zur Wiederaufnahme des Kampfes zu bewegen. Achilleus Gemütszustand ist verständlich. Zwar hatte Agamemnon durch die Ergreifung der jungen Frau sein Vorrecht bei der Verteilung der Kriegsbeute durchgesetzt, aber gleichzeitig die Ehre eines Mitkämpfers öffentlich angegriffen, denn das Objekt der männlichen Begierde befand sich zuvor in Achilleus Zelt, als jener die Herausgabe erzwang. Aber Agamemnon versuchte einzulenken, indem er seinem Rivalen als Ersatz für Briseis ein wahrhaft königliches Geschenk anbot, nichts Geringeres als sieben „wohlbevölkerte Städte“2, die Achilleus jedoch bockig ablehnte, weil er unnachgiebig auf der Rückgabe der Geisel bestand. Diese Reaktion, die uns moderne Menschen anspricht, weil sie vom verletzten Ehrgefühl durchdrungen ist, war den Zeitgenossen allerdings schwer zu vermitteln. Dass man aus Trotz oder gar Sentimentalität eine so überaus großzügige Abfindung eines Mädchens wegen ausschlagen konnte, dürfte gewiss Kopfschütteln und Unverständnis ausgelöst haben. Selbst der allgemein anerkannte Nestor blieb erfolglos, als er versuchte, zwischen den Kampfhähnen zu vermitteln.
Ein eindringlicheres Netzwerk menschlicher Leidenschaften episch darzustellen, wie es Homer auf unnachahmliche Weise vermochte, ist schwer vorstellbar. Besitztrieb, Ehrsucht, gekränkte Eitelkeiten, Gier, Konsensbestrebungen, Gefühlsaufwallungen, Machtbewusstsein und vieles mehr wird in kunstvoll gestalteten Versen thematisiert, die uns deswegen in Atem halten, weil sie stets aktuelle Themen behandeln. Wir sehen darin, was für alle große Literatur gilt, deren Inhalt anthropologische Grundphänomene reflektiert, Spiegelungen unserer eigenen Wirklichkeit. Außerdem fasziniert uns der Zauber einer Welt voll Abenteuer, Wunderwesen, dramatischer Aktionen und verwegener Gestalten, in der sich vielfältige Formen der griechischen Lebensart manifestieren.
Mit der Hinwendung zu Homer begeben wir uns zu den Anfängen der schriftlichen Traditionsbildung, sozusagen zu den ältesten literarischen Spuren unserer eigenen Kultur. Anders als die nur begrenzt aussagekräftigen Verzeichnisse der mykenischen Palastzeit vermitteln die homerischen Epen (Ilias, Odyssee) eine vielschichtige Vorstellung von der Alltagswirklichkeit, Denkvorstellungen und Gefühlslagen der darin handelnden Menschen und ihrer Umwelt. Ferner bieten sie ein äußerst komplexes und keineswegs einheitliches Bild einer Epoche, für deren Kennzeichnung sich der summarische Begriff homerische Gesellschaft eingebürgert hat. Die soziale Dimension der Epen vereinigt sowohl Elemente der Kontinuität als auch des Bruchs und der Umwandlung der ihnen zugrundeliegenden historischen Wirklichkeiten.3 Sie sind das Ergebnis einer nicht mehr bis ins Detail zurückzuverfolgenden Verschmelzung unterschiedlicher Bewusstseinsebenen, mündlicher Traditionen und Relikte vergangener Jahrhunderte. Die verarbeiteten Erinnerungen reichen von der grauen Vorzeit bis hin zu der Epoche, in der die Epen ihre uns überlieferte Gestalt annahmen.4 Obwohl alles darauf hindeutet, dass es gerade diese letzte Phase war, die das Hauptsubstrat der sozialen und politischen Verhältnisse der gezeichneten Episoden bildete, gibt es hinreichende Anhaltspunkte, die auf längst vergangene Zeiten hinweisen. An die mykenische Ära erinnern etwa die große Anzahl von Schiffen und Besatzungen aus dem Schiffskatalog der nach Troja aufgebrochenen Kämpfer sowie einige Züge der Hofhaltung in den Palästen des Nestor, des Menelaos und des Alkinoos, nicht zuletzt aber die sakrale Verankerung der Herrscherwürde in der Gesellschaft: Ihre Vertreter galten als gottentsprossen. Ferner hatten sie ein Anrecht auf Geschenke und besaßen, wie die Götter, ein temenos (Sakralbereich, Landgut). Die bereits erwähnte Großzügigkeit des Agamemnon gegenüber Achilleus oder die des Menelaos gegenüber Odysseus vermittelt einen Eindruck vom Reichtum der mykenischen Potentaten. Wesentlich schwieriger ist es, das Verhältnis der homerischen Institutionen zu den Dark Ages zu bestimmen, da uns hierfür – anders als für die mykenische Palastzeit – die Vergleichsgrundlage fehlt. Dennoch gibt es Schichten homerischer Überlieferung, die nur durch eine direkte Bezugnahme zu der unmittelbar vorangehenden Epoche entschlüsselt werden können. So sieht Moses Finley in der Welt des Odysseus die Verhältnisse der Dark Ages und begründet dies damit, dass eine große Anzahl zeitgenössischer Erscheinungen nicht in den Epen vorkommen: Ionier und Dorer, der Gebrauch der Schrift und eiserne Waffen, die griechische Kolonisation und der damit zusammenhängende Handel werden ebenso wenig berücksichtigt wie die Verweise auf jene politischen Gemeinschaften, die sich mittlerweile der Alleinherrschaft entledigt hatten.5 Dieser Ansicht ist mehrmals widersprochen worden. Die heute vorherrschende Forschungsmeinung betont, dass es vorwiegend die Zeit der Fixierung von Ilias und Odyssee war, die sich in den homerischen Gesängen widerspiegelt. Alle wesentlichen politischen, ökonomischen, sozialen und religiösen Erscheinungsformen der Epen wie Polis, Volksversammlung, Familienverband, Krieg, Handel, Oikos, Land- und Viehwirtschaft sowie das Wertesystem der Gesellschaft thematisieren Handlungsweisen und Situationen, wie man sie im Griechenland des 8. und 7. Jahrhunderts v. Chr. allerorten vorfand.
Auf der institutionellen Ebene konfrontieren uns die Epen mit verschiedenen Herrschaftsdiskursen. Agamemnon verkörpert an einigen Stellen eine an alte mykenische Traditionen anknüpfende und den Menschen des 8. Jahrhunderts v. Chr. kaum noch verständliche Vorstellung eines uneingeschränkten Herrschertums. Der ihm zur Verfügung stehende Machtbereich umfasste ein beträchtliches Territorium. Seine Stellung gründete auf Erbfolge und göttliche Auserwählung. Zepter und „heiliges Gesetz“ erhielt Agamemnons Großvater Pelops vom Göttervater Zeus selbst. Diesen von der sozialen und ökonomischen Realität der archaischen Lebenswelt Griechenlands weit entfernten Herrschaftsauffassungen stehen in den Epen andere, wesentlich nüchternere gegenüber. Es gibt eine Reihe von basileis, deren Macht kaum die Grenzen ihrer kleindimensionierten Gemeinden überschreitet. Ihre Gedanken kreisen um das angestrebte oder bereits erhaltene temenos (Landgut). Auch die minutiös beschriebene Vorratskammer mit ihren Lebensmitteln und kostbaren Metallen, besonders aber die Viehherden, die als Maßstab für den Reichtum der Betroffenen gelten, spielen eine große Rolle bei all ihrem Trachten und Tun.6 Schließlich tritt uns vor allem in der Odyssee eine Vorstellung von Herrschaft entgegen, deren Vertreter kaum etwas anderes zu sein scheinen als gut situierte Grundbesitzer. Sie agieren als Mitglieder eines Adelskollektivs und streben im Wettbewerb mit ihren Standesgenossen eine Vorrangstellung an. Um diese zu verwirklichen, griff beispielsweise Odysseus bei seiner Rückkehr nach Ithaka zu Gewaltmaßnahmen. Von besonderem Interesse in diesem Zusammenhang ist die durch das Fernbleiben des Odysseus entstandene politische Spannung auf der Insel, die sich in einem Machtkampf der Konkurrenten entlud. In der Brautwerbung um Penelope erreichte der adlige Wettbewerb seinen sichtbaren Ausdruck. Von Bedeutung ist eine fast unscheinbare Begebenheit, die sich auf dem Hintergrund der ungeklärten Machtverhältnisse ergab. Verzweifelt über die lange Abwesenheit seines Vaters Odysseus, erbat Telemachos von der Volksversammlung Unterstützung gegen die Freier seiner Mutter Penelope, die sein Vermögen hemmungslos verschleuderten. Er verlangte ein Schiff, um sich auf die Suche nach dem Vater zu begeben. Bemerkenswert ist Telemachos Wunsch, eine an sich private Angelegenheit vor das Volk von Ithaka zu bringen, sie sozusagen zu politisieren: Gebt mir ein schnelles Schiff und zwanzig Gefährten, die mir die Hin- und Rückfahrt durchzuführen vermögen; denn ich möchte nach Sparta gehen und dem sandigen Pylos, ob ich von der Heimkehr höre des Vaters, der lange schon fort ist, ob es mir einer der Sterblichen sagt oder ob ich von Zeus her hör ein Gerücht, wie so sehr es verbreitet ist unter den Menschen. Hör ich, er sei noch am Leben, der Vater, und sei auf dem Heimweg, halt ich ein Jahr noch aus, wie sehr ich auch bedrängt bin; höre ich aber, er sei gestorben und nicht mehr am Leben, will ich nach Hause zurück ins liebe Land meiner Väter kehren, ein Mal ihm errichten und Totenopfer ihm spenden, reichliche, wie es sich ziemt, und gebt einem Manne die Mutter.7
Die Szene ist deshalb aufschlussreich, weil sie verdeutlicht, dass ein Beschluss durchsetzungsfähig sein konnte, wenn er von der Volksversammlung mehrheitlich getragen wurde. Folglich standen die Herrschaftsansprüche der Eliten mit deren gesellschaftlicher Akzeptanz in Einklang. Zu Recht sieht daher Kurt Raaflaub im Verhalten der Akteure ein „Konzept der kollektiven Verantwortung“ ausgebildet, woraus sich folgern lässt, dass private Angelegenheiten und öffentliches Interesse durchaus in ein Spannungsverhältnis zueinander geraten konnten.8 Streitfälle wurden mittels Schiedssprüchen gelöst oder durch mehr oder weniger heftige Konfrontationen entschieden. Die Frage war stets, welche Person oder gesellschaftliche Gruppe die Macht besaß, sich durchzusetzen. Bezeichnend dafür ist die Thersites-Episode. Der nichtadlige Thersites verhöhnte den erfolglosen Agamemnon in provokanter Weise vor der gesamten Heeresversammlung, indem er drohte:Lasst uns mit den Schiffen nach Hause fahren, diesen aber (Agamemnon) lasst hier vor Troja seine Beute verschlingen, damit er sehe, ob wir ihm Hilfe sind oder nicht.9
Derartige Anfechtungen von Herrschaftsansprüchen blieben aber die Ausnahme. Die Regel bildete vielmehr das Anstimmen eines hohen Liedes auf die Protagonisten der Epen, und das war die adlige Herrenschicht, die auf dem Schlachtfeld die Kommandos ausgab, in Streitfällen als Richter agierte, die Geschicke der Gemeinschaft leitete und mittels Opferhandlungen das Wohlwollen der Götter für den eigenen Oikos und die gesamte Polis heraufbeschwor.