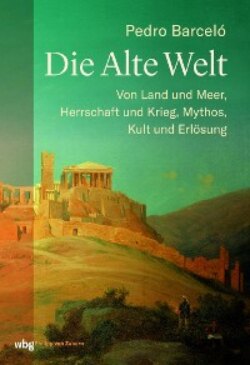Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 36
6 Mythologische Verklärungen Dido und Aeneas
ОглавлениеWie weit reichen die Spuren eines Gemeinwesens zurück? Dies zu eruieren, ist im Falle Karthagos besonders reizvoll, weil die Stadt nach dem 3. Römisch-karthagischen Krieg 146 v. Chr. dem Erdboden gleichgemacht wurde, womit ihre historische Erinnerung versiegte, buchstäblich unter Trümmern begraben wurde. Über mehrere, nachträglich zu Bedeutung aufgestiegene antike Städte liegen Gründungsgeschichten vor. Sagenstoffe aus grauer Vorzeit, Heldengestalten und historische Reminiszenzen vereinigen sich zu eindringlichen allegorischen Bildern, aus denen sich aber nur selten historisch zuverlässige Begebenheiten ablesen lassen. Wer kennt nicht den Bruderzwist zwischen Romulus und Remus, die wohl bekannteste Episode aus dem reichhaltigen Repertoire des römischen Sagenkreises?92 Ihre politische Brisanz illustriert die Tatsache, dass Octavian nach seinem Aufstieg zur Macht erwog, sich in Romulus umzubenennen, bevor aus ihm Augustus wurde. Bekanntlich scheiterte das Vorhaben an jener Version der Romuluslegende, wonach der Stadtgründer Romulus von erbosten Senatoren erschlagen worden war. Unter ein derartig ungünstiges Omen wollte Octavian seine gerade erworbene Herrscherstellung über den römischen Staat doch nicht stellen und unterließ es daher, das Schicksal herauszufordern. So sehr konnte der Mythos, wie dieses Beispiel zeigt, das Drehbuch der Geschichte mitgestalten.
Nicht viel anders verhält es sich mit Karthago, über dessen Frühgeschichte wir ebenfalls einen reichen Sagenkreis kennen, in dessen Mittelpunkt namhafte Akteure stehen. Anders als für die römische Vergangenheit, die von einheimischen (Varro, Livius) oder romfreundlichen Autoren (Dionysios von Halikarnassos) ersonnen wurde, ist die überlieferte Fassung der karthagischen Gründungsepisode das Werk fremder Gewährsleute, was genauso viele Vorteile wie Nachteile mit sich bringt. Am ausführlichsten ist sie in den viele Jahrhunderte nach den Geschehnissen verfassten Historien des Pompeius Trogus (Justin) überliefert worden.93 Wenn wir die unterschiedlichsten Traditionsstränge auf eine Hauptversion hin vereinfachen, so sind dies ihre wesentlichen Züge: Elissa, die Schwester des im phönikischen Tyros regierenden Stadtherrschers Pygmalion, flüchtete aus ihrer Mutterstadt, weil ihr Bruder aus Habgier ihren reichen Ehemann, den Melkartpriester Acherbas, der gleichzeitig ihr Onkel war, umbringen ließ. Nach einer Zwischenstation auf Zypern (Kition) segelte Elissa mit ihrem Anhang zur nordafrikanischen Küste weiter. Dort erhielten die Ankömmlinge von den einheimischen Libyern Gastrecht. Sie überließen ihnen so viel Land, wie sie mithilfe einer zerschnittenen und ausgebreiteten Stierhaut bedecken konnten (Byrsa). Darauf errichteten sie die „Neue Stadt“, denn das ist die wörtliche Bedeutung von Karthago (Qarthadasch), und verpflichteten sich, Tribute an die Erstbesitzer des Landes zu entrichten. Als der Numiderhäuptling Hiarbas Elissa zur Frau nehmen wollte, ging sie in den Freitod, um durch ihr Opfer die Existenz der Stadt zu sichern.94
Eine weitere populäre Lesart der frühkarthagischen Geschichte, in deren Mittelpunkt die Beziehung zwischen Dido (so heißt nun Elissa) und Aeneas rückt, stammt vom römischen Dichter Vergil, der Schöpfer einer an Homer orientierten lateinischen Heldensaga, deren Titel Aeneis den Namen ihres Protagonisten verewigte.95 Demnach soll ein Sturm den aus Troja flüchtenden Aeneas, Sohn der Göttin Venus, in das gerade errichtete Karthago verschlagen haben. Ähnlich wie Nausikaa bei den homerischen Phäaken96 nahm Dido den Fremdling gastlich auf, der daraufhin vom Untergang seiner Heimatstadt sowie von den dramatischen Umständen, die dazu geführt hatten, erzählte. Jahrelang hatte der Überlebende aus Troja, von einer Küste zur anderen getrieben, eine beschwerliche Irrfahrt hinter sich gebracht, die nun zu Ende schien, als er Karthago erreichte. Von Venus und Juno angetrieben, entbrannte Dido in Liebe zu Aeneas, die dieser ebenfalls erwiderte. Daraufhin entschloss sie sich, obwohl sie nach dem Tod ihres Mannes Ehelosigkeit geschworen hatte, sich mit dem Fremden zu verbinden. Allein der Göttervater Jupiter hatte andere Pläne mit dem trojanischen Flüchtling. Er sollte nach Italien weiterziehen und dort die Fundamente des römischen Staates errichten: Unversehens eilte Merkur im Auftrag des Jupiters nach Karthago, um Aeneas zum Aufbruch zu bewegen. Nach der Trennung der Liebenden verübte die verzweifelte Dido Selbstmord. Ihr tragisches Ende wirkt wie ein Vorgriff auf den späteren Antagonismus zwischen Rom und Karthago, als Symbol jener unerfüllten Hoffnungen, die an Eintracht und Kooperation statt an Konfrontation und Krieg gemahnten.
Die verschiedenen historischen Schichten dieser farbigen Legenden, die ihren Stoff aus einer griechischen Tragödie entlehnt zu haben scheinen, auseinanderzuhalten, bleibt ein mühevolles Unterfangen, wiewohl sich darüber keine endgültige Klarheit erzielen lässt. Zwar dürften vereinzelte Namen der Handelnden historisch verbürgt sein (etwa Pygmalion als Stadtherrscher von Tyros; auch der Name Elissa ist im Unterschied zu Dido phönikisch), aber sowohl der Rahmen der Erzählungen als auch wesentliche Einzelheiten sind nach griechischen novellistischen Vorbildern gestaltet. Das Szenario für diese Kompositionen wird wohl im sikeliotischen Kulturkreis zu suchen sein, der spätestens seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. rege Beziehungen mit Karthago unterhielt.97 Betrachten wir die Bausteine des vorliegenden Sagenstoffes, so fällt auf, dass es spätere Ereignisse waren, die den Anstoß zur Schaffung einer solch dramaturgisch durchkomponierten Gründungssaga gegeben haben. Die wachsende politische Bedeutung Karthagos verlangte nach einer möglichst langen, ehrwürdigen Vorgeschichte, die durch die außergewöhnlichen Taten seiner Protagonisten geadelt wurde. Beides sollte sowohl die Singularität als auch die exzeptionellen Leistungen der Stadt unterstreichen.
Was sich an historisch verbürgten Tatsachen ermitteln lässt, kann in wenigen Sätzen zusammengefasst werden. Wir beobachten zunächst eine innenpolitische Auseinandersetzung in Tyros, die innerhalb der herrschenden Schichten ausgetragen wurde. Ein Teil des städtischen Adels samt Anhängerschaft („Melkart-Fraktion“) verließ daraufhin die Heimat und wanderte nach Zypern aus. Dort scheiterte das Projekt einer Stadtgründung. Nach einer weiteren Odyssee wurde in Nordafrika ein neuer Versuch unternommen, der wohl erst nach Überwindung beträchtlicher Schwierigkeiten (Tributzahlungen an die Libyer) von Erfolg gekrönt war. Die massive Auswanderung aus der Mutterstadt machte aus der „Neuen Stadt“ mehr als eine Handelsfaktorei, wie sie für die phönikische Ausbreitung im westlichen Mittelmeer typisch ist. Schon aufgrund ihres Bevölkerungspotenzials und ihres überdurchschnittlich großen Siedlungsareals unterschied sich die nordafrikanische Gründung von ihren phönikischen Schwestersiedlungen im Westen.98 Jedenfalls erscheint Karthago von Anfang an als ein selbstbewusstes Gemeinwesen, zwar mit dem phönikischen Mutterland durch religiöse und familiäre Beziehungen verbunden, aber politisch autonom, vergleichbar mit den wichtigsten etruskischen oder griechischen Städten der Region, wie etwa Massalia, Caere oder Syrakus.
Was die Verknüpfung von Dido mit Aeneas betrifft, so ist ihr Befund und Gehalt eindeutiger und politischer. Sie vermittelt eine auf dem Hintergrund der späteren Ereignisse rückblickend konstruierte Version des römisch-karthagischen Dualismus, die bis in die Gründungszeit zurückverlegt wird und eine allegorische Erklärung für die Entstehung einer nachträglich aufgekommenen Konkurrenzsituation liefern soll, etwa nach dem Motto: Aus enttäuschter Liebe erwuchs unbändiger Hass. Gleichzeitig kündet sie von einer frühen Nahbeziehung zwischen Karthago und Rom, die jedoch durch die Macht des Schicksals zerschlagen worden sein soll. Damit deutet sie die Möglichkeit einer friedlichen Übereinkunft an. Aus dieser Perspektive erscheint die sprichwörtliche Rivalität zwischen beiden Gemeinwesen als Ergebnis verpasster Chancen, die allerdings durch das schon seit Urzeiten bestehende Spannungsverhältnis zwischen beiden mythischen Gründungsikonen bereits vorgezeichnet gewesen war.
Wie andere Städte des Altertums besaß auch Rom eine novellistisch durchkomponierte und dramaturgisch ausgemalte Gründungssaga, in deren Mittelpunkt der aus dem brennenden Troja geflüchtete und bei der karthagischen Königin Dido zeitweise weilende Aeneas stand. Auf diese Weise wurde eine Verbindungslinie zur sagenumwobenen Stadt Troja gezogen, die an die Landnahme erinnerte und somit die Verankerung der ersten Bewohner Roms in einem ehrwürdigen, heroischen Kontext betonte. So, wie wir für Rom ein traditionelles Gründungsdatum kennen, das der Heimatforscher Varro auf das Jahr 753 v. Chr. festlegte, so lautet das von Timaios überlieferte Gründungsjahr Karthagos 814 v. Chr. Es erübrigt sich, zu betonen, wie problematisch die von den antiken Autoren errechneten Chronologien sind.99 Für Festlegungen aus der mythisch verklärten Vergangenheit gilt dies in besonderem Maße. In solchen Fällen ist darauf zu achten, ob die literarisch tradierten Ereignisse von weiteren unabhängigen Quellen bestätigt werden können. Richtet man den Blick auf die weitgehend schriftlose Vorzeit, wie dies für die Epoche der Gründung Karthagos der Fall ist, so kann hier nur die archäologische Fundkarte weiterhelfen. Tatsächlich haben die durchgeführten Ausgrabungen in Karthago Materialien aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. zutage gefördert.100 Damit entsteht zwar eine Zeitlücke zwischen den literarischen Zeugnissen und dem archäologischen Befund, aber dies lässt sich vielleicht damit erklären, dass ein zentrales Kriterium für die Aufstellung von chronologischen Tabellen, nämlich die griechische Keramik, im westlichen Mittelmeerraum erst ab dem Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Möglicherweise reflektieren die verhältnismäßig frühen Gründungsdaten unserer literarischen Quellen einen präkolonisatorischen Prozess, also eine längere Phase der Vorbereitung, die von Erkundungsfahrten und Handelskontakten geprägt gewesen sein mag und die der Anlage von festen Siedlungsplätzen vorangegangen sein wird. Wie das für die meisten Kolonialgründungen der Fall ist, sind die ersten Jahrhunderte karthagischer Geschichte in dichten Nebel gehüllt. Deutlicher werden die Konturen der Stadt erst ab dem 6. Jahrhundert v. Chr., als die griechischen Historiker anfingen, sich für die Vorgänge im westlichen Mittelmeerraum stärker zu interessieren, wie die Berichte über die kriegerische Konfrontation zwischen Phökäern, Etruskern und Karthagern in der Schlacht bei Alalia zeigen, die bereits gewürdigt wurde.101