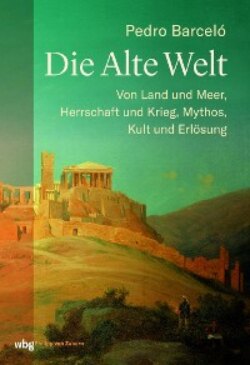Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 29
Kirke und Kalypso
ОглавлениеCirce! Circe! Lächelnd
mit nackten Brüsten
lag sie und rauchte, als ich
vom Meer erzählte.
(Christoph Meckel)
Die Lebenssphären der Nymphe Kalypso und der Zauberin Kirke scheinen von einem Schleier des Unwirklichen, der Magie sowie der dichterischen Imagination umhüllt zu sein. Sie gehören zu den rätselhaftesten Episoden der homerischen Dichtung. Möglicherweise reflektieren die Passagen, die sich mit diesen bemerkenswerten Gestalten beschäftigen, Erinnerungen an längst vergangene Formen menschlicher Existenz. Von Interesse ist aber, dass diese märchenhaften Wesen, eine Mischung aus Urgewalten und femmes fatales, jenseits der sie umgebenden Phantasiewelt, in einer Gemeinschaft leben, die einem organisierten Gemeinwesen zum Verwechseln ähnlich sieht. So wohnt Kirke in einer palastähnlichen Behausung auf der Insel Aiaia, was auf ein abgegrenztes Herrschaftsgebiet verweist, dessen geographische Grenzen von der Phantasie des Betrachters und der Unermesslichkeit des Meeres gesetzt werden. Ferner verfügen Kalypso und Kirke über umfangreiche Vorräte an lebensnotwendigen Ressourcen und Güter aller Art, etwa Nahrungsmittel wie Weizen, Honig, Käse, Fleisch, Wein und vieles mehr, welche in den Vorratskammern ihrer Residenzen aufbewahrt werden, was wiederum auf eine planvoll betriebene Landwirtschaft in einer organisierten Gemeinschaft hindeutet, in der Arbeitsteilung nicht unbekannt war. Auch vermag Kirke, in Analogie zur Rolle des Odysseus gegenüber seinen Gefährten, eine unanfechtbare Autorität über ein anonymes weibliches Kollektiv, das ihren Befehlen Folge leistet, auszuüben. So ergibt sich aus dem Vergleich der Verhaltensmuster des Odysseus und der Kirke eine Reihe von hierarchischen Referenzen, die sich in eine soziale Dynamik einschreiben, welche die abgeschlossene Gesellschaft der Insel Aiaia mit der anders gearteten Lebenswirklichkeit des Odysseus verbindet. Die Begegnung beider Welten lebt aber auch von den Gegensätzen, Spannungen und Gewaltpotenzialen, welche die unterschiedlichen Lebensentwürfe der konfrontierten Gruppen umrahmen. Dabei lässt sich eine Vermischung uralter Relikte mit dem ewigen menschlichen Traum von der Beherrschung der Natur beobachten, hier negativ abgewandelt in der Verwandlung der Gefährten des Odysseus zu Schweinen, wie die tragische Begegnung zwischen den antagonistischen Welten drastisch versinnbildlicht: Und sie fanden im Tal der Kirke Häuser gebaut aus zugehauenen Steinen in rings umhegtem Gelände (…). Kirke aber führte sie hinein und ließ sie auf Sessel und Throne sitzen, Käse und Mehl und gelben Honig verrührend mit pramneischem Wein; doch mischte sie noch in die Speise böse Kräuter, damit sie das Vaterland gänzlich vergäßen. Aber nachdem sie es gegeben und die es getrunken, da schlug sie gleich mit der Gerte an und sperrte sie ein in den Kofen. Die nun hatten von Schweinen die Köpfe, die Stimme, die Borsten und die Gestalt; jedoch der Verstand blieb ständig wie früher.34
Oder um ein weiteres Bild magischer Betörung zu bemühen: Der unfreiwillige Aufenthalt, den Odysseus im Umfeld von Kalypso erleidet, hält die Spannung zwischen den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, die hier aufeinander prallen, aufrecht, allerdings ohne sie aufzuheben. Die Vermittlung eines paradigmatischen Tauziehens zwischen konkurrierenden Schicksalsmächten, die sich anziehen und zugleich abstoßen, gerät zum retardierenden Handlungsmotiv. Ausgangspunkt bleibt die halberzwungene Gefangenschaft des Odysseus, die ungewöhnlich lange Zeit währt und traumhafte, zuweilen auch hedonistische Züge aufweist. Doch plötzlich wird der Zauber der Verführung gebrochen. Nun vermag der vom Bann der Nymphe befreite Held sich endlich seiner Bestimmung zuzuwenden: der Rückkehr nach Hause, womit der Fortgang seiner Odyssee um eine weitere Etappe verlängert wird. Nach der anheimelnden Grotte der Kalypso winkt die kalte, spannungsgeladene Realität Ithakas als ersehntes Ziel. Doch noch hat unser Held eine rastlose Wanderschaft vor sich, deren Richtung ungewiss bleibt; ihm werden andere verwandte Gestalten nacheifern, wie etwa Egmont, der auf seiner Suche nach Sinn und Orientierung bekennt: Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts, als mutig gefasst die Zügel festzuhalten, und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam. (Goethe, Egmont).