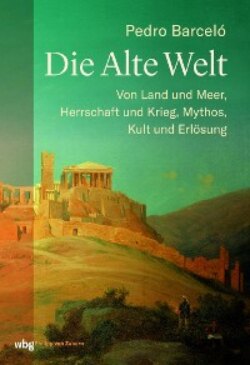Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 32
3 Demokratischer Mythos
ОглавлениеEs gehört zu den Paradoxien der athenischen Demokratie, dass sie auf die Tyrannis stärker fokussiert war, als dies auf den ersten Blick erscheinen mag. Die wesentlichen Informationen darüber verdanken wir dem Historiker Thukydides, dessen Bericht als Exkurs in die ausführlich abgehandelte Alkibiadesepisode eingearbeitet ist:38 Ein unwissender, misstrauischer Demos sträubte sich gegen außergewöhnliche Persönlichkeiten, die schließlich scheiterten. Ferner betont Thukydides, dass es nicht die Athener, sondern die Spartaner waren, die für Hippias’ Vertreibung sorgten. Ähnlich wie Alkibiades musste dieser in die Verbannung gehen und ebenso wie jener versuchte dieser, mit fremder Hilfe seine Rückkehr zu erzwingen.39 Die Einblendungen über das Wesen der Tyrannis sind alles andere als negativ. Von Peisistratos heißt es, dass er als geachteter Staatsmann40 gestorben sei. Sein Regiment bedrückte weder die Menge, noch verursachte es Ärgernis. Erst nach der Ermordung des Hipparchos veränderte sich der Charakter der Herrschaft. Sie wurde als unerträglich empfunden. Mit der Hilfe von Sparta vermochten die Alkmeoniden Hippias aus Athen zu verjagen, womit die Tyrannis ihr Ende fand. Thukydides’ Bemerkungen zum Peisistratidenregiment zeigen, dass es nicht als Gegenentwurf zur solonischen Polis, sondern als eine Variante der Machtausübung innerhalb der geltenden Verfassung empfunden wurde. Daher bewirkte die Entfernung des Hippias aus Athen keinen konstitutionellen Wandel. Die Vorstellung der Peisistratidenherrschaft als ein dem Wesen der Polisgemeinschaft konträrer Regierungsentwurf ist ein Ergebnis der fortschreitenden demokratischen Entwicklung Athens, als man anfing, die Tyrannis vom Standpunkt der Volksherrschaft aus rückblickend zu bewerten.
Den für die Überwindung der Tyrannis maßgeblichen Adelsrivalitäten – hier spielten die Alkmeoniden41 eine entscheidende Rolle – maß Thukydides keine besondere Bedeutung bei. Ganz anders dachte Herodot darüber. Nach seinem Bericht waren es gerade diese, welche die Initiative ergriffen, und Sparta sekundierte dabei, um ihre Rückkehr nach Athen zu ermöglichen. Diese Einschätzung steht im Widerspruch zur thukydideischen Version über die Vertreibung des Hippias. Nachdem es nicht der Demos war, der sich seiner entledigte, bleibt nur Sparta übrig. Doch hier sind Zweifel angebracht. Sparta engagierte sich in Athen, wie übrigens zuvor in Samos oder Naxos, auf Betreiben von befreundeten aristokratischen Kreisen, die ihre verlorene Machtstellung in der Heimat mit seiner Hilfe wiederzugewinnen trachteten. Bei den Vorgängen, die zur Verbannung der Tyrannen führten, sprechen die von Sparta erlittene Niederlage bei Phaleron sowie der schlecht vorbereitete Feldzug gegen Hippias gegen einen starken Protagonismus der Spartaner.42 Entscheidend wurden die aus dem Exil agierenden Alkmeoniden, denen es gelang, Kleomenes für ihr Vorhaben einzuspannen. Es drängt sich die Vermutung auf, dass die Führungsrolle43, die Thukydides Sparta zuweist, ein Zugeständnis an die verbreitete Vorstellung von der Tyrannenfeindlichkeit des lakedämonischen Staates war. Das stets tyrannenfrei gebliebene Sparta wird zum natürlichen Feind der Tyrannis stilisiert.44 Aber diese Vorstellung hält einer kritischen Prüfung nicht stand. Sie beruht auf einer Legende.45
Als die Leistungen der Peisistratiden gewürdigt und dabei ihre bürgerfreundlichen Maßnahmen hervorgehoben werden, heißt es, dass diese weder die Gesetze noch die Institutionen der Polis angetastet hatten.46 Demnach stand der Peisistratidenclan neben den politischen Organen der Stadt. Offenbar übte er seinen Einfluss, der auf der Kontrolle der politischen Schaltstellen beruhte, indirekt aus, mittels Verbündeter und Anhänger.47
Einzelne Mitglieder der Familie mochten herrisch oder jovial nach außen hin auftreten. Als unumschränkte Herrscher, denen alle gehorchten, empfanden sie die Zeitgenossen (sicher nicht alle) jedoch kaum. In den Augen des Thukydides kam Hippias dem Bild nahe, das sich zu seiner Zeit über die Peisistratidenära verfestigt hatte. Für einen Teil der Athener war es dagegen Hipparchos, der die diesbezüglichen Vorstellungen adäquater erfüllte. Daraus lässt sich folgern, dass die Söhne nach dem Tod des Vaters die von ihm geschaffene führende Position im Staat auszufüllen versuchten. Wie diese sie ausübten, lässt sich nicht mehr ermitteln.48 Jedenfalls bedeutete die Ermordung des Hipparchos einen tiefen Einschnitt. Dieser Wendepunkt war es gewesen, der die Peisistratidendominanz in einem negativen Licht erscheinen ließ: Hippias wurde ihr Symbol. Da er es war, der für die Gewaltmaßnahmen, die der Ermordung seines Bruders folgten, verantwortlich zeichnete, konnte er im Gedächtnis der Nachwelt schlecht als Synonym der bürgerfreundlichen Tyranniszeit gelten. Diese frühere Epoche wurde mit Hipparchos in Zusammenhang gebracht, der einen Kreis von Künstlern und Intellektuellen (Anakreon, Simonides) um sich sammelte. Ihre Namen standen für Literatur oder Kunst, nicht für Gewalt.49
Insofern kann man Thukydides verstehen, wenn er in Hippias den maßgeblichen Protagonisten erblickte,50 während die in der kollektiven Erinnerung der Athener dem Hipparchos zugeschriebene Rolle ein differenziertes Urteil über die Gesamtheit des Peisistratidenregimes zum Ausdruck brachte. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen resultierten aus der Ambivalenz der Situation. Obwohl stets ein prominentes Mitglied der Sippe im Vordergrund stand, war die Tyrannis ein Familienunternehmen.51 Durch die Zusammenarbeit des gesamten Clans kam Peisistratos an die Macht52, nach der Gefangennahme seiner nächsten Verwandten gab Hippias auf, da die Grundlagen seiner Machtstellung beeinträchtigt worden waren. Den thukydideischen Reflexionen über die Peisistratidenzeit steht die Evidenz eines in Athen nachhaltig wirkenden Tyrannentraumas gegenüber53, wie die Aufstellung eines Standbildes zu Ehren der Tyrannenmörder belegt. Diese Stimmungslage ebbte keineswegs mit zunehmendem Abstand zur Peisistratidenära ab, sondern erreichte auf dem Höhepunkt der demokratischen Entwicklung Athens eine besondere Virulenz. Gewiss stand die Tyrannenfeindlichkeit zunächst in direktem Bezug zur Rolle des Hippias während der Perserkriege. Beim Invasionsversuch von Marathon befand er sich beim Perserheer und war bereit, seine Herrschaft über die Stadt zu erneuern.54 Perserfurcht und Tyrannisablehnung verschmolzen damals zu einem komplementären Begriffspaar. Der Aufstieg Athens zum schlagkräftigsten Machtblock der griechischen Welt minderte jedoch die Gefahr einer persischen Aggression55, womit jener Tyrannenangst, die im Zusammenhang mit der Persergefahr aufkam, der Nährboden entzogen wurde.56 Deutlich erkennbar wird hier die Abkehr von einer historischen Sichtweise bei gleichzeitiger Zunahme einer mythischen Vereinnahmung der Vergangenheit.
Am Anfang stand ein Mord aus Eifersucht: Hipparchos wurde von Aristogeiton und Harmodios niedergestreckt. Daraufhin straffte sein Bruder Hippias die Zügel, weswegen er bald verhasst und seine bislang als erträglich empfundene Machtausübung so drückend wurde, dass man seine Vertreibung als Befreiung empfand. Die Regentschaft der Peisistratiden hatte sich durch Gewaltausübung diskreditiert. Schon bald verblasste der eigentliche Grund für den Mord (eine Liebesaffäre), und es erfolgte eine heroische Umdeutung des banalen Geschehens: Aristogeiton und Harmodios wurden von Mördern zu Tyrannentötern, ja zu Freiheitshelden im Kampf gegen die Alleinherrschaft. Die ursprünglichen Rächer einer privaten ménage à trois verwandelten sich zu politischen Überzeugungstätern. Es war nur folgerichtig, dass diese Heldentat im Sinne einer Selbstvergewisserung der Polis in einem Denkmal verherrlicht wurde, das der Perserkönig Xerxes nach der Einnahme Athens im Jahr 480 v. Chr. allerdings als Beute mitnehmen und in Susa aufstellen wird. Wenig später erging der Auftrag an Kritios und Nesiotes (477 v. Chr.) die uns heute bekannte Figurengruppe anzufertigen. Es ist die Tat, der man sich bei der Vergegenwärtigung des Kunstwerks jeweils von Neuem eingedenk wurde. Jeder Polite sollte sich mit diesem historischen Akt identifizieren. Kultisch verehrt wurden die Tyrannentöter an ihrem Grab; das Denkmal blieb allein dem ehrenden Gedächtnis des Freiheitswillens vorbehalten. Bezeichnenderweise wurde untersagt, neben besagtem Monument andere Statuen aufzustellen, was einer aus demokratischem Geist geschöpften Monopolisierung der politischen Repräsentation Vorschub leistete. Wie zahlreiche Rituale belegen, gehörten demokratischer Mythos und Tyrannenideologie eng zusammen. Zwar minderte der Aufstieg Athens zum schlagkräftigsten Machtblock der griechischen Welt die Gefahr der persischen Bedrohung, doch das demokratische Selbstwertgefühl verlangte Vorbilder und Identifikationsfaktoren zugleich. In dem Maße, wie Aristogeiton und Harmodios immer mehr zu Stiftern der Freiheit und damit zu Begründern der Demokratie avancierten, wandelten sie sich von historischen zu legendären Gestalten. Als Symbol des freiverfassten Staates nahmen sie einen festen Platz in der Erinnerung der Athener ein. Die negative Vorstellung der Tyrannenherrschaft als Antipode zur positiv konnotierten Volksherrschaft lieferte ein Feindbild und damit eine zusätzliche ideologische Rechtfertigung der athenischen Regierungsform.
Tyrannentöter (477/6 v. Chr.): Standbildgruppe im strengen Stil, Marmorkopie der originalen Bronzegruppe von Kritios und Nesiotes. Höhe: 1,95 m. Fundort: Athen, Agora (Original), heute nicht mehr erhalten; Tivoli, Villa Hadriana (Kopie), jetzt Neapel, Nationalmuseum.57 Die Identifikation der Figuren erfolgte von C. Friedrichs durch Vergleiche mit entsprechenden römischen Münzdarstellungen, auf denen die Einzel figuren abgebildet waren. Ungelöst ist bis heute das Problem, wie die beiden Tyrannentöter als Gruppe aufzustellen sind.
Vor Ausbruch des Peloponnesischen Krieges erfuhr die Infragestellung der athenischen Vormachtstellung58 eine dramatische Zuspitzung, worauf die Athener reagierten: Als die Persergefahr ihre Aktualität einbüßte, musste diese durch andere Drohkulissen ersetzt werden.59 In den Tagen vor und während des Peloponnesischen Krieges erfüllte die Angst vor der Übermacht der Peloponnesier diese Funktion. Die Formel von der Tyrannis als Gegensatz zur Demokratie ließ sich auf Sparta projizieren, indem man den Vorwurf erhob, dass gerade Sparta durch seine demokratiefeindliche Einstellung der Tyrannis Vorschub leistete.60 Das Thema ließ sich innenpolitisch ausschlachten: Nach 424 v. Chr. häufen sich in den Werken des Aristophanes Anspielungen auf die Tyrannis.61 Sie zeigen uns, dass dabei nicht die Erinnerung an die Alleinherrschaft, sondern vielmehr die Furcht vor einer Machtergreifung der spartafreundlichen athenischen Oligarchen das Motiv für die Skandalisierung der Tyrannis abgab. Aristophanes’ Äußerungen müssen auf dem Hintergrund eines lange dauernden Krieges, der bisher keinen durchgreifenden Erfolg gebracht hatte, gesehen werden. Zugleich ließ die zeitbedingte Abwesenheit der Flotte, des Bollwerks der Demokratie, das Risiko eines oligarchischen Staatsstreiches steigen. Dies zu verhindern, galt als Pflicht eines jeden Politen. Der demokratische Mythos der Athener wachte darüber und rief stets zur Wiederholung einer Befreiungstat auf, wie sie einst Aristogeiton und Harmodios vollbracht hatten.
Als eine Reihe von Rückschlägen im Peloponnesischen Krieg die Stabilität der athenischen Verfassung aushöhlte, wendete sich das Blatt. Das in der Überhöhung der demokratischen Ordnung eingeschlossene Verdammungsurteil der Peisistratiden verlor an Attraktivität. Der am Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. zunehmende Überdruss gegen die Machtanmaßungen der Vielen machte sich auf der Suche nach neuen politischen Konzepten daran, die Tyrannis neu zu entdecken. Aus dem maßvollen Verhalten des Peisistratos bei Herodot und aus der synesis und arete des thukydideischen Peisistratos rückt in der aristotelischen Schrift über den Staat der Athener die Tyrannis in die Nähe des Goldenen Zeitalters62, und im platonischen Dialog Hipparchos wird dem ermordeten Peisistratiden gar ein Denkmal gesetzt.63 Die aus demokratischem Legitimierungszwang heraus aufgekommene Mythisierung der Tyrannenmörder konnte in Krisenzeiten zu einer Idealisierung der Einzelherrschaft umschlagen, womit die Tyrannenfeindlichkeit als Klammer für den demokratischen Mythos der Athener zunehmend ihre Strahlkraft einbüßte.