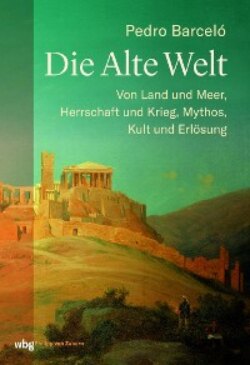Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 30
Zyklopen
ОглавлениеAch! Meine Seele ward betrübt
Wie des Odysseus Seele,
Als er gehört, dass Polyphem
Den Felsblock schob vor die Höhle.
(Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen)
Es entbehrt nicht der Ironie, dass ausgerechnet die abnorme Gestalt des riesigen einäugigen Polyphem, ein Sohn des Poseidon, der eigenbrötlerisch in einer Höhle mit seinen Schafen für sich alleine lebt, aber dennoch nicht einsam ist, nicht nur als Lehrbeispiel für die Vermittlung der Diskrepanz zwischen Kultur und Barbarei, sondern vielmehr als Momentaufnahme für die Formung des politischen Bewusstseins dienen kann. Dies wird durch eine auf den ersten Blick verborgene politische Prägung der Welt der Zyklopen ermöglicht, die sich innerhalb eines öffentlichen Raumes (weitere Zyklopen wohnen in der unmittelbaren Umgebung des ausführlich gezeichneten Polyphems) entfaltet, der sich durch Heranziehung der verfügbaren Auskünfte, welche die Episode liefert, erschließen lässt. Am deutlichsten belegt dies jene Szene, als Polyphem, geblendet vom listigen Odysseus, der mit seinen Gefährten in seine Höhle eingedrungen war und sich als „Niemand“ vorgestellt hatte, um Hilfe bei seinen Artgenossen nachsucht, die er dennoch nicht erhält. Der Appell an die Gemeinschaft der Zyklopen erweist sich als erfolglos, weil sein Wehklagen „Niemand hat mich geblendet“ wirkungslos bleibt und daher ungehört verhallt.
Odysseus blendet Polyphem. attisch-schwarzfigurige Oinochoe, 6./5. Jh. v. Chr.; Paris, Louvre.
Die Zyklopen bilden eine in sich geschlossene Lebenswelt, in der sich individuelle Lebensentwürfe und Gemeinschaftssinn gegenseitig bedingen und ergänzen. In der Begegnung mit den Gefährten des Odysseus kommen die unterschiedlichen Stimmungslagen des düsteren Höhlenbewohners zum Vorschein. Sie schwanken zwischen der brutalen Rohheit gegenüber Menschen, die in dem makabren Bild der Verspeisung der Gefährten des Odysseus gipfelt, und der gefühlvollen Anteilnahme gegenüber seinen Schafen. Die archaische Vignette des Zyklopendaseins reflektiert einen Zustand politischer Ursprünglichkeit, die sich in den abgelegenen, ländlichen Regionen Griechenlands lange gehalten hat. Im 2. Jahrhundert hat der Reiseschriftsteller Pausanias folgendes Bild der Polis Panopeis festgehalten: Von Chaironeia sind es zwanzig Stadien nach Panopeis, einer phokischen Stadt, wenn man auch einen solchen Ort eine Stadt nennen darf, der weder Amtsgebäude, noch ein Gymnasium, noch ein Theater, noch einen Markt besitzt, nicht einmal Wasser, das in einem Brunnen fließt, sondern wo man in Behausungen, etwa wie den Hütten in den Bergen an einer Schlucht wohnt. Und doch haben sie ihre Landesgrenzen gegen die Nachbarn und schicken ebenfalls Vertreter in die phokische Versammlung.35
Der Pausaniastext wirkt wie eine nachträglich verfasste Illustration des rohen zyklopischen Alltags. Komplementär zu den Zyklopen lassen sich auch die Lebensverhältnisse der Lestrygonen und Kimmerier heranziehen, die ebenfalls in Poleis organisiert waren. Gemeinsam ist diesen Beispielen der Kontrast zwischen den unbändigen Kräften der Natur und den Segnungen der menschlichen Zivilisation. Dies kommt in dem knappen Bericht des Odysseus zum Ausdruck, der durch die Feststellung der Defizite, die in der Lebenswelt der Zyklopen vorherrschten, deren mangelnde Staatlichkeit beklagt: Wir kamen zum Land der Zyklopen, der gewaltigen, gesetzlosen, die, sich auf die Götter verlassend, die unsterblichen, weder Gewächse pflanzen mit den Händen noch pflügen, sondern das wächst alles ungesät und ungepflügt: Weizen und Gerste und Reben, die einen Wein von großen Trauben tragen, und der Regen des Zeus mehrt es ihnen. Sie haben weder ratspflegende Versammlungen (agorai boulephoroi) noch verbindliche Ordnungen (themistes), sondern bewohnen die Häupter der hohen Berge in gewölbten Höhlen und ein jeder setzt die Satzungen fest für seine Kinder und seine Frauen, und sie kümmern sich nicht umeinander.36
All das, was in dem Wohnverband der Zyklopen fehlt, wird als unverzichtbar für die Vorstellung einer zivilisierten, menschenwürdigen Konvivenz erachtet. Folglich sind abgestimmte Wirtschaftsformen, Gesetze, kumulative Beratungen sowie die soziale Interaktion zwischen den Mitgliedern eines solidarischen Gemeinwesens die Bausteine der homerischen Vorstellung eines geordneten, humanen Lebens in der Gemeinschaft. Auffällig ist dabei, dass das Fehlen von Ratsversammlungen, das heißt das Ausbleiben von Meinungsaustausch zwischen den Gliedern einer Lebensgemeinschaft, als Mangel verbucht wird. Regeln, Normen und Absprachen zwischen den Trägern eines politischen Verbands erweisen sich als konstitutive Merkmale einer Öffentlichkeit, die keineswegs als herrschaftsfreier Raum begriffen wird. Obwohl die Machtfrage im Zyklopenstaat nicht ausdrücklich thematisiert wird, ist sie doch implizit in der Kritik an die vorherrschenden anarchischen Verhältnisse stets mitgedacht.