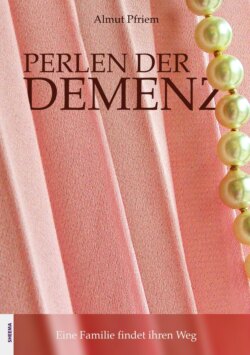Читать книгу Perlen der Demenz - Almut Pfriem - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 13
Wir sind so lange stark, bis wir unserer Schwäche begegnen. Aus dieser Schwäche wächst unsere wirkliche Stärke.
Ulrike Dietmann
SOLLEN WIR JETZT WEINEN ODER LACHEN?
Taps, tapstaps, taps, taps … höre ich Mami im Nebenzimmer hin und her laufen. Die Sonne ist schon aufgegangen. Ich, immer noch müde, höre es widerwillig.
Taps, tapstaps, taps …
‚Oh nein!‘, denke ich. Aber es hilft alles nichts: Ich muss raus aus dem Bett. Ich gehe erst einmal nach unten und öffne die Eingangstüre. Dann nehme ich den Schlüssel mit nach oben und gehe leise durch unser Zimmer an Bernie vorbei, um ihn nicht zu stören. Er hat den Schlaf jetzt nicht nur verdient, sondern auch nötig!
Leise schließe ich die Türe hinter mir.
„Guten Morgen, Mama, hast du gut geschlafen?“
Sie strahlt mich an, ist bester Laune und dabei, ihre Sachen zu ordnen. Ihr Bett ist schon gemacht.
„Ja, wunderbar! Und du, bist du auch schon wach?“
„Ja“, antworte ich und gähne.
Sie zeigt nach draußen, den Vorhang hat sie auch bereits zur Seite gezogen.
„Das ist ja schön hier! So ein schöner Ausblick. Oh, Kind, ist das schön! Das tut meinen Augen so gut!“
„Siehst du, das habe ich dir doch gesagt: Wenn die Sonne scheint, ist es gar nicht so gruselig.“
„Ja, und hier wohnt ihr jetzt?“
„Nein, das ist nur unser Ferienhaus. Wohnen tun wir in Freiburg.“
„Also, ich würde hier wohnen, wenn ich könnte.“
„Hast du denn Hunger?“
„Nein.“
„Sollen wir uns einen Tee machen?“
„Hier?“
„Nein, unten in der Küche.“
„Eine Küche habt ihr auch noch?“
„Ja, komm, die zeige ich dir jetzt. Wir gehen aber hier raus und ums Haus herum, damit wir Bernie nicht wecken.“
„Ich folge dir, du wirst das schon wissen.“
Ich öffne die Verbindungstüre, die ich heute Nacht verriegelt habe – und nun jede Nacht verriegeln werde —, und bin gespannt … „Hier ist nicht schön“, sagt sie prompt.
„Ja, Mama, hier ist es wirklich nicht schön. Hier ist gerade Baustelle.“
„Aha.“
„Ja, und hier warst du heute Nacht, als du mich gerufen hast.“
„Was hab ich?“
„Mich gerufen, als du vom Bad nicht mehr zurück ins Schlafzimmer gefunden hast.“
„Ja, hier haben die mich eingesperrt.“
„Wer?“
„Die Männer, die haben mir immer gedroht.“
„Ich habe dich ja dann Gott sei Dank gefunden.“
„Aber das war lange!“
„Wie?“
„Ich war lange hier eingesperrt.“
„Oh, Mama, das tut mir leid. Da waren ja auch drei Türen zwischen uns, ich habe dich einfach nicht gehört.“
„Mit drei Türen haben die mich eingesperrt?“
„Nein, da waren drei Türen zwischen dir und mir.“
‚Ich weiß wirklich nicht, wie sie darauf kommt, dass hier Männer waren‘, denke ich. ‚Sind es alte Geschichten, die sie neu erlebt? Oder was hier sieht aus wie Männer?‘
„Gehen wir jetzt?“, fragt sie etwas ungeduldig.
„Ja“, sage ich und öffne erleichtert die Tür.
Es ist ein altes Schloss und klemmt gerne, ich bin froh, dass ich es aufgekriegt habe.
„Warte, Mama, komm, hak dich bei mir ein!“
Langsam dippeln wir gemeinsam durch das vom Tau noch nasse Gras. Ich wähle die fünf Treppenstufen ohne Geländer und weiß sofort: Das war ein Fehler. Besser wäre es gewesen, ich wäre den etwas längeren, aber für sie sichereren, Weg mit ihr gegangen.
„Schau Mama“, ich zeige auf den Weg, der in einer Kurve langsam nach unten vors Haus führt, „dort kannst du dann laufen, wenn niemand da ist, der dir den Arm reichen kann. Hier fehlt ein Geländer bei der Treppe.“
„Ach i wo, ich kann doch wohl Treppen laufen.“
Ich sage nichts‚ das entwickelt sich schon irgendwie in den nächsten Tagen.
„Schau, da geht es wieder rein. Und hier ist unsere Küche.“
„Ui, die ist aber groß und schön. Da kann man aber viel Tee kochen.“
„Ja, das Haus ist auch sehr groß. Ich zeige es dir nachher mal. Hier können achtzehn Menschen schlafen. Es hat drei Bäder und neun Schlafzimmer – da braucht man dann natürlich auch eine große Küche.“
„So viele Menschen sind jetzt da?“, fragt sie plötzlich nervös.
„Nein, Mama. Im Moment sind nur wir drei da: du, Bernie und ich.“
„Ah!“, erleichtert atmet sie auf und strahlt mich an. „Das ist schön. Das freut mich. Im Heim sind immer, immer, immer so viele, viele Menschen. Nur wir drei? Das ist schön!“
„Ja, nächste Woche kommen Ursel und Michel wieder, die sind gerade in Freiburg, weil ihre Tochter Geburtstag hat. Die Woche darauf kommt dann noch Kristin mit ihrer Familie. Aber die magst du ja so gerne.“
„Wer ist das?“
„Das ist die Tochter von Bernie, die dir mal das Gedicht geschenkt hat.“
„Ach die, die so tolle Gedichte schreibt? Ja, die mag ich, die sind toll! Und wer ist die andere?“
„Du meinst Ursel und Michel? Das sind Freunde von uns und sie sind Miteigentümer hier. Weißt du, das Haus gehört uns ja nicht alleine.“
„Ach so.“
Der Tee ist fertig.
„Komm, wir setzen uns ins Kaminzimmer aufs Sofa. Da haben wir es gemütlicher.“
„Oh, Almut, da habt ihr es aber schön hier.“
„Oh ja, Mama, das stimmt, und ich freu mich sehr, dass du das alles sehen und erleben kannst.“
„Ich auch! Urlaub in Frankreich – da haben die ganz schön geschaut, als ich das erzählt habe. Die denken ja oft, ich spinne. Aber diesmal stimmt’s!“, strahlt sie und fährt dann nachdenklich fort: „Weißt du Kind, ich weiß nicht, warum ich das alles erleben muss. Wofür ist so was?“
„Ja, Mama, seitdem wir wissen, dass du Demenz hast, lese ich viel darüber und frage auch meine Lehrer, wenn ich eine Fortbildung habe. Eine Lehrerin hat mir gesagt, dass sie vermutet, dass es viel mit Verdrängen zu tun hat.“
„Aha? Das interessiert mich! So oft denke ich darüber nach. Manchmal geht das, manchmal nicht. Mal ist alles sortiert, dann ist wieder alles durcheinander. Manchmal denke ich dann, dass das Durcheinander sortiert ist, dann passieren immer schlimme Dinge. Manchmal verstehe ich aber, dass es durcheinander ist, und kann mich dabei beobachten – obwohl ich so durcheinander bin. Ach, wie soll ich das erklären, was ich selbst nicht verstehe? Was sagt deine Lehrerin?“
„Also, es ist doch auffällig, dass es zur Zeit mehr und mehr Menschen gibt, die diese Krankheit haben.“
„Ja.“
„Und es kann nicht nur damit zu tun haben, ob man geistig aktiv war oder nicht. Diese Meinung hatte ich bisher. Aber dann hättest du sie ja nicht bekommen, diese Krankheit, so viele Bücher, wie du gelesen hast.“
„Ja, da hast du recht!“
„Also, was ist die Ursache? Krankheiten sind ja immer sehr komplex. Die Demenz ganz begreifen werden wir wohl nicht so schnell. Aber eine Komponente könnte das schon sein, was meine Lehrerin da gesagt hat. Also sie meint, dass eure Generation nach dem Krieg keine Zeit hatte, um all das Schlimme zu verarbeiten. Ihr habt eure Gefühle unter Kontrolle halten müssen und das habt ihr getan, indem ihr sie verdrängt habt.“
Sie nickt und folgt mir aufmerksam.
„Ihr konntet nicht darüber reden. All die Bilder, die ihr gesehen habt, all den Schmerz, den ihr erlebt habt, all die Verluste. Jeder musste alleine damit klarkommen. Man hat darüber nicht gesprochen. Ihr ward die Generation, die Deutschland wiederaufbauen musste, da war keine Zeit für Gefühle solcher Art. Ihr musstet, mehr noch, mit all dem klarkommen, was da ohne oder eben auch mit eurem Wissen in Deutschland passiert ist. Es war zwar endlich Frieden, aber es war eine Zeit großer Unsicherheiten und großer Scham.“
„Oh ja, oh Kind, wir haben viel erlebt und mussten viel aushalten. Und Frieden war ja gar nicht, nur Waffenstillstand, bis heute, nur Waffenstillstand.“
„Ja, ich weiß“, sage ich und denke:
‚Oft hat sie mir das schon gesagt und immer schon wollte ich mal nachfragen. Das muss ich jetzt endlich mal machen!‘, und fahre fort: „Also, und wie habt ihr das geschafft? Indem ihr eure Gefühle kontrolliert habt. Und wie kontrolliert man Gefühle? Mit dem Verstand. Und dieser wird euch nun genommen. Und was passiert? All eure verdrängten Gefühle schicken euch durch die Achterbahn.“
„Oh ja, das stimmt! Das stimmt! Und das soll gut sein?“
„Tja, weißt du, um traumatische Erlebnisse zu heilen, bedarf es auch der Gefühle, da reicht der Verstand nicht aus. Das kann man mit dem Denken alleine nicht lösen. Da kann einem der Verstand sogar im Weg sein. Aber du weißt ja auch, dass du all die Knoten, die du hier noch löst, nicht mehr mitnehmen musst.“
„Ja, das weiß ich.“
„Und das ist, glaube ich, ein Grund, eine Facette dieser komplexen Krankheit.“
„Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Das ist aber sehr interessant. Danke, Kind, dass du mir das erzählst. Aha, ja, das macht einen Sinn. Aber warum muss ich mich selbst dabei verlieren?“
„Tust du das denn?“
„Ja, da hast du recht. Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage.“
Sie schweigt eine Weile und überlegt.
„Ja und nein“, sagt sie schließlich.
„Wie? Ja und nein …“
„Also, ich verliere mich und obwohl ich mich verliere, kriege ich es ja mit, also muss ich ja irgendwo noch sein.“
„Ja, weißt du, Mama, du hast es mir ja oft gesagt. Denken, Fühlen und Wollen, alles spielt zusammen, hilft uns und will uns zeigen, dass wir doch so viel mehr sind als das, was wir gemeinhin denken. Rudolf Steiner spricht doch von einem physischen Körper, einem Ätherkörper, einem Astralkörper und so weiter. Wenn wir uns das Ganze aus dieser Gedankenwelt heraus anschauen, dann stelle ich es mir so vor: Hier im Alltagsgeschehen verlierst du tatsächlich die Orientierung, in anderen Schichten deines Seins aber eben nicht. Aus dieser anderen Perspektive hast du einen größeren Radius, der dich die Dinge wiederum erkennen und auch verstehen lässt. Dort bleibst du also klar.
So, wie du vorher auch gesagt hast. Manchmal verstehe ich, dass es durcheinander ist, und kann mich beobachten dabei – obwohl ich so durcheinander bin. Oder eben: Ich verliere mich und obwohl ich mich verliere, kriege ich es mit. So hast du es doch gerade gesagt, oder?“
„Hab ich?“, fragt sie mich und ich befürchte, dass ihre Konzentration jetzt wieder nachlässt.
„Ja“, sage ich daher schnell, „und weißt du, dein höheres Selbst oder wie immer du das nennen magst, also dieser Kern in dir, der ist und bleibt, glaube ich, immer gesund. Und von diesem Kern oder von diesem Ort des höheren Selbst aus kannst du sogar verstehen, warum du das erlebst.“
„Oh, Kind, wie klug du bist! Ja, das stimmt. Manchmal weiß ich direkt, dass ich das erleben soll. Dann ist es leichter. Manchmal aber ist es wirklich, wirklich, wirklich fürchterlich, dann weiß ich …“, sie stockt und überlegt angestrengt, „weiß ich es eben nicht!“, fährt sie etwas trotzig fort. „Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles mache. Eine ganz andere bin ich dann, eine ganz andere, die kenn ich gar nicht.“
„Oh ja, Mama, das kann ich mir tatsächlich nicht wirklich vorstellen und es tut mir so leid, dass du das erleben musst.“
„Ja, nicht alles, was wir erleben, hätten wir uns selber ausgesucht. Du weißt das ja gut.“
„Da hast du recht. Ich weiß das gut. Ich weiß aber inzwischen auch, dass alles, was ich erlebt habe, für etwas gut war. Wie soll ich sagen, also all das, was ich erlebt habe, hat mich zu der werden lassen, die ich heute bin. Und manches, was ich erlebt habe, hilft mir heute, die Menschen besser zu verstehen, die zu mir als Therapeutin kommen. Ganz einfach, weil ich nachfühlen kann, wie sie sich fühlen. Weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, wenn man existenzielle Angst hat oder eben verzweifelt ist oder so traurig, dass man gar nichts mehr will. Und so glaube ich, ist das bei dir eben auch. Irgendwie glaube ich tatsächlich daran, dass alles einen Sinn hat.“
„Was?“, fragt sie.
„Ich glaube daran, dass alles einen Sinn hat, Mama.“
„Das ist auch so!“, sagt sie bestimmt.
„Siehst du, dann wird das mit der Demenz doch auch so sein.“
„Ja, das wird wohl so sein. Aber, dass ich mich selbst verliere, dass ich mich selbst verliere …“
„Und ich glaube halt, dass dein Wesen, das, was dich wirklich ausmacht, irgendwo immer dableibt. Von einer anderen Perspektive aus betrachtet immer gesund ist und bleibt. Verstehst du, wie ich das meine?“
„Ja, Kind, natürlich verstehe ich das. Ich habe doch immer versucht, euch das alles zu sagen, und jetzt erklärst du es mir“, staunt sie, „schon komisch!“
Es ist ein Moment der Verbundenheit, den wir genießen. Sie freut sich an meiner Entwicklung – was ich genieße. Sie hingegen genießt, dass ihre Samen Früchte getragen haben. Mein Blick wandert zum Laptop, der vor uns auf dem Tisch liegt. Bernie hat ihn gestern Abend dort hingelegt, weil wir ihn nachher an die Musikanlage anschließen wollen.
„Ach, Mama, schau, das ist ja geschickt“, sage ich und öffne den Laptop. „Da kann ich dir was vorlesen. Hör mal: Dr. Eben Alexander, das ist ein Arzt, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat, nachdem er als wissenschaftlich arbeitender Neurochirurg über Jahre hinweg eben genau dieses Phänomen widerlegen wollte. Er hat ein sehr interessantes Buch über seine Erfahrungen geschrieben. Es heißt: „Blick in die Ewigkeit“. Ich habe mir Zitate aus seinem Buch herausgeschrieben, weil ich es so gut finde. Eines davon passt jetzt zu unserem Gespräch wie die Faust aufs Auge. Warte, ich habe es gleich.“
Ich öffne die Datei, in der ich Zitate sammle.
„Ah, da schau, magst du es hören?“
Sie nickt entschieden. Klar mag sie es hören. Hat sie uns doch immer und immer wieder Bücher über Nahtoderfahrungen ans Herz gelegt.
„Also“, fahre ich fort, „er sagt: Wie auch immer unsere Kämpfe und Leiden in der gegenwärtigen Welt beschaffen sein mögen, sie können die größeren, ewigen Wesen, die wir in Wahrheit sind, nicht berühren. Lachen und Ironie erinnern uns im Grunde daran, dass wir keine Gefangenen dieser Welt sind, sondern vielmehr Reisende, deren Weg durch sie hindurchführt.“
Beide lauschen wir diesem Gedankengang nach. Wir sind schon mittendrin im Prozess des gegenseitigen Verlierens. Wie heilsam ist da dieses Wissen. Was für ein Geschenk, dass wir diese Gedanken noch teilen dürfen.
„Ja, Mami“, sage ich, „und mit diesem deinem ewigen Wesen werde ich auch immer Kontakt halten können, daran glaube ich. Vielleicht nicht mit Worten, aber so ähnlich, wie wir doch auch zu Papa noch Kontakt haben – irgendwie so. Wenn das nach dem Tod funktioniert, dann muss das doch im Leben auch möglich sein, findest du nicht?“
„Oh, Kind, dein Wort in Gottes Ohr! Wenn es so ist, dann ist das schön! Ja, dann ist das wirklich schön. Aber, dass ich mich verlieren muss, das ist schon hart.“
„Ja, Mama, das ist es!“ Ich zeige auf meinen Laptop.
„Aber schau, Albert Einstein sagt: ‚Ich muss bereit sein, das aufzugeben, was ich bin, um zu dem zu werden, was ich sein werde.‘ Ich habe es minimal abgeändert, weil ich es so noch besser finde. Magst du das auch hören?“
Sie lächelt, nickt und sagt nur:
„Ja.“
„Also: Ich muss bereit sein, das aufzugeben, was ich denke zu sein, um zu dem zu werden, was ich bereits bin. Verstehst du? Vielleicht verlierst du dich ja gar nicht, sondern findest dich. Wirst mehr und mehr zu diesem ewigen Wesen?“
„Ja“, sagt sie strahlend, schaut dann jedoch tieftraurig zu Boden und schweigt lange.
„Danke, mein Kind, jetzt hast du mir aber sehr geholfen!“, sagt sie schließlich, nimmt meine Hand und hält sie fest. Beide lassen wir nun unseren Gedanken freien Lauf, während wir schweigend Tee trinken. ‚Damit habe ich jetzt, nach der Nacht, gar nicht gerechnet‘, denke ich. ‚Mit so einem komplizierten Gespräch! Das ist schon der Hammer! Wie geht das, dass sie plötzlich so schwierigen Themen folgen kann, obwohl sie nachher vielleicht nicht mal mehr weiß, dass die Butter unter die Marmelade gehört und nicht umgekehrt? Tja, manchmal ist alles sortiert und manchmal alles durcheinander …‘
„Das freut mich jetzt sehr, dass du mir das alles gesagt hast“, höre ich sie sagen. „Jetzt kann ich es besser annehmen. Weißt du, das ist die allergrößte Herausforderung: das Annehmen, das Schwachsein annehmen. Und all das loslassen, das alles loslassen. Euch zum Beispiel möchte ich gar nicht loslassen.“
Wieder schweigt sie und fährt dann fort:
„Das tut jetzt richtig gut, dass ich das auch mal mit jemandem besprechen kann.“
„Ja, Mama, das tut gut. Mir auch! Und weißt du was? Manchmal glaube ich, dass der, der es zulassen kann, auch schwach zu sein, der ist, der wirklich stark ist.“
Wir drücken uns beide die Hände.
„Sollen wir jetzt weinen oder lachen?“, fragt sie mich da.
„Ach, Mama, da kommt uns jetzt Bernie zu Hilfe. Hörst du ihn? Er kommt gerade die Treppe herunter. Wir machen jetzt Frühstück. Was hältst du davon?“
„Oh ja! Oh ja, oh, ist das schön! Ich freu mich so: Frühstück in Frankreich.“