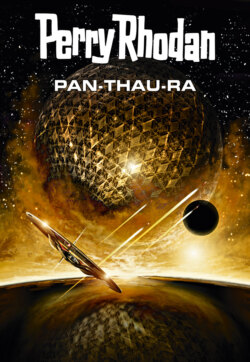Читать книгу Perry Rhodan: Pan-Thau-Ra (Sammelband) - Andreas Brandhorst - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 19
Seine Augen blinzelten langsam – beinahe schon unerträglich langsam. Eines nach dem anderen. Sie waren riesig, nahmen fast die gesamte Fläche des Gesichts des Flachauges ein. Ihre Lider waren aus dickem Fleisch. Haarlos und zerfurcht von einer Landschaft aus Millionen von winzigen Linien. Die Augen waren fest mit dem Körper verbunden. Zumindest schien es so. Der Feind hatte keins von ihnen ausgefahren, und das würde er doch in einer Situation wie dieser, oder? Ein Flachauge also. Ansonsten hätte er versuchen müssen, das Umfeld zu erfassen, sicherstellen, dass ihm nicht die geringste Bewegung entging. An-Keyt musste schließlich die Vorhut einer größeren Einheit sein. Und: Das Flachauge seinerseits musste Kontakt zu seiner eigenen Einheit halten.
Die Augen des Feindes wirkten wie tot. Unbeweglich ruhten sie in ihren Höhlen, ihren Gefängnissen. In langen Abständen blinzelten die Augen, immer nur eines zur gleichen Zeit. Die Lider schienen nicht weniger dick als die übrige Haut, ein fleischiger, natürlicher Panzer. Die Pupillen waren starr auf die Loowerin gerichtet, hielten sie in ihrem Bann.
Die Pupillen und seine Waffe. An-Keyt kannte den Typ, klobig, mit hässlichen runden Formen. Sie hatte ihn schon einmal gesehen. Nach dem Hinterhalt. Die Retter hatten Waffen wie diese getragen. Die Loowerin hatte keine von ihnen in Aktion gesehen, aber ihre Wirkung musste furchtbar sein. Hatten die Retter mit ihrer Hilfe nicht die Flachaugen bezwungen, die An-Keyts Trupp eingekesselt hatten? Aber wie kommt die Waffe dann in die Greifwerkzeuge eines Feindes?, rasten ihre Gedanken weiter. Haben die Flachaugen unsere Elite überwältigt? Kaum vorstellbar. Und zu alarmierend, als dass sie den Gedanken hätte zulassen können. Nein, die Retter mussten die Waffen von den Flachaugen erbeutet oder sie in einem Versteck aufgestöbert haben. Die Standardausstattung der Flachaugen eben. So musste es gewesen sein. An-Keyt klammerte sich an den Gedanken, bis ihr aufging, dass der Schluss aus diesem noch erschütternder war: Die Flachaugen waren ihnen technisch überlegen! Wieso sonst würde sich die Elite der Zweidenker mit ihren Waffen ausrüsten? Kein anderer Grund kam in Frage.
An-Keyt hatte ihre Stielaugen auf den Lauf der Waffe geheftet. Als sie auf die metallene Röhre starrte, verschwamm sie, rotierte sie zunehmend schneller. Bis die Loowerin nur noch einen Strudel sah, der sie zu verschlingen drohte. Auf was hatten sie sich nur eingelassen? Niemand hatte erwartet, dass der Krieg für das Leben ein Spaziergang sein würde – daran hatten ihre Ausbilder keinen Zweifel gelassen, und schon gar nicht Kilan-Gerp. »Wer das Leben retten will, muss bereit sein, sich auf den Tod einzulassen«, hatte er verkündet. Und An-Keyt hatte die tiefe, entelechische Wahrheit in seinen Worten erkannt. Die Bereitschaft, alles dem als richtig erkannten Ziel unterzuordnen, Tod zu bringen, um Leben zu retten, war ein Schluss, der in ihrem Tiefenbewusstsein etwas zum Klingen gebracht hatte. »Was ein Ziel in sich selbst hat«, lautet die Essenz der Neo-Entelechie. Einen Krieg zu führen um des Lebens willen – es war An-Keyt als die perfekte Umsetzung des Grundsatzes erschienen. Eine spirituelle Übung.
An-Keyt spürte, wie träge etwas Feuchtes ihren Höcker herunterrann. Ein Spritzer Peschtan. Ja, Spiritualität, dachte sie, eine höhere Bewusstseinsebene, und vergaß für eine Subeinheit die Waffe, die auf sie gerichtet war. Es war ein bitterer Gedanke, aber auch ein befreiender.
Keine entelechische Übung also. Kein Spaziergang. Doch wenigstens der Auftakt ihres Feldzugs hätte müheloser verlaufen müssen. Dies hier, die Eroberung der PAN-THAU-RA, war der erste Schritt. Ein Eröffnungsschachzug, der in aller Schnelle und Entschlossenheit stattzufinden hatte. Ein Vorgeplänkel nur, wenn auch eines, das über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Kriegs entschied.
Die Flachaugen waren nicht die wahren Feinde. Eigentlich waren sie gar keine Feinde, vielmehr Hindernisse auf dem Weg, die es fortzuräumen galt. Mehr nicht. Ernsthafter Widerstand der Hindernisse war niemals eingeplant gewesen, da weder erwartet noch denkbar. Und nun ...
Ein Schnauben holte An-Keyt zurück in die Gegenwart, in den kahlen Gang, der sich in nichts von den unzähligen anderen der PAN-THAU-RA unterschied. Hier sollte sie sterben? Ein Opfer ihrer eigenen Dummheit, die sie dazu gebracht hatte, jenen den Rücken zu kehren, die ihre einzige Sicherheit darstellten?
Der Feind schnaubte ein zweites Mal. Und endlich machte sich An-Keyts entelechische Schulung bemerkbar. Sie wurde ruhiger. Das Zittern ihrer Stielaugen ließ nach, als sie zusehends die Beherrschung zurückgewann, die Angst in einen fernen Winkel ihres Normalbewusstseins verbannte. Ihr Tiefenbewusstsein hätte keine Angst gekannt, aber selbst jetzt, im Angesicht des Todes, entwand es sich ihr. Beruhigende Botenstoffe fluteten durch ihren Körper, stoppten den Tentakel, der sich, wie von eigenem Willen angetrieben, schleichend zu ihrem Waffengurt vorgearbeitet hatte. Eine unsinnige Angstreaktion, die ihren sicheren Tod bedeutet hätte. Der Fremde hätte nur abdrücken müssen, er hatte die Waffe im Anschlag. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass er nicht rechtzeitig feuern würde, hätte An-Keyt kaum eine Chance gehabt. Die Waffe des Flachauges würde selbsttätig feuern, den letzten Willen ihres toten Besitzers ausführen und An-Keyt einäschern.
Gegen seinen Willen? An-Keyt verharrte bei dem Gedanken. War es wirklich der Wille des Fremden, sie zu töten? Eine unerhörte Frage. Seit An-Keyt den Fuß auf das Sporenschiff gesetzt hatte, hatten sie und ihr Trupp – alle Zweidenker, ihres Wissens nach – nichts anderes getan als zu töten. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Seien es Punkte in der Anzeige ihrer Gefechtssysteme oder eingebildete Bewegungen, die die Furcht auf ihre Netzhäute beschworen hatte. Die Feinde ihrerseits flohen, hoben im panischen Verlangen nach Schutz die Gliedmaßen vor die Körper oder erwiderten das Feuer, wenn auch nur selten.
Und dieser Fremde hier, dieses unaussprechlich hässliche Wesen mit seinen flachen Augen und der zerfurchten, haarlosen Haut hatte die Waffe aus wenigen Schritten Entfernung auf sie gerichtet. Er war absoluter Herrscher über ihr Schicksal. Er konnte ihr einen schnellen und schmerzlosen oder einen langsamen und qualvollen Tod bereiten. Ganz, wie es ihm beliebte. Konnte ihr, An-Keyt, die Sühne für all die Leben auflasten, die sie und die ihren an Bord der PAN-THAU-RA genommen hatten.
Sie gehörte ihm. Er musste nur abdrücken.
Und er tat es nicht.
Was war los mit ihm? War seine Waffe defekt? Möglich, aber das würde ihr Gegenüber nicht daran hindern, sie umzubringen. Der Fremde überragte sie um einen Kopf, seine Greif-Gliedmaßen – sie wirkten so ungelenkig, dass An-Keyt vermutete, dass sie auf Knochenbasis beruhten – waren so dick wie ihre stämmigen Loowerbeine und endeten in langen, scharfen Krallen. Nein, es war nicht Mangel an Möglichkeit. Der Fremde konnte ohne Zweifel die wenigen Schritte, die sie trennten, überwinden und sie mit seiner Waffe erschlagen. Sie wäre tot gewesen, bevor sie ihren Schirm aktivieren konnte.
Wenn er es wollte.
Der Fremde gab wieder ein Geräusch von sich, irgendwo zwischen Gurgeln und Schnauben angesiedelt. An-Keyt versuchte festzustellen, woher die Töne kamen, die ihr Gegenüber von sich gab. Vergeblich. Nirgends war eine Blase zu sehen, mit der er die Laute hätte erzeugen können.
An-Keyt nahm ihren ganzen Mut zusammen und rührte sich. Sie ließ ihre Stielaugen auf- und abfahren, musterte den Fremden genau. Er quittierte ihre Aktivität mit einer Serie von Lauten, aber seine Waffe bewegte sich nicht, kein Energiestrahl löste sich aus dem Lauf. Seine Laute brachten An-Keyt auf die entscheidende Spur: Ein Muskelring beinahe ganz an der Spitze, noch über den drei gefangenen Augen des überproportional ausgebildeten Höckers bewegte sich, während er Geräusche erzeugte. Das musste es sein. Als der Fremde wieder etwas sagte – die Lautreihen wurden zusehends länger, es musste sich also um Sprache handeln –, sah sie genau hin und fand ihre Vermutung bestätigt. Der Muskelring öffnete und schloss sich in einer befremdlich anmutenden Synchronität.
»Was willst du von mir?«, fragte sie. Leise. Dennoch schreckte das Wesen auf. Es sprang mit einer Leichtigkeit in die Höhe, die An-Keyt verriet, dass sie mit ihrer Vermutung Recht gehabt hatte: Es konnte sie mühelos mit einem einzigen Sprung erreichten.
Das Wesen kam mit einem polternden Schlag, von dem An-Keyt glaubte, dass er weit zu hören sein musste, schwer auf dem Boden auf. Wo blieb ihr Trupp? Hatte das Peschtan ihren Kameraden so vollständig den Verstand geraubt, dass sie nicht mehr einsatzfähig waren? Das, oder sie befanden sich in einem Amoklauf, um ihre widerlichen Phantasien in die Tat umzusetzen. Aber was war mit dem Helk? Seine Module mussten längst ihr Fehlen bemerkt haben. Wieso griff er nicht ein?
Neue Geräusche von dem Wesen. Fordernder, drängender.
»Ich verstehe dich nicht«, sagte An-Keyt. »Ich spreche deine Sprache nicht.« Sie ging nicht davon aus, dass sie verstanden wurde. Aber es tat gut zu sprechen. Es gab ihr die Illusion zu handeln. Und vielleicht erhöhte es die Hemmschwelle ihres Gegenübers. Es fiel schwerer, ein Wesen zu erschlagen, mit dem man sich unterhalten hatte. Selbst dann, wenn man dabei kein Wort verstanden hatte.
Dennoch: Ihre Antwort stellte ihr Gegenüber nicht zufrieden. Der Fremde gestikulierte mit den freien Armen – es waren vier – und schlug mit ihnen um sich.
Will er mich als Gefangene?
Es war ein Gedanke, der An-Keyt mit einer Verspätung erfasste, die sie verblüffte. Es war so offensichtlich. Das Flachauge hatte sie nicht getötet. Dafür konnte es nur einen Grund geben: Der Fremde wollte sie lebend.
An-Keyt fragte sich, ob die Bewohner der PAN-THAU-RA so etwas wie Peschtan kannten. Sie wäre nicht überrascht gewesen. Nein. Im Gegenteil, es hätte sie überrascht, kannten sie es nicht. Vielleicht hatte dieser Fremde seinen eigenen Trupp mit dem Versprechen verlassen, einen Feind heranzuschaffen, an dem sie sich ausleben konnten. Und sie, An-Keyt, war ihm in ihrer grenzenlosen Dummheit in die Arme gelaufen. Die Loowerin erinnerte sich an ihren Schwur, nicht auf der PAN-THAU-RA zu sterben. Wie töricht zu glauben, dass ein Vorsatz allein genügen konnte. Wie un-entelechisch! Ein kaltes Gefühl machte sich in An-Keyt breit. In gewisser Weise hatte sie verdient, was dieses Wesen und seine Gefährten mit ihr anstellen würden. Es war die Strafe dafür, dass sie aus der Reihe getanzt war.
Der Fremde schnaubte wieder.
»Schon gut«, sagte An-Keyt schicksalsergeben. Sie hatte sich selbst zuzuschreiben, was nun geschehen würde. »Schon gut. Ich komme ja mit.«
Sie zog Tentakel und Flughäute ein, senkte den Oberkörper in einer Geste der Unterwerfung. Hier, nimm mich!, schrie ihr Körper. Ich gehöre dir!
Der Fremde verstand sie auch jetzt noch nicht, da sie ohne Worte zu ihm sprach. Er machte keine Anstalten, ihr die Waffe abzunehmen oder sie zu fesseln. Ja nicht einmal, ihr die Richtung anzuzeigen, in die sie gehen sollte.
An-Keyt hob vorsichtig ein Stielauge. Der Fremde fuchtelte jetzt mit der Waffe, begleitete seine Gesten mit einem ununterbrochenen Strom merkwürdiger, rauer Laute, die aus seinem obszönen Sprechmuskel drangen. Und zum ersten Mal glaubte An-Keyt ihn zumindest in Ansätzen zu verstehen: Er war nicht zufrieden mit dem, was sie tat. Nicht im geringsten. Der Fremde gestikulierte weiter, heftiger. Als brenne in ihm eine Wut, die versuchte, sich auf diesem unbeholfenen Weg Luft zu machen.
»Bitte«, sagte An-Keyt. »Ich versuche ja, dich zu verstehen. Ich brauche nur ein Zeichen, nur ...«
Es war, als hätte der Fremde ihre Worte verstanden. Das Schlagen seiner Glieder kam zu einem abrupten Halt. Das Beben, das seinen Körper erfasst und sich auf den Lauf der Waffe ausgedehnt hatte, klang ab. Der Fremde streckte den Waffenarm ganz aus, zielte auf ihren Höckerwulst und zischte scharf.
Es war der Befehl, auf den An-Keyt gewartet hatte. Sie schob einen Fuß vor, um den ersten Schritt in die Gefangenschaft zu machen.
Ein Zischen stoppte sie, ließ ihren Fuß in der Luft hängen. Der Fremde fixierte sie mit seinen starren Augen, machte mit dem Lauf der Waffe eine kreisende Bewegung, gefolgt von einem Schieben.
An-Keyt verstand. Dreh dich um! Verschwinde!
Die Körperhaare der Loowerin erbebten. Sie machte auf dem Absatz kehrt, in einer Bewegung von einer Eleganz und Schnelligkeit, von der die Flachaugen nur träumen konnten. Ihr Rückgrat, das einem Scharnier glich, machte es ihr möglich.
Sie ging los. Setzte einen Fuß vor den anderen. Konzentriert, als balanciere sie auf einem dünnen Seil über einem Abgrund. Ihre Rückenhaare waren in Aufruhr, juckten mit einer solchen Intensität, dass der Drang, sich mit den Greiflappen – oder wenigstens den Flughäuten! – zu kratzen, beinahe übermächtig war. An-Keyt widerstand ihm. Widerstand auch dem Impuls, ein Stielauge zu drehen, um zu sehen, was der Fremde hinter ihrem Rücken tat. Es war ein furchtbares Gefühl, die totale Ohnmacht. Loower waren Rundumsicht gewohnt, sie kannten keinen toten Winkel, keinen »Rücken«.
Weiter ging An-Keyt, immer weiter.
Was ist das für ein Wesen?, fragte sie sich, im festen Glauben, ihre letzten Augenblicke zu erleben. Was ist das für ein Wesen, das es nicht fertig bringt, einen Feind, eines der Wesen, die seinesgleichen ausrotten wie Ungeziefer, aus nächster Nähe zu töten? Es nicht ertragen konnte, ihm ins Auge zu sehen?
Die Loowerin gelangte an das Ende des Ganges, die Einmündung in einen anderen, breiteren Korridor. Der Augenblick ihres Todes war gekommen. Ein Tod, schändlicher, als sie ihn sich jemals hätte ausmalen können. Ein Opfer ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Wäre sie eine wahre Zweidenkerin gewesen, hätte sie sich niemals von ihren Kameraden entfernt. Wäre sie dem Fremden im Schutz ihres Tiefenbewusstseins wenigstens mit Gelassenheit und Würde gegenübergetreten, um einen schnellen und sauberen Tod zu sterben, wäre sie ...
Sie durfte nicht stehen bleiben. Aufs Geratewohl wandte sie sich nach links. Es war egal, welche Richtung sie einschlug, sie würde nicht weiter als ein, zwei Schritte weit kommen.
An-Keyt machte einen Schritt, dann einen zweiten, dritten und vierten. Der Gang mit dem Fremden blieb hinter ihr zurück, kein Energiestrahl bohrte sich in ihren Rücken.
Sie lebte!
Ihre Beine versagten. Sie sackte auf den Boden. Die Wände, die Decke, alles um sie herum drehte sich. An-Keyt stöhnte, schrie. Ihre Glieder schlugen aus, sie zappelte auf dem kühlen Metall wie ein Fisch, den man seinem Element entrissen hatte, bis das protestierende Pochen in ihren überbeanspruchten Muskeln sie erlahmen ließ. An-Keyt holte tief Luft und kroch los, zurück in den Gang, in dem sie um ein Haar gestorben wäre. Hätte sterben müssen.
Der Gang war verlassen.