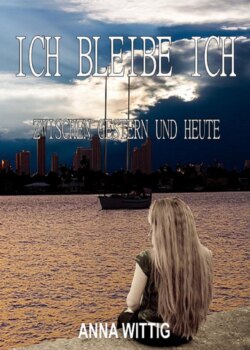Читать книгу Ich bleibe Ich - anna wittig - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12 Berlin
ОглавлениеIm September zog meine „Hippiefamilie“ gen Süden. Zuvor feierten wir zusammen noch meinen achtzehnten Geburtstag. Ich hatte meine Prüfung in der Tasche und einen Job in West-Berlin gefunden. Meine Mutter zog sich in ihre Schmollecke zurück und schwieg, was mir nur recht war.
Claus und Großmutter brachten mich am 1. Oktober zur Bahn. Sie schenkte mir einen Glücksbringer, ein Rosenquarzarmband, an dem noch ein Erdkrümel haftete. Das ließ mich vermuten, dass sie es im Namen von Nerthus oder Danu gesegnet hatte. Es war mit Sicherheit nicht mit christlichem Weihwasser in Berührung gekommen, sondern für eine Weile im Schoß von Mutter Erde gelegen.
Berlin. Was hatten wir uns zu Hause unter dieser Stadt alles vorgestellt. Und wie anders war das, was ich vorfand. Graues Wetter, graue Mauern, graue Menschen. Eine kleinbürgerliche Stadt mit einer biederen Bevölkerung. Darüber täuschten selbst die Nutten am Ku’damm, die Eden-Salons und sonstige In-Läden nicht hinweg. Trotz der kulturellen Angebote, den teuren Geschäften und Restaurants lag über allem ein Hauch von Spießbürgertum. Berlin präsentierte sich weder jung noch hipp. Es dödelte in erschreckender Langsamkeit vor sich hin, auch wenn überall gebaut und gebuddelt wurde.
Zwei ehemalige Kommilitonen von Claus nahmen mich am Bahnhof Zoo in Empfang. Sie lieferten mich in der Kantstraße bei meiner künftigen Zimmerwirtin ab. Frau Liborius bewohnte eine Etagenwohnung im Vorderhaus. Sie verkörperte das 67er Westberlin in grotesker Weise. Professorenwitwe, engstirnig, hochnäsig, der verblichene Gatte in SS-Uniform an der Wand über dem Ohrensessel aus Plüsch. Es war damals üblich, die „Gattinnen“ mit den Titeln ihrer Männer anzureden, selbst wenn sie nie eine Uni von innen gesehen hatten. Diese aufgeblasene Alte bestand ebenfalls darauf. Am mit Meißner Porzellan gedeckten Kaffeetisch kredenzte sie Muckefuck, Apfelkuchen, bei dem man die Äpfel mit der Lupe suchen musste, und die Hausordnung. Ich absolvierte einen Schnellkurs in „Kuppeleigesetzgebung“ und „Männerbesuchsverbot“.
Der von ihr angesprochene Paragraph hatte in etwa folgenden Wortlaut: Das Vorschubleisten zu fremder Unzucht bedeutet das Herbeiführen günstigerer Bedingungen als der bisher vorhandenen.
Das hieß, unverheirateten Paaren war es nicht erlaubt, sich zu zweit allein in einem Zimmer aufzuhalten. Es hätte schließlich zu sexuellen Handlungen kommen können. Ein Weltuntergangsszenario. Dieses bescheuerte Gesetz bestand bis 1974. Es verhinderte nicht, dass es vorehelichen Sex und uneheliche Kinder gab. Gleichwohl leistete es Vorschub für eine Menge unglücklicher Ehen. Das half aber alles nichts, ich musste den Mietvertrag einschließlich der extra hervorgehobenen Textstelle unterschreiben.
Ich versuchte mich einzuleben, was mir mehr schlecht als recht gelang. Abends besuchte ich den Abi-Kurs an der Wirtschaftsakademie, tagsüber litt ich unter der Stutenbissigkeit meiner altjüngferlichen Kolleginnen. Nichtsdestotrotz gelang es mir mit der Zeit, Berlin auch ein paar gute Seiten abzugewinnen. Peter und Jacko stellten mir die Mitbewohner ihrer Studenten-WG vor, mit denen ich die Stadt erkundete, allem voran die Kneipen. Ich lernte Aschingers Erbsensuppe zu lieben. Erkor die „Dicke Wirtin“ und den „Zwiebelfisch“ zu meinen Stammlokalen, hing mit meinen Freunden im „Quasimodo“ ab bei Jazz, Funk und Soul oder ging mit ihnen in einen der Eden-Schuppen zum Abtanzen.
Das Untermietverhältnis mit der „Professorenwitwe“ hielt zweieinhalb Monate. Bis Carsten mir ein Mathebuch vorbeibrachte, und ich ihm einen heißen Tee anbot, da es draußen schweinekalt war. Frau Professor warf mir vor, durch den „Herrenbesuch“ ihren tadellosen Ruf beschmutzt zu haben. Sie kündigte mir fristlos. Da ich sowieso ab 1. Januar 1968 ein Zimmer in der WG meiner Freunde beziehen wollte, kam mir das sehr gelegen. Die restlichen vierzehn Tage überbrückte ich bei Moni, einer Freundin aus dem Hinterhaus.
13 Meine Freundin Moni
Moni Kramer, eine zierliche Rothaarige, in handgestricktem Rolli, Jeans und Stiefeln, lernte ich vor der Haustür kennen. „Wenn dir die Witwe auf den Keks geht, besuch mich.“ Sie hatte ein unverschämtes Grinsen in ihrem spitzen Gesicht und zu viele Zähne in ihrem breiten Mund. Die Frau gefiel mir. Außerdem war sie, abgesehen von meinen WG-Freunden, eindeutig der freundlichste Mensch, der mir bislang in Berlin begegnet war.
Moni wohnte im Hinterhaus, erster Stock, zwei Zimmer, Küche, Bad, Einrichtung Sperrmüll, ein gemütliches Kunterbunt. Wir verbrachten unseren ersten gemeinsamen Abend bei Spaghetti mit Tomatensoße und Reibekäse. Dazu tranken wir zwei Flaschen Schaumwein, Aldi-Sekt, die billige Sorte.
Sie arbeitete hauptberuflich als Kostümbildnerin am Theater des Westens und nebenbei auch für kleinere Bühnen. Moni wurde 1911 in Berlin geboren. Da hatte ich mich heftig verschätzt. In ihren Existenzialistenklamotten, mit den kurzen roten Locken sah sie aus wie Anfang vierzig. Sie war die einzige Tochter eines Schreinermeisters. Die Mutter starb bei ihrer Geburt, weshalb sie bei den Großeltern aufwuchs. Die Familie hatte einen sozialdemokratischen Hintergrund, was den nationalsozialistischen Nachbarn nicht sonderlich gefiel.
Moni schloss sich 1939 einer Widerstandsgruppe an, die mit anderen Gruppierungen unter der Bezeichnung „Rote Kapelle“ zusammengefasst wurde. 1942 erwischte die Gestapo sie beim Verteilen von regimekritischen Flugblättern und verhaftete sie. Moni saß bis kurz vor Kriegsende im Bau. Ihre Großeltern starben unter dem Bombenhagel im Februar 1945. Ihr Vater wurde vermisst, ihr Mann fiel bei Stalingrad: Drittes Reich, ein Schicksal wie aus dem Lehrbuch. Glücklich darüber Gefangenschaft und Nazihölle überlebt zu haben, jubelte sie bei der Alliiertenparade 1945 den „Befreiern“ zu. Sie verschenkte Blümchen an die Soldaten und fuhr eine kurze Strecke auf einem Panzer mit. Die ehrbaren Mitbürgerinnen nannten sie daraufhin „Soldatenflittchen“.
„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sichs gänzlich ungeniert“, grinste Moni. Dermaßen abgestempelt machte sie aus der Not eine Tugend. Sie freundete sich mit drei Amerikanern an, für die sie wusch und kochte. Wofür sie ansonsten zur Verfügung stand? Wen geht das etwas an? Die Jungs versorgten sie mit allem, was sie zum Leben brauchte. Obendrein mit Zigaretten, Schokolade, Kaffee, Whisky und Nylonstrümpfen, was ihr ein zusätzliches Einkommen auf dem Schwarzmarkt bescherte, das sie großzügig mit anderen teilte. Die Kontakte, die sie hierbei knüpfte, erwiesen sich als wertvoll. Sobald die Theater wieder öffneten, bot man ihr einen Job an. Moni war dankbar, dass sie überlebt hatte. Ihre beste Freundin aus Kindertagen verreckte elend in einem Lagerbordell. Der Gedanke daran verfolgte sie, obwohl Jahre dazwischen lagen.
Moni brachte der Jugend viel Verständnis entgegen. Besonders unterstützenswert fand sie ihre Forderung nach der Aufarbeitung der nationalsozialisten Vergangenheit, ihr Streben nach mehr Freiheit und den Ruf nach der Abschaffung überholter Erziehungsmethoden.
Sie kannte die Benachteiligung der Frauen aus eigenen Erfahrungen und setzte sich für eine Aufhebung verkrusteter Strukturen ein. Allerdings wusste sie auch, dass dies alles nicht ohne einen Kampf gegen die große Mehrheit im Staat vonstattengehen konnte. Diese wollte nichts weiter, als sich den Ranzen vollstopfen und auf den Wohlfahrtszug aufspringen. Das Kriegsgebaren der Amerikaner, ob in Korea oder Vietnam, verurteilte sie scharf. Die meisten Berliner hingegen empfanden die Amerikaner als Retter in der Not, nachdem diese die Bevölkerung während der Blockade aus der Luft versorgten. Mit „Rosinenbombern“, wie man die Versorgungsflugzeuge nannte, und mit knallharter Berechnung.
Moni verklärte die Amerikaner nicht, obwohl sie mit vielen befreundet war. Im Gegenteil. Den Marshall-Plan bezeichnete sie als „raffinierten Kaufvertrag“. Außerdem bestätigte sie den Bericht meiner Großmutter, dass amerikanische Soldaten vor den Augen halbverhungerter Kleinkinder übriggebliebene Essensrationen mit Benzin übergossen und anzündeten. Ob sich eine Nation, die sich an Kindern rächt, als Sieger fühlen darf? Ich weiß es nicht. Natürlich hat keiner der Alliierten den Krieg begonnen, aber die Kinder ebenso wenig. Und wenn wir ehrlich sind: „Kann dieses Volk guten Gewissens behaupten, dass es noch nie einen Völkermord begangen hat?“ Was die Gräueltaten des geisteskranken „Führers“ samt seiner nordisch-germanisch-verkulteten Herrenhunderasse beileibe nicht entschuldigen soll.
Wir diskutierten und erzählten bis in die frühen Morgenstunden. Solche Nächte verbrachten wir noch oft zusammen, während und auch nach meiner Berliner Zeit, bis sie 1987 starb.
An diesem ersten Abend erfuhr ich auch, dass Moni viele der alten SchauspielerInnen kannte oder sogar mit ihnen befreundet war. Darunter Leute wie Elisabeth Flickenschild, Brigitte Mira, Hildegard Knef, Heinz Rühmann, Curd Jürgens und andere. Solange ich mich in Berlin aufhielt, versorgte sie mich regelmäßig mit Freikarten für Theater, Oper und Kabarett. Ich lernte bei ihr Wolfgang Neuss kennen, mit dem sie lange Jahre befreundet war. Ein kleiner Mann mit einer großen Schnauze, Schauspieler und Kabarettist. Intelligent, kritisch, aufmüpfig, verrückt und ein phantastischer Diskussionspartner. Links orientiert schloss er sich der Apo an und nahm an ihren politischen Aktionen teil.
Im November 1968 trat Hildegard Knef mit Kurt Edelhagens Orchester in der Philharmonie auf. Moni nahm mich mit zum Konzert. Hinterher bekamen wir Zutritt zur Garderobe. Ich war hypernervös, weiß nicht, was ich erwartete, bestimmt nicht die Natürlichkeit und Herzlichkeit mit der Frau Knef auch mich begrüßte. Das neunzehnjährige Landei, in seiner rehbraunen Breitcordhose und dem schockgrünen Pulli. Mich faszinierte die Ausstrahlung der Frau im langen, schwarzen Glitzerkleid. Ich trank zum ersten Mal in meinem Leben Champagner, etwas zu viel, wie ich gestehen muss, aber das fiel nicht weiter auf. Zum Abschied schenkte mir „Hildchen“ eine rote Rose, die jahrelang vor sich hintrocknete. Mit Bedauern musste ich sie eines Tages entsorgen, weil Motten sich darin eingenistet hatten.