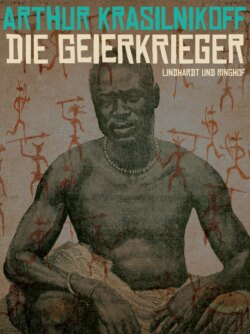Читать книгу Die Geierkrieger - Arthur Krasilnikoff - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie es ist, eine Maschine zu sein
ОглавлениеSeit dem Morgen im Nebel, als alle zu nichts gemacht wurden, hatte er dieses Gefühl in sich gehabt. Nie verließ es ihn richtig, unabhängig wie alt er wurde und wie viel er lernte.
Das Gefühl, dass alles mechanisch war, dass es eine Art Zug gab wie bei den Puppen mit Schnüren und Lederscharnieren. Jedes Tier, jeder Mensch war so aufgebaut. Irgendwie bewegte sich alles, was man lebendig nennen konnte, nur, weil ihm eine Art Batterie eingebaut war. Wenn sie stehen blieb, passierte nichts mehr. Als sein Onkel in den Minen gearbeitet hatte, hatte er ein Radio mit nach Hause gebracht. Es lief mit Batterien, und wenn sie aufgebraucht waren, spielte das Radio nicht mehr.
An diesem Morgen wurde ihm klar, dass er bereits tot war. Er war nichts anderes als ein cleveres elektrisches Werkzeug, das seine Batterien durch Essen und Trinken wieder auflud. Wenn die Batterie leer war, konnte man nichts mehr damit anfangen, und die einzelnen mechanischen Teile verschwanden nach und nach, indem sie Duft und Gas an andere Maschinen abgaben.
Oft weinte er darüber, dass das so war und dass er niemanden hatte, mit dem er darüber sprechen konnte.
Eine Maschine kann nicht existieren. Sie kann sich nicht spüren.
Sieh das Auto hier, zusammengesetzt aus Metalldrähten und dem langen Steuerhebel, die Räder drehen sich, du hast es gebaut, nicht wahr? Glaubst du, es kann fühlen, dass es ein Auto ist? Wer weiß?
So gingen ihm die Gedanken durch den Kopf. In Wirklichkeit war er nicht besser als ein Stein. Es machte ihm Angst, dass nicht mehr Leben in ihm war. Kurz darauf fuhr ihm der Gedanke durch den Kopf, warum er sich anmaßte zu glauben, er sei besser als ein Stein. Wusste er vielleicht, wie ein Stein sich fühlte? Das war kurz bevor er den Stein streichelte, weil er so schlecht von ihm gedacht hatte.
Er kannte ja nur das, was er gesehen hatte. Vielleicht hatte er sich nur eingebildet, dass die Geierkrieger morgens, als er pinkeln musste, gekommen waren und alle außer ihm getötet hatten, weil es so neblig war. Wie sollte er daran festhalten? Er hatte ja das Blut gesehen und die offen stehenden toten Münder, die Arme, die in die Luft und die Stille stachen.
Diese Stille, die herrschen kann, während man träumt und an einem Ort ist, von dem man nicht wegkommen kann, selbst wenn man es gerne möchte. Genau das hatte er ja getan, er war weggegangen. Nicht ein einziges Mal hatte er Ernst damit gemacht zurückzugehen. Daran gedacht hatte er natürlich viele Male.
Wie er zurückkam und sie fest schlafend vorfand, mit zischend in die Lungen hinein- und wieder hinausgehendem Atem. Einige schnarchend, andere, seine kleine Schwester, so leicht atmend, dass man es nur hören konnte, wenn man das Ohr ganz dicht an Nase und Mund hielt.
Und die Gestalten im Nebel waren nichts als Traumgebilde. Ja, er hatte gehofft, dass alles nur ein Traum gewesen war, aus dem er wieder aufwachen würde. Aber er ist nie aufgewacht. Vielleicht hatten sie ihn auch getötet, und er wusste es nur nicht. Er befand sich in einem Traum, während sie ihn töteten, und in diesem Traum haute er ab.
Nach und nach, als die Zeit verging, kam er mit sich selbst überein, dass ein Traum nicht so lange dauern konnte. Es sei denn, er träumte ihn ständig. Warum sollte er nicht ein ganzes Leben in einem Traum leben können? Und jäh an einem Morgen aufwachen, an dem seine Mutter ihn weckte und Vater, Geschwister, Großmutter und Großvater saßen am Feuer und aßen ihr Frühstück und tranken stark gezuckerten Tee. Und alles Leben, das es in der Siedlung gab, während die Leute das Feuer in Gang hielten und mit Töpfen und Deckeln lärmten, bestand aus Lachen und Husten, Geschichten und Spucke, Tabakgeruch und Kindern, die lachten und schwatzten.
Ja, in so einen Morgen würde er gerne aufwachen, und sein Vater würde sich umdrehen und ihn anlachen:
»Wir haben dich schlafen gelassen, so lange du wolltest.« Aber er konnte nicht aufwachen.
In der ersten Nacht hatte er gedacht, jetzt schlafe ich und dann wache ich wieder auf, und alles ist wieder an seinem Platz.
Aber da waren der Nebel und die in Federn gekleideten Krieger, daran konnte er sich erinnern. Und an ihre Arme mit Federn, während sie ihre Waffen schwangen, ihre Messer, die nicht blitzten, weil es neblig war. Das Licht war noch nicht hell genug, dass ein Messer blinken konnte. Da war kein Laut, er konnte nichts hören. Konnte nur die Krieger sehen, während sie sich lautlos bewegten und ihre Pflicht taten, denn genauso wirkte es. Eine Pflicht, die ihnen auferlegt worden war, aber hören konnte er sie nicht. Und doch hätte da ein Laut sein müssen, nur durch das eifrige Summen in seinem Kopf konnte er ihn nicht hören. Trotzdem war da dieser hohe Schrei gewesen, der ihn noch viele Tage verfolgte.
Er dachte nicht unablässig daran, doch mit der Zeit wurden es viele Male. Besonders wenn er über etwas nachdachte, spürte er es, dieses Gefühl, eine Maschine zu sein. Oder dieses Gefühl, nicht lebendig zu sein.