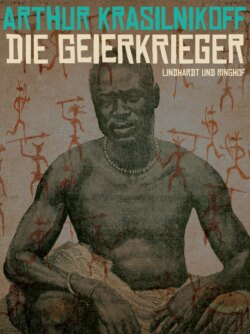Читать книгу Die Geierkrieger - Arthur Krasilnikoff - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Geierkrieger und der Junge, der pinkeln musste Kanta erzählt
ОглавлениеSie kamen mit dem ersten Lichtschimmer.
An diesem Morgen war der Junge zeitig aufgewacht. Er wunderte sich über das verschwommene Licht und den Dunst, der mit dem Licht untrennbar verbunden schien. Nur Büsche und Bäume stachen dunkel aus dem weißen Nebeldunst hervor. Alles war von dem dichten Nebel umgeben, der nur langsam enthüllte, was er verbarg.
Zuerst glaubte er, sie seien Steine, die er vorher nicht bemerkt hatte. Er konnte die Gesichter der Männer nicht ein einziges Mal richtig sehen. Aber er sah, dass sie sich Geierfedern um die Oberarme gebunden hatten und dass zwischen den Federn kleine Pfeifen aus Knochen hingen.
Sie töteten jeden Einzelnen.
Jeden Einzelnen, der schlafend in der Siedlung lag. Er entkam als Einziger. Er wusste nicht, ob die Getöteten noch etwas gemerkt hatten, so schnell ging alles. Er hatte sich ein Stück von der Siedlung entfernt, um zu pinkeln. Er konnte sich gerade noch ins Gebüsch werfen, als sie mit ihrem Gemetzel begannen. Die Männer sprachen nicht miteinander. Sie töteten seine Leute, als ob sie als ein Wesen mit einer Absicht handelten.
Zuerst war weißer Dampf da, als sei die Welt in ein Spinnengewebe aus Nebel eingesponnen. Und vereinzelte Vogelpfiffe. Doch die Stille begann zu grollen und zu schreien, als würde die Welt kentern. Langsam geriet sie aus den Fugen, da sie dem Ersten den Hals durchschnitten. Er war nicht in dieser Welt, als sie seinen Vater umbrachten. Ein Schnitt – das war alles.
Als er zurückkehrte, war es ganz still. Der Morgen breitete sich in seinem seltsamen weißen Dunst und seinem zitternden Licht vor ihm aus. Zögernd kam die Welt zurück. Scharfer Akaziengeruch stieg ihm in die Nase. Es würde nicht lange dauern, bis die Wärme diesen seltsamen Traummorgen vertreiben und er sehen würde, was passiert war.
Trotzdem blieb er liegen, als die Wärme kam und die Insekten zum Leben erwachten. Das Nebelspinnengewebe löste sich auf. Ein Käfer summte vorbei. So einen Nebel hatte er noch nie gesehen.
Jetzt war es ganz still. Die Feuer rauchten nicht mehr. Und niemand war da, der sich erhoben hatte, um neues Brennholz aufzulegen. Obwohl er die Augen geschlossen hielt, spürte er das Kribbeln der Wärme auf der Haut.
Niemand hatte sich bewegt.
Er war nicht da gewesen, als die Geiermänner kamen.
Niemand erhob sich, um nach ihm zu rufen. Kein Laut war zu hören. Erst da bemerkte er den schwarzen Skarabäus, die blaue Akazienbiene und die kupferrote Ameise, die durch den Sand krabbelten, der die gleiche Farbe wie der Nebel hatte. Er lag da, als sei er gefallen.
Endlich kam er auf die Beine. Er tat, als sei nichts gewesen, guckte starr auf den Boden und ging weg. Er konnte sich nicht überwinden zurückzugehen. Als er so weit gegangen war, dass er die Siedlung nicht mehr sehen konnte, fand er die Federn und die Knochenpfeifen. Sein Überleben war nicht beabsichtigt gewesen.
Lange Zeit war er allein und sehnte sich nach Menschen. Der Himmel erhob sich blau und mächtig über ihm und beobachtete ihn unaufhörlich. Überall, wo er ging und stand, breiteten sich Bäume und Büsche über der gewaltigen Ebene aus. Gras und Sand schienen zwischen ihnen hindurch.
Von dem Moment an, als er gesehen hatte, wie seinem Vater die Kehle durchschnitten worden war, bestand für ihn alles Lebende nur mehr aus Stöcken, Haut und Knochen.
Es gab nichts Lebendiges mehr. Alles schien von toten Dingen ausgeführt zu werden.
Er ging lange.
Es war ihm gleichgültig, ob er im Kreis, vorwärts oder rückwärts ging. Wenn er nur etwas zu essen und zu trinken bekam.
Ab und zu fiel sein Blick auf die in weiter Ferne grasenden blauen Gnus. Sie ähnelten Hautstücken, die fest auf einen Rahmen aus Knochen gespannt waren, und wirkten seltsam flach. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass sie wirklich da waren. Und wenn er ihre wunderlichen lang gestreckten Köpfe mit der tief liegenden Augenpartie, die schwarzen gebogenen Hörner genauer betrachtete, wurden sie noch unwirklicher. Das ununterbrochene Gebrüll einer Vielzahl von Tieren, das um sie herum in der Luft über der Ebene schwirrte, anschwellend und abebbend zugleich. Diese Laute und Gerüche bewirkten etwas in ihm. Er konnte sie nicht ertragen. Sie machten ihn unsicher, so als würde ihn jemand verfolgen.
Die Gnus ließen ihn sehen, wie sie gebaut waren; Zebras und Springböcke dagegen waren zu rund, um durch sie hindurchzusehen. Die Haut saß so eng um ihren runden fleischigen Körper, dass das Skelett darunter verschwand.
Tagelang irrte er umher. Er hatte vergessen, dass er eine Stimme besaß. Kein Laut entwich ihm. Irgendwer hatte geschrien an jenem Morgen, ein Schrei wie von einem Vogel. Seitdem hatte er keine Stimme mehr.
Manchmal blieb er stehen und spähte in die Landschaft. Sie breitete sich in Wellen vor ihm aus. Überall Büsche und Bäume. Dazwischen Gras. Zu dieser Zeit war es grün und frisch. Es war ein Platz für Kuhantilopen, den er in einem Traum hätte erfinden können. Ihre langen schmalen Gesichter starrten ihn unablässig an. Die Augen schienen zu glühen. Die Schädel mit den schwarzen nach hinten gebogenen Hörnern waren unter der dünnen Haut deutlich sichtbar. Er dachte, dass sie auch nicht anders gemacht waren wie eine Tanzpuppe, selbst wenn es im Traum geschehen war.
Er sagte kein Wort, was immer er erlebte. Er bestand nur noch aus seinen Sinnen und seinem Körper, der unaufhörlich Hunger und Durst spürte, Durst. Das Einzige, was er tat, war, Essen für diesen Körper zu beschaffen.
Als er erwachte, sah er Geier an Stelle der Männer. Natürlich war das beabsichtigt. Davon ließ er sich nicht täuschen. Auch wenn er danach keine Geier mochte, aber wer tat das schon? In Wirklichkeit waren sie ja auch nur als Männer verkleidete Apparate. Dann kamen die Hyänen, und er verließ den Ort. Jetzt hatte er kein Zuhause mehr.
Er war ein lebender Toter. Er hätte tot sein sollen und trotzdem war er es nicht. Hätte er nicht pinkeln müssen, wäre er jetzt tot. Er kroch weg, und erst als er weit weg war und die Geier nicht mehr sehen konnte, wagte er aufrecht zu gehen.
Vielleicht ging er den ganzen Tag. Manchmal kroch er. Dann wieder bekam er Angst und lief. Besonders auf den weiten Ebenen hatte er Angst, dass sich im Gras und den niedrigen Büschen Löwen oder Leoparden verstecken könnten, und er lief, dass das Gras gegen seine Beine schlug und er vor Atemnot keuchte, die übrige Zeit ging er wieder. Er konnte sich nicht erinnern, früher Angst gehabt zu haben. Er hatte das Gefühl, die ganze Zeit verfolgt zu werden. Er sank. Sein Magen zog sich zusammen. Er meinte sich übergeben zu müssen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals.
In der ersten Nacht ging es ihm schlecht. Er weinte, weil er ganz allein war. Jetzt, wo er versuchen musste, allein zu schlafen, kam alles zurück. Die Leute. Der Nebel. Sein eigener Atem. Die Geierfedern. Die sich anschleichenden Männer. Kein Atemlaut war von ihnen zu hören gewesen. Verzweifelt sehnte er sich, jemanden berühren zu können. Von jemandem gehalten zu werden. Oder einfach jemandem nahe zu sein, um dessen Wärme zu spüren. Schließlich versuchte er, sich selbst zu halten. Das tröstete ihn ein wenig.
Alles war so schnell gegangen, dass er keinen Alarm schlagen konnte. Er hatte einfach dagestanden und gepinkelt. Noch halb schlafend, hatte er nur die Männer in dem weißen Nebel ausmachen können. Was hätte er tun sollen? Was wäre das Richtige gewesen? Und dann das erste Messer, und das nächste, und das nächste … das Blut, das so schnell aus den Kehlen schoss, dass niemand schreien konnte.
Ganz langsam hatte er sich hingelegt. Plötzlich war er wie auseinander gebrochen, als sei er nicht länger ein Ganzes. Nur noch Sinne, die nicht mehr zusammenspielten.
Mit den Augen sah er die Männer und das Blut. Mit den Ohren hörte er die Messer, wie sie in Haut und Fleisch schnitten. Mit der Haut fühlte er plötzlich die morgendliche Kälte und musste zittern.
Das eine war nicht die Folge des anderen.
Als der Nebel sich hob und verschwand. Als der Dunst wegtrieb wie dünne, zerfetzte Kleidungsstücke. Als die weißen Dampfwesen sich auflösten. Als die Geier kamen und später die Hyänen mit ihrem Gelächter, entdeckte er, dass er nicht tot war, wie er hätte sein sollen. Er wusste nicht, was er machen sollte. Die ganze Zeit war er den Tränen nahe.
Jetzt vermisste er seine Mutter, obwohl er das nicht sollte. Er war ein großer Junge, aber noch immer liebte er es, von ihr gestreichelt zu werden, als sei er ein kleines Kind. Und den Vater, der ihn hochhob, dass er sehen konnte, wenn die blauen Gnus dem Wasser in der Luft hinterher donnerten. Und die kleine Tcisa, die ihn immer weckte, indem sie auf ihn krabbelte.
Nein, sie alle gab es nicht mehr. Und ihn hätte es auch nicht mehr geben sollen. Es war verkehrt, dass er lebte, wenn sie alle nicht mehr da waren.
Auch Großmutter und Großvater nicht, die ihn gelehrt hatten, was er wissen musste.
Die Spuren, die allerkleinsten, den geknickten Zweig und den Abdruck, den das Tier hinterlassen hatte, der Aufschluss über Alter und Geschlecht gab. Wie alt die Spur war. Welchen Kot die einzelnen Tiere ausschieden. Was sie gefressen hatten. Welche Wurzeln essbar waren. Welche Früchte man nicht essen durfte. Auch wenn sie lecker aussahen.
Die Jungen Dabe und Qaa, die immer gemeinsam auf die Jagd gingen und ihn manchmal mitnahmen, damit er sehen konnte, wie sie es machten, und die ihn lehrten, Fallen zu bauen. Und wie man kleine Zweige von bestimmten Büschen in die Erde steckte. Wie man sie anordnen musste, damit die Tiere den Weg zu der Falle einschlugen. So wie sie es von den Jungen gelernt hatten, die älter als sie waren.
Der erste Kronendukker, den er fing, entkam, weil er ihn nicht sofort erschlug. Die kleinen Hörner an der Stirn, die wie zwei magische Gewächse hochstanden. Er konnte sich noch immer an den schwachen Duft der Wärme erinnern, der von dem Tier ausging, und an das wilde Schlagen des Herzens. Das Tier hatte nicht einmal geschrien. Zuletzt streifte der Pelz seine Brust, während er vorsichtig die Beine des Tiers aus der Falle befreite. An das Gefühl, als der Dukker aus seinen Armen sprang, aus einer Art Gemeinschaft, die sich in Rauch auflöste. Die jagenden Jungen lachten so, dass sie beinahe umfielen. Als er das nächste Mal ein Tier einfing, diesmal ein Springhase, machte er es wie die anderen und versetzte ihm einen ordentlichen Schlag mit der Keule. Bang. Tot und still.
Nein, nichts würde er mehr von ihnen lernen.
Und nichts hatte er bei sich, als er aus der Siedlung weglief. Nicht einmal etwas, um Feuer zu machen. Ein kleines Feuer, an dem er sich wärmen konnte. Deshalb dachte er an den Strauß. Wenn er nur ein Feuerzeug gehabt hätte wie er. Ja, bevor es dunkel wurde, hatte er nicht darüber nachgedacht. Es war einmal ein Strauß, der hatte ein Feuerzeug, mit dem er Feuer machen konnte.
Niemand sonst besaß etwas so Prächtiges.
Gxwma war schon lange aufgefallen, dass das Essen, das der Strauß zubereitete, immer sehr gut roch. Eines Abends, als Gxwma sich nahe genug herangeschlichen hatte, um etwas erkennen zu können, sah er, wie der Strauß Feuer machte und mit Töpfen und Töpfchen zu hantieren begann. Wenig später breitete sich ein herrlicher Duft in der Dunkelheit aus, und das Feuer leuchtete, dass man es auf eine lange Entfernung sehen konnte.
So unglaublich hatte Gxwmas Essen nie geduftet.
Gxwma dachte, dass er dieses Feuerzeug haben musste.
Nach einer Weile entdeckte Gxwma, dass der Strauß das Feuerzeug unter einem seiner Flügel versteckte. Oho, dachte er. Oho, jetzt weiß ich, was ich tun muss.
Ein paar Tage später kam Gxwma vorbei.
»Du, Strauß, ich habe einen Busch mit reifen Beeren gefunden. Möchtest du welche haben?«
Froh folgte der Strauß Gxwma und dachte sich nichts dabei.
»Sieh. Da ist der Busch.«
Unverzüglich entdeckte der Strauß die Beeren und begann sich voll zu stopfen. Oh. War das köstlich. Er konnte an nichts anderes denken, als all die guten Beeren zu fressen.
Da sagte Gxwma: »Die größten hängen ganz oben. Sieh mal, da. Das sind die besten. Meinst du, du kannst an sie herankommen? Du bist viel größer als ich.«
»Ja, das kann ich«, sagte der Strauß und dachte sich nichts dabei. Worauf er sich so hoch reckte, wie er konnte, um an die Beeren zu kommen, und die Flügel ausbreitete, um an die Beeren zu kommen, die noch weiter oben waren. Denn jetzt glaubte er, dass die höchsten die besten seien.
Sofort raubte Gxwma das Feuerzeug und lief wie ein Steinbock, um fortzukommen.
Endlich begriff der Strauß, worauf Gxwma die ganze Zeit aus gewesen war.
In der Zwischenzeit hatte Gxwma mit spitzen Steinen aus dem Dornbusch eine Falle für den Strauß gebaut, da er genau wusste, dass der Strauß schneller laufen konnte als er. Gxwma hatte Dornbuschzweige in den Boden gesteckt, sodass der Strauß gezwungen war, bei seiner Verfolgung zwischen ihnen hindurch und über die spitzen Steine zu laufen.
Wie ein Wirbelwind kam der Strauß angerannt und lief direkt in die Falle. Gxwma hatte die Steine so geschickt angebracht, dass sich der Strauß alle Zehen bis auf den großen Zeh und den Zeh daneben, die beide am Fuß hängen blieben, abschnitt. Dadurch wurde der Strauß so aufgehalten, dass Gxwma mit dem Feuer entkommen konnte.
Seit dieser Zeit hat der Strauß nur zwei Zehen.
Und kein Feuer.
Ehéh.