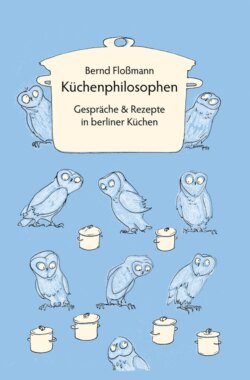Читать книгу Küchenphilosophen - Bernd Floßmann - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Grundfrage der Philosophie
ОглавлениеHeute ist Paul zu Besuch. Paul ist ein langjähriger Freund von Hans, und etwas älter als dieser. Paul hat in der Deutschen Demokratischen Republik Philosophie gelehrt, jetzt trifft man ihn aber mehr auf Techno-parties, Linux-Konferenzen und Kunstdiskussionen als im Hörsaal. Er hatte auch nach der Wende ein paar Semester Philosophie und Anglistik studiert, dann aber abgebrochen, weil er ja Geld für seinen Unterhalt verdienen musste.
»Wie war das damals so mit der Philosophie?« fragt Aspasia. »War das nicht alles nur Ideologie und ML, wie das hieß? Habt ihr überhaupt außer Karl Marx etwas anderes lesen dürfen?«
Paul antwortet: »Natürlich konnten wir fast alles lesen. Für einige Schriften, wie von Trotzki oder von Faschisten, pornografische oder von verfemten Autoren, mussten wir einen Nachweis der wissenschaftlichen Verwendung erbringen. Aber im Grunde war alles da. Außerdem kursierten ja auch noch eine Menge Bücher unter den Interessierten, wurden von Hand zu Hand weitergegeben oder abgeschrieben.«
»Und was waren die Grundstrukturen dieser Philosophie, die ihr gelehrt habt? Kannst du uns darüber etwas erzählen?«, fragt Aspasia.
Paul antwortet: »Ich habe in meinem Studium gelehrt bekommen, dass es eine ›Grundfrage der Philosophie‹ gäbe, und dass diese Grundfrage die nach dem Verhältnis von Sein und Bewusstsein sei.
Die Frage wurde von zwei feindlichen philosophischen Richtungen unterschiedlich beantwortet. So hieß es: Der ›richtige‹ Materialismus sei der Meinung, dass das Sein prior vor dem Bewusstsein sei, das Bewusstsein also mehr oder weniger Widerspiegelung des Seins. Der ›falsche‹ Idealismus war der Meinung, dass das Bewusstsein das Sein bestimme, das Sein also mehr oder weniger die Widerspiegelung des Bewusstseins sei.
Dabei gab es noch den Unterschied zwischen dem objektiven Idealismus, bei dem die Ideen außerhalb des menschlichen Gehirns existierten und dem subjektiven Idealismus, bei dem die Ideen innerhalb des menschlichen Gehirns existierten.
Objektiver Idealismus, so wurde uns gelehrt, sei nur verkappte Religion, und subjektiver Idealismus vollkommener Blödsinn, wie man durch Anfassen der Welt, verstanden als Praxis, als praktisches Handeln, leicht erkennen könne.
So weit so einfach, aber seltsam. Was nicht so richtig passte, war, dass Klassiker Lenin in seinen Exzerpten zu Hegels Logik an einer Stelle ausrief: ›Hier ist Hegel ganz nahe am historischen Materialismus!‹ und dass Marx bei aller Liebe zu Feuerbach dessen idealistische Liebesduselei verurteilte. Und beide schienen von Kant eine ganze Menge zu halten. Was mir auch seltsam erschien, war die alljährliche Losung zum 1. Mai: ›In der DDR sind die Ideale von Marx, Engels und Lenin Wirklichkeit geworden!‹ Ideale welche zur Wirklichkeit werden? Waren unsere Klassiker etwa doch keine Materialisten, sondern Idealisten? Hatten Ideen doch mehr Funktion als die einer Reflexion?
Was weiter nicht passte, war, dass unser theoretischer Klassiker Marx Hegel gerade in einem Punkt besonders verehrte, nämlich darin, dass dieser die verschiedenen Meinungen der Philosophen in der Geschichte nicht als unvereinbare Gegensätze, sondern als Momente in einem Progress der Entwicklung des menschlichen Denkens hin zur Selbsterkenntnis der absoluten Idee verstand, mit dem die Entwicklung dann aufhört. Nur, dieses Ende fand Marx nicht mehr so gut.
Das verführte mich dazu, in meiner Lehrprobe an der Fachschule für Bibliothekare in Leipzig diese Aussagen als provokativen Ausgangspunkt für eine differenzierte Betrachtung eben dieser Grundfrage der Philosophie zu nutzen. Ich habe Hegel als Materialisten und Feuerbach als Idealisten vorgeführt und aus dem Widerspruch zum Buch eine lustige Diskussion entwickelt. Zu Recht bekam ich für diese Lehrprobe von meiner Dozentin ein ›genügend‹. Das hat mich damals sehr geärgert, zumal meine Studentinnen mir ein ›ausgezeichnet‹ gaben.
Nun ist sicher aus der historischen Entfernung von mittlerweile 27 Jahren und einer politischen Wende die Gefahr der Beschönigung des eigenen Handelns post festum groß. Deshalb bekenne ich hier deutlich, dass ich zu dieser Zeit am Sinn des Sozialismus nicht gezweifelt hatte, auch wenn mir die damalige Erscheinungsform dieses Sozialismus nicht vollständig gefiel. Genauso wenig gefällt mir die gegenwärtige Erscheinungsform des Kapitalismus, wie ich ihn zurzeit erlebe.
Wir sind eben immer unzufrieden – besonders wenn das Geld knapp wird.
Aber zurück zum Thema: Zwar gefiel mir der Satz, den sich auch Karl Marx von Descartes als Wahlspruch geholt hatte: ›An allem ist zu zweifeln!‹ Mein Zweifel aber war auf die Weiterentwicklung der Gesellschaft durch die Phasen des Sozialismus oder Kapitalismus – oder wie auch immer sie genannt werden – gerichtet.
Mein Verständnis der Grundfrage der Philosophie entwickelte sich für mich immer stärker dahin, die Entwicklung des menschlichen Denkens, beziehungsweise der Fähigkeit, die Welt denkbar zu machen, zu verstehen. Mit dem Gegensatz von Materialismus und Idealismus hatte das nichts mehr zu tun.
Je mehr ich nun die Geschichte der Philosophie studierte – und das Verstehen der Autorinnen und Autoren dieser Geschichte ist für mich immer noch anstrengend, desto mehr löste sich dieser Gegensatz auf in ein lebendiges Spiel der Ideen und Vorstellungen des Wissens von der Welt.
Für mich war der dialektische Materialismus immer eine Vereinigung von Idealismus, Dialektik und Materialismus gewesen. Bis heute fällt es mir schwer, in diesem Begriff ›Diamat‹ jenen ideologischen Terminus zu erkennen, als der er als Gegenbegriff zur Metaphysik, welche als undialektischer Idealismus definiert wurde, unzweifelhaft benutzt wird.
Dabei bietet mir die Vorstellung einer schräg gelegten Entwicklungsspirale durchaus die Möglichkeit zu denken, dass ein scheinbarer Rückschritt trotzdem oder gerade deswegen Bestandteil eines Fortschritts sein könne.«
»Jetzt verstehe ich«, bemerkt Diotima, »dass ein großer Teil des Nichtverstehens von Philosophie dieser Ideologisierung, die von allen Seiten immer noch betrieben wird, anzulasten ist. Wie beneide ich die Genies, die fähig waren, schon sehr früh diese ideologischen Schranken zu überspringen und wie leide ich mit den Denkern, wie meinem geliebten Hölderlin, die an diesen ideologischen Schranken zu Grunde gegangen sind.«
»Das war ja mal eine lange Rede, Paul«, ruft Hans, »Und das erinnert mich an das Problem des Hefeteigs. Mit Hefeteig ist es wie mit der Grundfrage der Philosophie: Das Problem entsteht erst durch den Eifer der Menschen, alles schnell machen zu wollen. Hefeteig entstand im Haushalt aber immer so nebenbei und hat so zwischen den einzelnen Verarbeitungsschritten immer viel Zeit, sich auszuruhen und zu temperieren.«