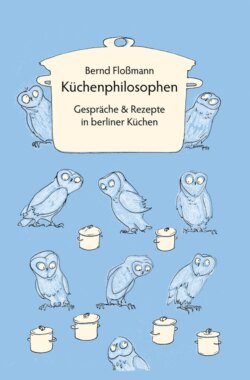Читать книгу Küchenphilosophen - Bernd Floßmann - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеPhilosophie und Küche? Geht das zusammen? Das Wort Philosophie wird doch oft mit staubigen Kathedern, schwieriger Sprache, dicken Büchern in Antiquariaten und Bibliotheken verbunden!
Über Jahrtausende haben Philosophen und Denker versucht, sich von der leiblichen Seite ihres Lebens nicht beeinflussen zu lassen und rein – vor allem rein geistig – zu leben. Der Verzicht auf Essen, Sex und andere leibliche Freuden wird auch heute noch von vielen als ein philosophischer Weg zur Erkenntnis angepriesen.
Spätestens dann, wenn es nichts mehr oder nur noch Schlechtes zu essen gab, wandelte sich aber auch die Qualität der Philosophie ins Griesgrämige, wenn die Philosophie nicht sogar bis zur nächsten Mahlzeit ganz aus dem Bewusstsein verschwand.
Das Wort ›Küchenphilosophie‹ kann so in zwei Richtungen gelesen werden: Zum Einen als Philosophie der Küche und zum Anderen als Philosophie in der Küche.
Die Philosophie der Küche prägt sich in der Art und Weise aus, wie wir unser Essen und Trinken zubereiten, welche Zutaten und welche Verfahren der Zubereitung wir wählen. Die Philosophie der Küche zeigt sich in der Art, wie das Essen serviert und wie mit Küchenabfällen umgegangen wird. Es gibt Parteien wie Vegetarier, Vegane, Makrobioten, Fleischesser, Rohkostler oder Trennköstler. Diese bekämpfen sich mitunter bis aufs Blut, sind einander spinnefeind oder haben gelernt, sich zu tolerieren, das heißt, sich gegenseitig zu ertragen.
Jede Religion und jede Philosophie hat Ernährungsregeln. Pythagoras und seine Anhänger verzichteten zum Beispiel auf Bohnen. Kant liebte an seiner berühmten Tafelrunde Fisch und Fleisch, Senf und Käse, mitunter ganz entgegen seiner von ihm selbst formulierten philosophischen Diätetik.1 Die Küche entscheidet nicht nur über die Laune der Philosophen, sondern auch über das Ausmaß der Konsequenzen, welche durch ein Bekenntnis zu bestimmten philosophischen Auffassungen auf sich genommen werden sollte.
Hat Camus noch gespottet »Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord«2, so ist die Frage: »Was essen wir heute?«, meines Erachtens ein mindestens ebenso ernst zu nehmendes Problem. Gehört Camus Problem zum Bereich der Fragen der Existenz und der reinen Vernunft, so gehört das küchenphilosophische Problem zum Bereich der praktischen Philosophie, ebenfalls mit weitreichenden theoretischen Konsequenzen.
»Was essen wir heute?«, wirft Fragen nach Ressourcen, Möglichkeitsfeldern, Namen, der Trennung zwischen Tier und Mensch, der moralischen und gesellschaftlichen Verantwortung auf: »Du bist was du isst!«
»Was essen wir heute?«, wirft Fragen nach Verhaltensalternativen, Verhaltenssteuerung, Kulturformen, Grenzen zwischen Essen und Trinken und den Übergängen zu anderen Tätigkeiten wie Lernen, Kämpfen oder Lieben auf: »Essen hält Leib und Seele zusammen!«
»Was essen wir heute?«, wirft Fragen der Toleranz, des Umgangs mit Anderen, der Macht, der Gemeinsamkeit oder der Trennung, nach Konsequenzen beim Zusammentreffen verschiedener Religionen auf: »Liebe geht durch den Magen!«
»Was essen wir heute?«, bringt die historische Komponente ins Spiel. Was hatten wir gestern, was wollen wir morgen essen? Gibt es genug für alle, was muss eingekauft werden? Essen wir chaotisch was da ist oder kaufen wir nach Plan und Rezept ein?
Als Philosophie in der Küche bezeichnet das Wort ›Küchenphilosophie‹ etwas, was sich von Stammtischphilosophie wesentlich und extrem unterscheidet. Wesentlich, weil der Ort der Küche ein Ort der Produktion ist, der Stammtisch ein Ort der Konsumtion. Die Topologie der Philosophie wirkt so entscheidend auf die Art und Weise des Philosophierens.
Extrem, weil Philosophie in der Küche einen produzierenden Charakter hat, einschließend, kritisch, konstruktiv, dynamisch. Der Stammtisch dagegen ist ein Ort der Konsumtion, vor allem von die Wahrnehmung verengenden Rauschmitteln wie Bier und Nikotin. Philosophie am Stammtisch hat einen konsumierenden, ausschließenden – denn Fremde haben sich nicht an den Stammtisch zu setzen – meckernden, destruktiven und statischen Charakter: ›Hier sitzen die, die immer hier sitzen‹.
Es gibt einen berühmten Dialog von Platon, in diesem geht es um die Liebe. Während der Gespräche wird herzlich gegessen und getrunken, bis am Ende nur noch Sokrates stehen kann.
Dort berichtet Sokrates, dass er seine nun so berühmte Art zu fragen von Aspasia, deren Figur in diesem Dialog mit der Seherin Diotima zusammenfließt, gelernt habe. Aristophanes verspottet ihn daraufhin, dass wohl seine Philosophie im Bordell entstanden sei, weil Aspasia eine bekannte Hetäre war.3 Ich bin mir ziemlich sicher, dass der junge, nicht sehr vermögende Sokrates im Hause der Aspasia wie im Hause der Diotima mehr in der Küche als im Bett zu finden war. Einer meiner Lieblingsplätze als Kind war die Türfüllung zur Küche, in die ich mich kauerte und mit meiner Mutter endlose Gespräche führte.
»Küchenphilosophen« handelt vom Gespräch in der Küche. Diese Gespräche sind manchmal nur gemeinsames Zwitschern, vertrautes Geräusch, manchmal der Austausch von Erfahrungen, Weisheit. In der Küche finden oft Gespräche mit grösserer philosophischer Bedeutung statt als in Akademien.4 Akademische Philosophie verwandelte sich immer mehr in Scholastik und Rechtfertigung der jeweils bestehenden Herrschaftssysteme, wohl auch weil zu Symposien heutzutage kaum einmal mehr Kekse gereicht werden.
In meiner Welt ist eine Einladung zum Essen auch meistens eine Einladung zum gemeinsamen Kochen. Wenn ich Gäste bekomme, ist deren erster Weg in der Regel der in die Küche, in der wir dann sitzen und kochen, essen und – philosophieren.
Die Art des Philosophierens in einer Küche ist anders als in der Einsamkeit des Spaziergangs, der Studierstube oder des Katheders. In der Küche ist Philosophieren praktisch, wirklichkeitsnah, weich und ungenau.
1 vgl. Harald Lemke: Eine Einführung in die Gastrosophie. Akademie Verlag 2007 S. 191f
2 Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos
3 Eine Hetäre war im Unterschied zur Hausfrau und zur Dirne eine Frau, welche sich für die Rolle der Geliebten (Aspasias Geliebter war kein Geringerer als der Herrscher Athens, Perikles!) entschieden hatte.
4 Die Akademie ist der Name des Ortes der Philosophenschule des Platon (Platonische Akademie), die sich beim Hain des griechischen Helden Akademos in Athen befand.