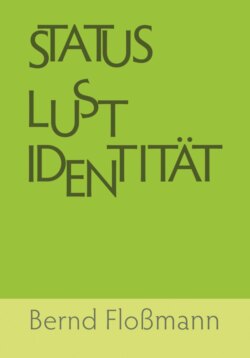Читать книгу Status – Lust – Identitaet - Bernd Floßmann - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Woher kommt Renitenz?
ОглавлениеDas Problem für Mächtige ist der Widerstand, welche die Beraubten und Geknechteten den Räubern und Herren früher oder später entgegensetzen. Das Problem ist die früher oder später einsetzende eigene Schwäche. Sei es durch einfaches Altern oder durch Dekadenz, irgendwann ist der Starke nicht mehr stark, der Mächtige nicht mehr mächtig genug und muss um Macht und Stärke zittern. Und nicht zuletzt, es ist unökonomisch. Der Kampf um die Macht vernichtet Ressourcen. Wenn auch Krieg und Kampf um Ressourcen für den einzelnen Herrscher oder Staat von Vorteil sein können, auf lange Dauer, volkswirtschaftlich und weltwirtschaftlich gesehen ist diese Form der Verhaltensbeeinflussung Verschwendung. Die Erringung der Macht kann noch mit Gewalt geschehen, die Erhaltung der Macht braucht Finesse.
Je schwächer die Mächtigen werden, desto subtiler, feiner ausgearbeitet und gewitzter müssen die Methoden der Verhaltensbeeinflussung werden. Hier kommen verfeinerte Methoden der Motivation ins Spiel. Die Kunst ist, diese Techniken voneinander zu unterscheiden und dabei immer das Wohl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Auge zu haben.
Der Berliner Kinderrechtsverein KinderRÄchTsZÄnker (Krätzä) findet, dass viele Lernschwierigkeiten Widerstand gegen den Zwang zum Lernen sind. In einem Film19 vergleichen sie die Schulpflicht mit einer (fikitiven) Essenspflicht. Diese Schulpflicht ist klar ein Zwang, denn wer der Schulpflicht nicht nachkommt, muss Strafe und Repressalien erwarten. Von einer tief empfundenen Pflicht, welche ein intrinsisches Motiv ist, kann hier nicht die Rede sein.
Zwang ist eine Frage des Status. So lange sich Eltern und Erwachsene als erhaben über den Kindern und Jugendlichen und klüger als sie dünken, müssen Kinder und Jugendliche Schule und Ausbildung als Unterdrückung empfinden, als erniedrigend. Gegen diese Erniedrigung müssen sie naturgemäss ankämpfen. Ein Großteil von Lernwiderständen hat seinen Ursprung in Statuskämpfen.
»Das Etikettieren der Menschen formt das didaktische Verständnis an den Schulen. Wenn ein Schüler Mathematik nicht begreift oder schlechte Noten vorzuweisen hat, dann wird ein Lehrer nicht überlegen, welche didaktischen Möglichkeiten es gibt, den Stoff besser zu erklären, genauso wenig wird er dies nicht als sein eigenes Versagen ansehen, sondern er wird die Schwierigkeit des Schülers, Mathematik zu verstehen, auf dessen Unwillen zu lernen, aber meist auf eine inhärente Unfähigkeit zurückführen und ihm ein zu kleines Hirnvermögen oder gar genetischen Mangel attestieren. Der Schüler erhält so ein Identitätskonzept übergestülpt, das ihn als self-fulfilling prophecy sein Leben lang begleitet, hemmt und lenkt (insofern es Einfluss auf die Berufswahl nimmt).« 20
Wenn Menschen uns sagen, dass sie keine Lust zum Lernen hätten, reagieren sie auf den Trend, der erst mit dem Beginn des Industriezeitalters vor 300 Jahren begann, dem Trend zur Trennung von Arbeit und Genuss, von Arbeitszeit und Freizeit, von Arbeit und Selbstverwirklichung. Das Motto ist bekannt: »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!« Diese, von Max Weber »protestantische Arbeitsethik« genannte Grundhaltung, dass Arbeit keinen Spass machen sollte, dass sie eine Pflicht ist, ist die Basis für die Mechanisierung der Industriearbeit, denn je entmenschlichter die Arbeit ist, desto leichter kann sie an Maschinen übergeben werden. Seit der Zeit der technischen Revolution der Moderne, spätestens der digitalen Revolution hat sich diese Situation jedoch verändert. Dazu kommt, dass junge Erwachsene biologisch für die Fortpflanzung prädestiniert, ihre Hauptinteressen auf die Partnerwahl und auf die Erzeugung von Nachwuchs gerichtet sind. Junge Erwachsene finden einfach andere Sachen lustig und lustvoll als ihre Eltern, als Ältere überhaupt. Auch das ist ein Aspekt, der meines Erachtens zu wenig Berücksichtigung findet.
Neben Status und Lust spielt die Identität von Menschen eine große Rolle. Jugendliche müssen sich ihren Platz in der Gesellschaft erst erobern. Sie wissen noch nicht, was oder wer sie sind. Sie kennen ihre Stellung in der Gesellschaft nicht. Vorstellungen von der eigenen Identität kommen aber immer und nur aus dem Spiegel, den uns Andere liefern. Alle Erfahrungen über uns stammen von anderen Menschen oder von der Wirklichkeit, die andere Dinge (Nicht-Ich, Nichtse) für uns haben. Selbst Dinge, die wir selbst gemacht haben, Kinder oder Werke oder Zerstörungen sind im Moment des Wahrnehmens Anderes. Da wir selbst Andere für die Anderen sind, finden wir rasch partielle Ähnlichkeiten mit unserer Wahrnehmung, ähnlich jener, aus welcher das befragte Ich sein Selbstbild bezogen hat. Was Menschen individuell sind, zeigt sich an dem, was sie produzieren (in der Außenwelt formieren), was ihnen von anderen Menschen rückgemeldet wird, was sie im Spiegel sehen. Das aber ist Fremdes. Das Ich erweist sich als ein Anderes.
»Der durch das Spiegelbild gestiftete Beginn meiner Identität ist zugleich der Beginn meiner Alienation - der Andersheit meiner selbst«, sagt der französische Psychoanalytiker Lacan. Das Problem der Identität ist, dass sie sich immer nur über ein Medium offenbart. Die Abhängigkeit von Anderen ist besonders bei der Identität, der Frage »Was bin ich?« verletzend.
Die Aufsässigkeit von Jugendlichen, ihr Bedürfnis, Grenzen zu überschreiten, Verbotenes zu tun, sich im öffentlichen Raum durch Graffitis oder Zerstörungen wahrnehmbar zu machen, das pubertäre »Dagegen!«, rührt zu einem großen Teil aus dem Bedürfnis, sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen.
Damit korrespondiert das Gejammer von der »Jugend von heute!«, das sich durch die Jahrtausende zieht:
»Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.«21
»Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.«22
»Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen.«23
Dazu eine Anekdote: Während der Studentenunruhen der sechziger Jahre in den USA soll ein Sohn irgend eines berühmten Mannes verhaftet worden sein. Daraufhin bestürmten Journalisten diesen Mann, lasst es Rockefeller sein, mit Fragen, wie: »Wie fühlen Sie, der reichste Mann der Welt, sich dabei, dass Ihr Sohn ein Revolutionär ist?« Daraufhin lächelte Rockefeller nur milde und sagte:
»Wissen Sie, es ist doch so, als Jugendliche sind die Menschen doch noch nichts, sie haben keinen Platz in der Gesellschaft, alle Plätze, Pfründen und Positionen sind besetzt von Älteren, Mächtigeren, Reicheren. Jugendliche, also Leute bis etwa 25 Jahre müssen doch einfach revolutionär sein, eine Umwälzung wollen, müssen an den Stühlen der Älteren sägen, sie grundlegend und heftig kritisieren! Vom 25 bis 45 sind die Menschen dann etabliert und daran interessiert, dieses Status zu halten. Sie brauchen stabile Aufzuchtbedingungen für ihre Kinder und ihre Unternehmen - sie werden naturgemäss konservativ. Ab 45 Jahren werden die Menschen schwächer, sie haben keine Ideen mehr und ihre Erfahrungen sind in unserer schnelllebigen Welt immer weniger wert. Um überleben zu können, sind sie nun eher geneigt, revolutionäre Bestrebungen zu unterdrücken. Sie neigen dazu Neues zu verachten und zu verhindern, sie haben eigentlich kein Recht mehr, eine Führungsposition einzunehmen. Die Menschen sind in diesem Alter naturgemäss reaktionär. Also lassen Sie der Jugend die Revolution, die werden schon älter und sich dann ändern!«
Natürlich ist das nur eine Anekdote. In der Wirklichkeit ist die Situation etwas komplexer. So stellt Karl Mannheim fest, dass sich das Generationenproblem deutlich weniger an das biologische Alter bindet, als an die typische soziale Situation, die »Lagerung im sozialen Raum«, die realen Chancen, welche junge Menschen in der Gesellschaftsentwicklung haben. So kann es durchaus sein, dass wir auf reaktionäre junge Menschen und auf revolutionäre alte Menschen treffen. Auch wenn diese Anekdote also einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht standhält, so illustriert sie jedoch Tendenzen und Veränderungen im Verhalten von Menschen, abhängig von ihrer Situation. Nur dass eben bestimmte Situationen in bestimmten biologischen Altersstufen gehäufter auftreten als in anderen.
»›Konservativ‹ und ›progressiv‹ sind historisch-soziologische Kategorien, die an einer bestimmten konkretinhaltlichen historischen Dynamik orientiert sind, während ›alt‹ und ›jung‹, ›generationsmäßig neuartiger Zugang‹, formal-soziologisch gemeint sind. Ob eine bestimmte Jugend konservativ, reaktionär oder progressiv ist, entscheidet sich (wenn auch nicht ausschließlich, aber doch in erster Reihe) dadurch, ob sie am vorgefundenen Status der Gesellschaft von ihrem sozialen Orte aus Chancen der eigenen sozialen und geistigen Förderung erwartet.« 24
Worum es in einer Diskussion von Renitenz also auch gehen wird, ist, diese Situationen, diese Lagerung im sozialen Raum virtuell und real zu verändern und dadurch möglicherweise Verhalten zu verändern.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer neigen dazu, die Popanz-Technik zu nutzen, um nicht lernen zu müssen oder um die Autorität, die Lehrberechtigung der Lehrkraft in Frage zu stellen.
Mit der Popanz-Technik wird vom Lehrer angenommen, dass sein Wissen vollkommen ist, damit ihm bei der ersten Spur der Unvollkommenheit durch einen Falsifizierungsschritt Unfähigkeit vorgeworfen werden kann.
Die Auszahlung bei diesem Spiel ist gleich mehrfach:
•Ich kann mich am Lehrer für seine Übermacht im Unterricht rächen,
•Ich kann meinen eigenen Unfähigkeiten gegenüber nachsichtig sein: »Wenn es nicht mal der Lehrer kann ...«
•Ich habe die Genugtuung, den Vorschlägen der Lehrer nicht folgen zu müssen - ich behalte die Entscheidungsmacht bei mir.
•Ich habe den Genuss, Ansprüche stellen zu können ohne diese selbst je erfüllen zu müssen.
•Ich genieße die Schadenfreude doppelt, einmal überhaupt und zum zweiten nach »oben«.