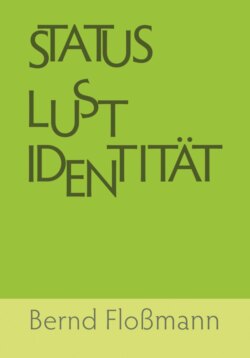Читать книгу Status – Lust – Identitaet - Bernd Floßmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lehren und Herrschen
ОглавлениеDie Frage, warum jemand etwas tut, oder warum jemand etwas getan hat, stellt sich, abhängig vom Ergebnis einer Handlung, mehr oder weniger ernsthaft und intensiv. Ob es um die Vase von Erbtante Erika oder um ein Ventil im Atomkraftwerk Tschernobyl geht oder um die politische Entscheidung für ein Eingreifen in einem lokalen Konflikt, die Struktur des motivierten Handelns ist ähnlich. Die Folgen dieses Handelns aber betreffen uns und je nach dieser Betroffenheit sind wir an der Beeinflussung von Verhalten interessiert.
Aristoteles, der Zusammenfasser des Wissens zu seiner Zeit, ging bei seiner Untersuchung des Handelns in der »Nikomachischen Ethik« davon aus, dass jedes Handeln einem Zweck oder einem Ziel, der Erreichung eines Gutes zu dienen scheint. Das Höchste dieser Güter war für ihn die Glückseligkeit.
Aristoteles geht so vor: Erst haben wir, mehr oder weniger bewusst, einen Zweck, dann handeln wir. Alles Andere ist nur Bewegung. Wenn ich also die Zwecke der Menschen kenne, kann ich ihr Handeln begreifen und wenn ich den Menschen Zwecke setzen kann, kann ich Menschen (ver-) führen, meine Zwecke zu erfüllen. Handlungstheorie ist somit die Basis für die Ethik. Und die Ethik ist die Basis für verantwortungsvolles Handeln. Soweit der Traum von Aristoteles und der meisten jener, welche seitdem versucht haben, die Motive von Menschen zu beeinflussen oder wenigstens zu erkennen.
Wir haben hier einige Grundfragen der Macht und der Lehrtheorie versammelt.
Machttheorien fragen seit jeher in drei Richtungen:
•Warum hat jemand etwas getan?
•Was kann ich tun, damit jemand Anderes etwas tut, was mir recht ist?
•Worauf kann ich hoffen? Welche Veränderungen sind möglich?
Die erste Frage ist analytisch, die zweite synthetisch, die dritte utopisch. Diese Fragen erinnern an Immanuel Kant, der diese drei Fragen grundlegend umdrehte und als Fragen formulierte, welche durch die Philosophie beantwortet werden müssen, um ein Leben als aufgeklärter Mensch führen zu können:
•Was kann ich wissen? Diese Frage wird durch die Kritik der reinen Vernunft, besonders die Erkenntnistheorie beantwortet.
•Was soll ich tun? Diese Frage ist die Kernfrage der so genannten praktischen Philosophie oder der Ethik. Sie ist Kern aller modernen Handlungs- und Führungstheorien.
•Was darf ich hoffen? Diese Frage wird durch Kant nicht beantwortet, denn sie ist utopisch. Hoffnung und Angst sind die Bereiche, in denen sich die Geheimnisse der intrinsischen Motivation, jener geheimnisvollen Gründe für menschliches Verhalten verstecken. Unbewusstes, Instinktives, Religiöses, Esoterisches, Schamanisches wird hier diskutiert und ausprobiert. Ich lese jedoch Utopia (οὐτοπία) Kein–Ort als kein–bestimmter–Ort, als überall!3 Damit ist für mich der Ort und die Zeit der Hoffnung nicht N–irgendwo und N–irgendwann sondern Überall und Immer.
Kant vollzieht eine Wende von der allgemein üblichen über extrinsische, von äusseren Beweggründe, Strafen und Lohn (Lehen), Zuckerbrot und Peitsche bewirkten Beeinflussung von Verhalten hin zu intrinsischem, von inneren, allein aus dem Subjekt stammenden Beweggründen bewirktem Verhalten.
Es könnte eingewendet werden, dass Bildung nicht immer Verhaltensänderungen anstrebt, sondern mitunter auch nur Wissen, Bewusstheit oder eine gewisse Einfühlung ermögliche. Doch auch in diesen Zusammenhängen steht die Hoffnung, dass die Vermittlung von Wissen oder, in einer weiteren Stufe der Pädagogik, die reine Verbesserung des Zugangs zu Wissen die Bedingungen bereitstellt, welche letztlich eine Verhaltensänderung bewirken.
Es ist wie bei einem Verkauf. Sicher gibt es eine Informations- und Planungsphase, in der Beratung im Zentrum steht. Wenn es aber dann nicht zum Vertragsschluss und zur Vertragsausführung kommt, erweisen sich Informationen und Planung als wertlos. Bestenfalls kann sich dieser Aufwand auf spätere Transaktionen auswirken.
Diese Bewegung kann in der gegenwärtigen Diskussion um Motivationstheorien wie in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion ebenfalls beobachtet werden. Die »kopernikanische Wende«, welche Kant anstrebte, ist offensichtlich nicht einfach zu vollziehen und dann Schluss, sondern eine ständige Aufgabe.
Sicher kann der Anfang darin bestehen, erst mal selbst richtig zu handeln4, so wie es Immanuel Kant für das eigene Handeln fordert: »[...] handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.«5. Das aber ist anstrengend und es besteht immer die Gefahr, die Ursachen und damit die Schuld für die jeweilige Misere bei sich selbst zu finden. Deshalb lässt Goethe auch Erichtho6 am Beginn der klassischen Walpurgisnacht sagen:
»Wie oft schon wiederholt’ sich’s! wird sich immerfort
Ins Ewige wiederholen... Keiner gönnt das Reich
Dem andern, dem gönnt’s keiner, der’s mit Kraft erwarb
Und kräftig herrscht. Denn jeder, der sein innres Selbst
Nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern
Des Nachbars Willen, eignem stolzem Sinn gemäß...«7
Pädagogik8 ist Menschenführung, so wie Menschenführung, Demagogik9, pädagogische Elemente hat. Die Führer von Menschen könnten also von der Pädagogik lernen, wie die Pädagogik aus der Führung von Menschen gelernt hat. Die Geschichte kann als eine Abfolge erzählt werden, in der immer wieder die Sklaven, die Knechte, die Herren ablösen. Das bleibt nicht unbeobachtet. Die gebildete rhetorische Kraft der Sophisten, Juristen und Politiker wird daher mit Misstrauen gesehen. Das kann auch am Bedeutungswandel des Wortes Demagoge und an der Wertung von Pädagogik abgelesen werden.
Wer die Macht hat, braucht keine Rhetorik, kein Wissen, keine Fertigkeiten. Das was er braucht, kann er erpressen oder kaufen. Interesse an Wissen haben vor allem diejenigen, welche sich auf die Macht vorbereiten, welche Macht erringen wollen.