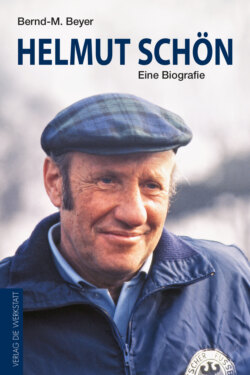Читать книгу Helmut Schön - Bernd-M. Beyer - Страница 37
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EXKURS Helmut Schön und der Untergang des alten Dresden
Оглавление»Es war geradezu ein schwebendes Stadtgebilde, eine prachtvolle Komposition vor allem des Barock und Rokoko, aber auch klassizistischer Bauten und der Konstruktionsformen des industriellen Zeitalters, alles miteinander versöhnt und verbunden in einem Stadt-Organismus aus Kirchen und Palästen, Brücken und Terrassen, Parks und Alleen, Gassen und Gärten, ein Gemeinwesen voll alter Kunst und neuem Leben, wie man es sich harmonischer nicht denken konnte.«
So elegisch beschrieb Helmut Schön in seiner Autobiografie ein Stadtbild, das nur noch Erinnerung war.
In den Tagen und Nächten des 13., 14. und 15. Februar 1945 wurde Dresden das Ziel verheerender Bombenangriffe durch britische und US-amerikanische Flugzeuge. Diese Form brutaler Kriegsführung hatte erstmals die deutsche Luftwaffe im spanischen Bürgerkrieg praktiziert; berüchtigt wurde der verheerende Angriff der »Legion Condor« auf die baskische Stadt Guernica am 26. April 1937. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs bombardierte die deutsche Luftwaffe zunächst Städte vor allem in Polen, den Niederlanden und England, bevor alliierte Bomber den Horror nach Deutschland zurückbrachten. 1940 wurden die ersten deutschen Städte angegriffen, in den Jahren 1942 und 1943 folgten die großen Flächenbombardements, bei denen die Innenstädte unter anderem von Hamburg, Köln und Hannover nahezu vollständig zerstört wurden. Zehntausende starben.
Dresden blieb lange verschont; bis zum Herbst 1944 lag die Region außerhalb der Reichweite alliierter Bomber. In den Straßen der Innenstadt drängten sich durchziehende Menschen, hier trafen sich die Pferdefuhrwerke der westwärts strebenden Flüchtlingstrecks mit Infanteriekolonnen und dem Nachschub für die Ostfront. Als Verkehrsknotenpunkt und letzte intakte Garnisonsstadt musste Dresden mit Luftangriffen rechnen; doch das Inferno, das am 13. Februar 1945 folgte, übertraf die schlimmsten Befürchtungen.
Helmut Schön erlebte und überlebte den Feuersturm. In seiner Autobiografie hat er eindringlich von seinen Erlebnissen berichtet; Auszüge aus dieser Schilderung werden im Folgenden abgedruckt. Die Zahl von 135.000 Toten, die Schön darin nannte, entsprach dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung (1978); teilweise kursierten noch erheblich höhere Opferzahlen. Die neuere Forschung hat ermittelt, dass diese Angaben auf übertriebenen Meldungen der nationalsozialistischen Propaganda beruhten. Eine von der Stadt Dresden berufene Historikerkommission kam nach langwierigen Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass durch die Luftangriffe zwischen 18.000 und 25.000 Menschen starben. Doch auch dies ist eine entsetzlich hohe Zahl.
Helmut Schön hat nichts darüber geschrieben, in welcher Weise ihn die Erlebnisse in seinem späteren Leben innerlich verfolgt haben. Doch dass sie ihn nur schwer losließen, dessen ist man sich sicher, wenn man seinen Bericht gelesen hat.
An diesem 13. Februar hatte ich als »Luftschutzleiter« meiner Firma in Radebeul Dienst. Jeder kam mal ran. Ich mußte also die Nacht im Werk verbringen, konnte nicht zu meiner Frau nach Dresden hinein.
Wir hörten in einem Kellerraum der Firma den sogenannten Drahtfunk. Er meldete: »Schwere angloamerikanische Bomberverbände im Anflug auf Nürnberg und Leipzig«. Dann wurden Planquadrate durchgegeben, in denen sich die Bomber befanden. Viele Deutsche hatten sich damals eine Landkarte mit diesen Planquadraten organisiert, um jede Nacht genau zu wissen: Kommen wir diesmal ran? Wann geht es wieder los mit dem Alarm? Der Drahtfunk war auf Langwelle leicht abzuhören.
»Wetten, diesmal erwischt es uns«, sagte einer der Kollegen.
»Na, die biegen doch noch ab«, meinte ein anderer.
»Die Richtung ist so verdächtig … Vielleicht kommt heute Nacht Leipzig dran. Aber wahrscheinlich wollen die bis rauf nach Berlin«, meinte ich. »Es sieht trotzdem mulmig aus. Hoffentlich lassen nicht so ein paar Idioten aus lauter Nervosität bei uns was fallen. Ich werde mal lieber meine Frau anrufen.«
Ich telefonierte mit Annelies. Sie hörte ebenfalls Drahtfunk. »Hört sich ganz schön blöd an, was? Die größte Bomberflotte, die jemals deutsches Reichsgebiet angeflogen hat, haben sie gesagt. Wie gut, daß Stephan draußen bei den Großeltern ist.« Sie wohnten am Stadtrand.
Trotz bedenklicher »Luftlage«, wie man damals sagte, waren wir uns der wirklichen Gefahr nicht bewußt.
Meine Frau hatte sich für diesen Abend vorgenommen, einmal gründlich alle Strümpfe zu stopfen. Sie saß auf der Couch, hatte die Strümpfe fein säuberlich neben sich gelegt und hörte beim Stopfen Radio. […]
Meine Frau dachte sich schon, daß es Alarm geben würde und sie in den Luftschutzkeller müßte. Aber das beunruhigte sie nicht besonders. Sie war auf alles vorbereitet. An diesem 13. Februar hatte Annelies die Wintersachen zusammengepackt. Der Winter war vorbei, das spürte man. Da konnte nicht mehr viel Kälte kommen. Die großen Koffer standen fix und fertig auf der Diele. Sie wollte sie am nächsten Tag raus zu Stephans Großeltern bringen und die Frühlings- und Sommersachen von dort abholen.
Dann heulten die Sirenen: Alarm. Sie nahm die Koffer und ging hinunter in den Keller. Es war kurz nach zehn Uhr abends.
Es war ein Luftalarm wie jeder andere, und alle Deutschen waren inzwischen daran gewöhnt, Nacht für Nacht. Diese Gewohnheit der Gefahr gab uns Sicherheit für den Augenblick.
Vierzehn Kilometer von meiner Frau entfernt, draußen in Radebeul, lief ich hinaus ins Freie, weil ich es vor Ungeduld nicht mehr aushielt. Es war viertel nach zehn. Mit ein paar Kollegen setzte ich mich ins Pförtnerhäuschen unserer Firma. Wir starrten nach Süden, wo Dresden lag.
Plötzlich schrie einer von uns auf.
»Da! Da! Die Weihnachtsbäume …«
Unheimlich langsam, unheimlich schön sanken Garben von Leuchtkörpern durch das Dunkel hinunter und erhellten den Himmel über Dresden. So traumhaft und friedlich es aussah, so furchtbar erschien es uns. Wir wußten: Es sind Markierungslichter für die alliierten Bomberflotten.
»Das ist der Tod von Dresden«, sagte einer.
Ein unheimliches, gedämpftes, orgelndes Brummen erfüllte die Nacht: das Motorengeräusch der amerikanischen »Fliegenden Festungen«.
Es wurde immer heller über Dresden. Wir hörten keine Detonationen, nicht das Krachen jener riesigen Bomben, die man »Luftminen« nannte. Der Wind stand gegen Dresden, wir hörten nichts – und das war viel schlimmer. Die Alliierten praktizierten wieder ihre Vernichtungs-Technik, mit der sie schon Hamburg und Berlin weitgehend verheert hatten: Sie warfen Abertausende von Brandbomben, die an sich harmlos aussahen, gut einen halben Meter lange, armdicke Stäbe. Aber diese Brandbomben setzten Dachstühle in Brand. Die Brände vereinigten sich, heizten sich gegenseitig auf, erzeugten durch enorme Hitzegrade einen Feuersturm, der 200 Stundenkilometer und mehr erreichen konnte und ganze Stadtviertel wie Zunder wegbrannte.
Ich versuchte, Annelies telefonisch zu erreichen. War unser Haus getroffen, abgebrannt? Die Leitung war tot. Aber ein Bruder unseres Chefs, Hans Madaus, erreichte uns: »Unser Haus brennt. Kommt, so schnell es geht.«
Wir nahmen einen kleinen Lastwagen und fuhren am Stadtrand entlang. Dresden brannte lichterloh. Ich mußte nicht weinen. Ich war nicht außer mir vor Verzweiflung. Ich fühlte mich nur angespannt zum Zerreißen. Später erfuhr ich, daß die Innenstadt in sieben Kilometern Länge und vier Kilometern Breite ein einziges Inferno war. Aus ihm ist kaum ein Mensch entkommen.
Der Brand der Madaus-Villa war halb so schlimm. Ein Kollege wollte den Laster zurück nach Radebeul fahren und setzte mich unterwegs ab. Ich hatte nur eines im Kopf: »Was ist mit Annelies, steht das Haus noch?«
Hätte ich gewußt, wie es ihr in diesem Augenblick ging, ich hätte Gott auf Knien gedankt. Ein paar Entwarnungssirenen hatten geheult, lang, einförmig, winselnd. Die Leute im Keller Münchner Platz 16, der Apotheker, der Kohlengroßhändler, meine Frau, hatten ihre Koffer genommen und waren wieder hinaus in ihre Wohnungen gegangen.
Annelies erzählte mir später alles: »Bei uns oben waren nur ein paar Scheiben kaputt, in der Diele. Ich habe im Treppenhaus noch Scherben zusammengefegt und dann zwei alten Damen geholfen, ihre Koffer hinaufzutragen. Ich sah, daß es ringsum brannte. Drei Häuser am Münchner Platz standen in Flammen. Aber – das ist wohl das merkwürdigste an menschlichen Reaktionen im Krieg, in einer Katastrophe – ich nahm das apathisch hin. So war das nun mal. Ich habe mich in aller Ruhe ausgezogen, mein Nachthemd angezogen und mich ins Bett gelegt. Keine Vorsichtsmaßnahmen. Nicht: angezogen aufs Bett, weil ja jeden Augenblick wieder Alarm sein konnte … Nein, ich bin sofort eingeschlafen.
Ein Donnern, ein Poltern an der Wohnungstür weckte mich, ich wußte überhaupt nicht, was los war. Im Nachthemd öffnete ich. Draußen stand mein Vater, mit entsetztem Blick, wirrem Haar.
›Annelies! Komm! Die Bomben! Der zweite Angriff! Du musst sofort in den Keller!‹
Zweieinhalb Stunden nach dem ersten Angriff hatte eine zweite Welle von Bombern Dresden angeflogen. Jetzt krachten Sprengbomben in das Flammenmeer. Ich hatte das alles nicht gehört und weiter geschlafen.
Mein Vater war aus Sorge um uns mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren, gleich nach der ersten Entwarnung. Dann gab es wieder Alarm, und er erreichte mit Müh’ und Not noch unseren Luftschutzkeller. Er schleppte mich in den Keller und übernahm dort unten gleich das Kommando. Man merkte, daß er im Ersten Weltkrieg Husar gewesen war. Mit seinem bestimmten Ton beruhigte er die Frauen, die laut weinten. Er tröstete die alten Leute, die nur noch jammerten.
Auf einmal knallte es furchtbar. Das Licht im Keller ging aus. Eine Schauspielerin, die in unserem Haus wohnte, begann laut zu beten.
Da brüllte mein Vater: ›Alles niederknien! Mund halten!‹ Keiner sagte mehr ein Wort.
Es war totenstill. Vaters Anweisung hatte Sinn. Durch das Niederknien und Schließen des Mundes wollte er uns so gut wie möglich vor den Folgen des Luftdrucks schützen, falls eine Bombe in nächster Nähe explodierte …«
Zur gleichen Zeit hetzte ich durch die brennende Stadt, in Richtung Münchner Platz. Als die Sirenen wieder aufheulten, war ich gerade am Neustädter Markt, wo das schöne Denkmal von August dem Starken steht. Da fielen schon die ersten Bomben. Ich konnte mich gerade noch in einen öffentlichen Luftschutzraum quetschen. Hier waren ein paar hundert Menschen zusammengepfercht.
Wir hörten, wie der Einschlag der Bomben immer näher kam: Die Erde bebte. Der Putz fiel uns auf die Köpfe. Frauen schrien. Kinder kreischten. Plötzlich brachen Steine aus der Wand des Luftschutzraums. In einer Mauerlücke tauchten, völlig grau bestäubt, mehrere Frauen mit Kindern auf. Sie hatten einen Mauerdurchbruch aufgebrochen, um zu uns zu kommen.
Die Bomben schlugen weiter ein. Neben mir saß eine Frau, die bei jeder Explosion ihre Hand in mein Bein krallte.
Ich bin ganz ehrlich: In diesen Minuten war ich vor Angst fast von Sinnen. Es ist wohl allen so gegangen. Als die Explosionen abnahmen, breitete sich eine grauenhafte Stille im Luftschutzraum aus. Die Menschen stierten vor sich hin ins Nichts.
Ich wollte hier raus. Ich bin losgesaust, über die Augustus-Brücke, Richtung Schloß. Es brannte wie eine Fackel. Feuer, überall Feuer. Brennende Häuser fielen zusammen. Auf den Straßen lagen Frauen, schwarz verkohlt oder ausgetrocknet wie ägyptische Mumien. Sie hatten Kinder im Arm: Aschenbündel. Alle tot, verbrannt, in den wahnwitzigen Hitzegraden des Feuersturms in Sekundenbruchteilen mumifiziert. Skelette lagen da. Daß es sich um Männer handelte, sah man noch an der Gasmaske vor dem Gesicht.
Die Luft war von einem furchtbaren Geheul erfüllt: Der Sog des Feuersturms erzeugte den unbeschreiblichen Ton.
Je näher ich unserem Haus kam, um so mehr würgte mich die Angst: Brennt da auch alles? Dann kam der Münchner Platz. Unser Haus stand.
Es war wie ein Wunder: vor hundert Metern noch Flammenwände und hier alles in Ordnung.
Ich taumelte auf unser Haus zu. In diesem Augenblick öffnete sich die Haustür, und meine Frau trat mir entgegen. Sie sah mich an, als wäre ich ein Gespenst. Sie glaubte, ich wäre draußen in Radebeul.
Wir fielen uns in die Arme. Die Nachbarn und der Vater meiner Frau hatten begonnen, die Möbel aus dem Haus zu schaffen und auf die Straße zu stellen. Zwei alte Luftschutzwarte kamen und sagten:
»Ja, auch unser Haus brennt!«
»Was denn? Ich sehe doch nichts!«, antwortete ich.
»Oben auf dem Boden!«
Ich bin hinaufgerast. Tatsächlich hatte das Feuer vom Nebenhaus auf unseren Dachstuhl übergegriffen. Aber es brannte nur in einer Ecke. Ich habe in die Flammen hineingeworfen, was ich zu fassen bekam, Sand und alte Decken. Nach einer Viertelstunde war das Feuer erstickt. Das Haus Münchner Platz 16 steht heute noch.
Am nächsten Tag kam der nächste Angriff. Es war um die Mittagszeit. Diesmal gab’s nur Sprengbomben. Wir hatten immer noch nichts von meinem alten Vater gehört. Wir wußten nicht, ob mein Elternhaus in der Struvestraße überhaupt noch stand. Wir gingen hin, als die Sirenen Entwarnung gaben.
Das Haus war ein Trümmerhaufen. Wir fragten nach meinem Vater. Ja, man hatte ihn gesehen, aber er sei dann verschwunden …
Vater war tot, das schien mir sicher. Wie sollte ein siebenundachtzigjähriger Mann aus dieser Hölle entkommen sein?
Fünf Tage lang brannte Dresden. Dennoch benahmen wir uns, als wäre alles fast wieder normal. Wir waren gehorsame Bürger des Chaos, zogen zu unseren Schwiegereltern am Stadtrand um, hatten unseren Stephan wieder. Ich fuhr jeden Tag mit dem Rad zur Firma nach Radebeul und zurück. Ich mußte immer an Vater denken. Jeden Tag habe ich bei der Rückkehr gefragt: »Habt ihr etwas von Vater gehört?« Nichts.
Drei Tage waren vergangen, da radelte ich wieder nach Hause. Mich überkam ein ganz seltsames Gefühl. Während ich in die Pedalen stampfte, sprach in mir eine Stimme im Rhythmus des Tretens: »Der Vater lebt – der Vater lebt – der Vater lebt.«
Da kommt mir schon meine Frau entgegen. »Helmut …«, schreit sie. Ich werfe das Rad weg und rufe: »Du brauchst mir gar nichts zu sagen: Der Vater lebt!«
»Ja …« Wir haben zusammen geweint. Ich weiß nicht, woher ich meine Gewißheit hatte.
Ich ging in die Wohnung hinein. Da saß er. Er hatte rote Augen. Sie waren ganz entzündet von dem vielen Feuer, das er gesehen hatte und durch dessen Hitze er gegangen war.
Meiner Frau hatte er inzwischen seine Geschichte erzählt: »Du weißt ja, daß Vater nie geglaubt hat, die Engländer würden Dresden bombardieren. Darum ist er beim Alarm auch im Bett geblieben. Dann schlug es in der Nähe ein, und ein brennendes Fensterkreuz fiel Vater auf die Bettdecke, aufs Gesicht. Du siehst ja, er hat die Schramme da … Dann ist er doch raus und runter in den Keller. Aber als die erste Entwarnung kam, ist er losgelaufen, in Richtung Bürgerwiese. Da hat er seinen Ehering vergraben, unter einem Baum im Großen Garten. Warum, weiß ich nicht.
Er muß dann Tag und Nacht durch Dresden geirrt sein.
›Ich bin über die heißen Steine gelaufen‹, hat er erzählt. ›Über die heißen Steine, in die Hofkirche …‹ Auch die Hofkirche war schwer beschädigt. Dort hat er wohl, mitten im Inferno, gesessen und gebetet.
Das Furchtbarste, was er sagte, war: ›Überall waren Neger! Tote Neger! So viele tote Neger …‹ Er meinte die schwarzverkohlten Leichen. Er war sehr verwirrt.
An einem Vormittag haben ihn Bekannte dann irgendwo in der Innenstadt gefunden. Er saß auf einem Bordstein und starrte vor sich hin.«
Meine Frau schluchzte. Wir waren gerettet. Aber mindestens 135.000 Menschen lagen tot überall auf Dresdens Straßen. Als keine Bomber mehr kamen, ging ich in die Innenstadt. Die berühmte Prager Straße war abgesperrt. Ich traf dort einen Bekannten, einen Hauptmann in Uniform. Der stand da wie gebrochen. Er sagte: »Helmut, ich muß jetzt wieder hier rein. Aber ich kann nicht mehr. Und ich muß trotzdem den Leuten sagen: Ihr müßt!«
Sie trugen die Leichen zusammen und schleppten sie zum Altmarkt. Dort, wo die Kreuzkirche stand, wo der Kreuzchor gesungen hat, wurden an die 30.000 Leichen gestapelt und dann mit Flammenwerfern vernichtet. An gigantische Zahlen waren wir gewöhnt, auch was die Opfer des eigenen Landes betraf. Das war abstrakt. Jetzt konnte man die Wirklichkeit sehen: 30.000 einzelne, fürchterlich umgekommene Menschen.
Ich ging nach Hause. Es war regnerisch. Überall sah der graue Vorfrühlingshimmel durch die ausgebrannten Fassaden, die leeren Fenster. […]
Ein paar Monate später, der Krieg war aus, die Russen waren da, geschah etwas, was mich bis heute tief bewegt und mir wie ein Zeichen erscheint. Der Flieder blühte in der Bürgerwiese so schön wie lange nicht, es war Sommer. Vater ging eines Tages in den Anlagen spazieren. Im Großen Garten hat er zielsicher an einer bestimmten Stelle mit dem Spazierstock im Boden gestochert. Es glänzte – da lag sein Ehering.
Er hat ihn sich wieder angesteckt. Er hatte sich selbst wieder – die Hoffnung, daß es doch noch etwas Schönes auf der Welt gab.