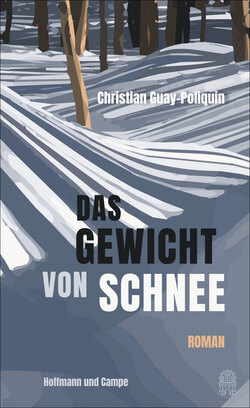Читать книгу Das Gewicht von Schnee - Christian Guay-Poliquin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fünfundvierzig
ОглавлениеÜber Nacht muss es geschneit haben, doch heute Morgen ist der Himmel hart und blau. Die Eiszapfen an der Traufe glitzern.
Auf dem Ofen steht ein großer Topf voll Schnee. Im Herbst hat Matthias das Wasser direkt aus dem Bach geschöpft, der zum Dorf hinunterfließt. Es war kristallklar und schmeckte nach Kieseln und Wurzeln. Manchmal musste er morgens eine Eisschicht entfernen, um den Eimer zu füllen. Anfangs ließ sie sich noch leicht zerbrechen, später musste er einen Ast zu Hilfe nehmen, noch später ein Beil. Eines Tages war ihm der Aufwand zu groß, seitdem schmilzt er Schnee. Das Wasser schmeckt anders, aber ich kann mich nicht beschweren. Matthias kümmert sich um alles. Er heizt den Ofen, kocht das Essen, leert den Kloeimer. Er trifft alle Entscheidungen, er trägt die Verantwortung. Er ist der Herr über Zeit und Raum.
Ich hingegen bin nutzlos, schwach und kann mich kaum bewegen. Mir fehlt sogar die Kraft, zu reden, mich zu unterhalten. Und auch die Lust. Stattdessen brüte ich stumm vor mich hin. Anfangs verstand Matthias mein Schweigen nicht. Mit der Zeit hat er sich offenbar daran gewöhnt.
Ich weiß nicht genau, was seit dem Unfall alles passiert ist. Vor Schmerzen, Fieber und Erschöpfung kommt es mir vor, als hätte der Schnee in seiner Unrast die gewohnte Länge der Tage und Wochen aufgehoben. Alles scheint mir sehr schnell gegangen zu sein. Der Unfall, die Patrouille, die Operation, und dann war ich plötzlich hier, bei Matthias. Ich weiß, dass er mich nicht haben wollte. Dass meine Anwesenheit ihn stört, ihm ungelegen kommt. Dass er andere Pläne hatte. Seit dem Stromausfall läuft nichts, wie er sich das vorgestellt hat.
Als die Patrouille mich unter dem umgedrehten Auto fand, sahen die Männer gleich, wie schwer ich verletzt war. Sie dachten, sie könnten nichts mehr für mich tun. Meine Beine waren bei dem Aufprall zerquetscht worden, und ich hatte viel Blut verloren. Zum Glück leuchteten sie mir ins Gesicht, und einer der Männer meinte, mich zu erkennen. Er überredete die anderen, mich ins Dorf zu tragen.
Es war ein Regentag. Wie aus Kübeln ergoss sich das Wasser auf den Wald. Ich weiß noch, dass die Männer, die mich trugen, durch tiefen Schlamm waten mussten. Im Dorf gab es keinen Arzt. Nur eine Tierärztin und einen Apotheker. Seit dem Stromausfall waren sie es, die Kranke und Verletzte behandelten. Sie kümmerten sich auch um die schweren Fälle, bei denen wenig Hoffnung bestand.
Ich erwachte in einem dunklen Raum. Meine Beine steckten in dicken Verbänden, und ich war mit Handschellen ans Bett gefesselt. Das Fenster hatte man zugenagelt, nur durch die Ritzen fiel etwas Licht. Immer wenn ich den Kopf hob, um zu verstehen, wo ich war, durchfuhr mich ein stechender Schmerz.
In regelmäßigen Abständen kam jemand an mein Bett. Brachte mir was zu essen. Gab mir Tabletten. Stellte Fragen. Wie ich hieß? Wo ich herkam? Wie es zu dem Unfall gekommen war? Ich hatte Schmerzen, schlimme Schmerzen, und meine Welt bestand nur noch aus Schatten, die sich über mich beugten wie über einen Brunnenschacht. Wieder und wieder dieselben Fragen. Doch obwohl ich nach Leibeskräften schrie, schien keiner meine Antworten zu hören. Wahrscheinlich überlegten sie hin und her, ob sie mein Leiden beenden oder versuchen sollten, mich gesundzupflegen.
Wenn sie mich dann endlich allein ließen, spitzte ich die Ohren. Kommen und Gehen im Nebenzimmer. Manchmal hörte ich laute Stimmen, konnte den Gesprächen folgen. Manchmal flüsterten sie, und ich verstand kein Wort.
Der Unfall war heftig gewesen. Ich war verwirrt, träumte von meinem Auto. Suchte nach meinem Vater. Meine Erinnerungen gerieten durcheinander. Ständig wiederholten sich dieselben Szenen vor meinem inneren Auge. Die Tage und Nächte am Steuer. Der Stromausfall, die geplünderten Tankstellen, die bewaffneten Gruppen am Straßenrand, die Panik in den Städten. Und dann plötzlich, wenige Kilometer vor dem Dorf, im müden Licht der Scheinwerfer, zwei zum Himmel erhobene Arme. Reifenquietschen. Ich reiße das Lenkrad herum. Ein dumpfer Aufprall. Blut. Das Bersten der Windschutzscheibe. Überschläge. Mein Körper wird aus dem Wagen geschleudert. Dann das Gewicht des umgedrehten Autos auf meinen Beinen.
Ich war vor zehn Jahren aus dem Dorf weggegangen. Hatte seitdem so gut wie nichts von mir hören lassen. Ich hatte die Vergangenheit begraben und nie hierhin zurückgewollt. Trotzdem glaubte einer der Patrouillenmänner zu wissen, wer ich war, und bestand darauf, dass man mich versorgte. Seine Stimme drang laut und klar aus dem Nebenzimmer.
Schluss jetzt. Wir können ihn nicht einfach sterben lassen. Erkennt ihr ihn nicht? Das ist der Sohn vom Automechaniker. War lange nicht mehr hier. Er steht unter Schock, gebt ihm eine Chance. Sein Vater ist tot, aber er hat noch Familie im Dorf. Seine Onkel und Tanten wohnen oben am Weg zur Mine. Ich gehe sie holen.
Meine Onkel und Tanten kamen. Erst glaubte ich, Geister zu sehen, doch dann hörte ich ihre Stimmen und mir schossen Tränen in die Augen.
Ja, bestätigten die Onkel, entsetzt über meinen Zustand, das ist er. Die Tanten ergriffen meine Hände und versuchten zu verstehen, was passiert war. Ich war so glücklich, sie zu sehen, dass ich kein Wort herausbrachte.
Die Handschellen, sagten meine Tanten, nehmt ihm die Handschellen ab. Sofort.
Man erklärte ihnen, dass mich die Nachricht vom Tod meines Vaters sehr aufgeregt habe und ich wegen meiner Verletzungen stillliegen musste. Meine Onkel und Tanten verschwanden im Nebenzimmer. Sie redeten über mich und meine Situation, das verstand ich, hörte aber nicht genau, was sie sagten. Die Stimmen klangen ernst.
Wenig später kamen die Tierärztin und der Apotheker herein. Sie traten an mein Bett. Die Tierärztin schaltete ihre Stirnlampe ein und schnitt meine Verbände auf. Ich beobachtete sie aus dem Augenwinkel, ihr Gesicht kam mir bekannt vor. Als sie die Schwere meiner Verletzungen sah, verhärteten sich ihre Züge. Sie wandte sich fragend an den Apotheker. Der nickte. Während die Tierärztin einen Mundschutz anlegte und sich Gummihandschuhe überzog, sah ich an ihrem Blick, dass sie mich ebenfalls erkannt hatte. Der Apotheker hielt mir einen Schwamm vor Mund und Nase, und die Tierärztin wies mich an, bis zehn zu zählen. Ihre Stimme. Ihre Stimme weckte Erinnerungen. Ja, ich kannte diese Stimme, aber ein Name fiel mir nicht ein. Der Strahl ihrer Lampe glitt durch den Raum. Dann wurde alles schwarz.
Als ich wieder zu mir kam, wusste ich nicht, wo ich war. Zum Glück waren meine Tanten da. Ich hörte sie miteinander flüstern. Ich hob den Kopf und sah, dass meine Beine mit Schienen fixiert waren. Sobald meine Tanten merkten, dass ich mich regte, kamen sie an mein Bett.
Mach dir keine Sorgen. Die Operation ist gut verlaufen. Das wird schon. Du schaffst das. Hier, trink was. Ruh dich aus. Du musst wieder zu Kräften kommen. Ja, ruh dich aus.
Ich war unendlich müde und dämmerte bald wieder weg. Träumte, ich würde verfolgt, träumte von einer zähnefletschenden Bestie, von einem Labyrinth.
Am nächsten oder übernächsten Tag, ich weiß es nicht genau, besuchte mich der Patrouillenmann, der mich erkannt hatte. Er nahm mir auch endlich die Handschellen ab. Und er brachte mir Wasser, ein Stück Brot, etwas Thunfisch aus der Dose. Dabei stellte er mir erneut eine Menge Fragen. Als ich nicht antwortete, schwieg er einen Moment und änderte dann seine Strategie.
Weißt du, auch wenn der Strom irgendwann wiederkommt, wird nichts mehr so sein wie zuvor. Alles, was seit dem Stromausfall passiert ist, hat unser Leben für immer verändert. Wir kommen vielleicht besser klar als die Leute in den Städten, aber leicht ist es auch hier nicht. Am Anfang haben sich alle zusammengerissen, aber nach einer Weile brach Panik aus. Manche verließen das Dorf, andere versuchten, die Situation auszunutzen. Wir mussten für Ruhe und Ordnung sorgen. Jetzt verteilen wir die Lebensmittel und machen Wachgänge durchs Dorf. Wir müssen aufpassen. Die Stimmung kann jederzeit wieder kippen.
Die Tierärztin und der Apotheker kamen ins Zimmer und unterbrachen den Patrouillenmann.
Wie geht’s ihm?
Ganz gut.
Während der Apotheker mir einen ganzen Tablettencocktail verabreichte, untersuchte die Tierärztin meine Beine und maß meine Temperatur.
Kein Fieber, sagte sie.
Aber nur, weil er was dagegen bekommt, entgegnete der Apotheker.
Die Tierärztin beugte sich über mich und erklärte, dass meine Knochen mehrfach gebrochen seien. Zwar habe sie schon ähnliche Fälle behandelt, aber nur bei Hunden, Kühen und Pferden.
Ich lächelte sie an.
Sie fuhr mir mit den Fingern durchs Haar.
Du schaffst das.
Die beiden verschwanden mit dem Patrouillenmann im Nebenzimmer. Die Stimme des Apothekers war durch die Wand zu hören.
Er hat den Unfall überlebt und die Operation gut überstanden, aber seine Wunden werden sich entzünden. Das ist leider unvermeidlich. Er wird Antibiotika und Schmerzmittel brauchen, und unsere Vorräte sind begrenzt.
Sie überlegten, wer mich pflegen könnte. Meine Onkel und Tanten wahrscheinlich. Aber der Stromausfall überforderte sie alle. Es gab so viel zu tun. Wer hatte schon Zeit, sich um einen Schwerverletzten zu kümmern? Seine Wunden versorgen, ihn bekochen, ihn waschen?
Die Stimmen wurden leiser, ich verlor den Faden des Gesprächs.
Ein paar Tage später waren meine Beine geschwollen und die Wunden so empfindlich, dass ich kaum atmen konnte. Ich hatte Schüttelfrost und schwitzte. Nichts konnte ich ohne Hilfe tun. Die Leute wechselten sich an meinem Bett ab. Sie hielten sich die Ohren zu, um mein fiebriges Stöhnen und Wimmern nicht zu hören.
Zweimal am Tag kam die Tierärztin und gab mir eine Spritze. Dann hatte ich ein paar Stunden Ruhe, bevor der Schmerz mir wieder den Blick verschleierte.
Ich hab’s gewusst, seufzte der Apotheker, er wird all unsere Medikamente aufbrauchen.
Dank der Spritzen und Tabletten konnte ich schlafen. Doch beim Aufwachen wusste ich nie, ob ich wenige Minuten, ein paar Stunden oder mehrere Tage geschlafen hatte. Oft träumte ich, dass mich jemand zu Boden drückte und mir die Beine abhackte. Mit einer Axt. Das war kein schlimmer Traum, ich fühlte mich befreit.
Meine Onkel und Tanten kamen mich oft besuchen. Auch wenn ich alle um mich herum nur als Schemen wahrnahm, hörte ich sie reden, Geschichten und Witze erzählen. Eines Tages erklärten sie, dass sie nicht länger warten könnten. Die Jagdsaison hatte begonnen. Mehrere Familien waren schon in den Wald gegangen. Es gab immer noch keinen Strom, und sie mussten Vorräte für den Winter anlegen.
Wir ziehen in die Jagdhütte, verkündeten sie. In ein paar Wochen sind wir zurück, mit Fleisch, viel Fleisch. Wir hätten dich gern mitgenommen, aber das geht leider nicht. Mach dir keine Sorgen, du bist hier in guten Händen. Sie haben uns versprochen, dass sie sich gut um dich kümmern. Konzentrier du dich darauf, wieder gesund zu werden.
Sie verabschiedeten sich reihum von mir und verließen das Zimmer. Am liebsten hätte ich sie zurückgehalten.
Später kamen einige Leute zu mir. Der Patrouillenmann, die Tierärztin und der Apotheker waren auch dabei. Jemand ergriff das Wort und sagte, ich könne auf keinen Fall länger hierbleiben. Ich spürte ihre Blicke über die Wände huschen, zu Boden fallen, in den Ritzen verschwinden. Niemand wollte eine zusätzliche Bürde. Vielleicht hätte man mich besser unter dem Auto liegen gelassen. Die Tierärztin brach das Schweigen und sagte, sie könne sich bis zur Rückkehr meiner Verwandten um mich kümmern. Der Apotheker fiel ihr sofort ins Wort.
Wie stellst du dir das vor? Er kann nicht zu uns. Wir haben genug für ihn getan. Wir haben noch andere Patienten.
Der Patrouillenmann trat vor, als wollte er einen Gegenvorschlag machen. Sagte aber nichts.
Ich kann die Sache beenden, fuhr der Apotheker fort. Das wäre vielleicht für alle das Beste. Ihr seht doch, wie er leidet.
Schweigend suchte die Tierärztin den Blick des Patrouillenmanns, der immer noch mitten im Raum stand. Und daraufhin, glaube ich, kam ihnen die Idee mit dem Alten in dem Haus oben am Waldrand.
Ihr wisst schon, der Alte, der im Frühsommer bei uns aufgetaucht ist. Er hatte Probleme mit seinem Auto und war auf der Suche nach einer Werkstatt. Dann fiel der Strom aus, und er saß hier fest. Er ist in das leere Haus oben am Waldrand gezogen. Ab und zu, wenn er runter ins Dorf kommt, sage er, er müsse zurück in die Stadt. Seine Nachbarin komme ihn abholen. Aber sie ist nie aufgetaucht. Niemand glaubt ihm so richtig. Jedenfalls nimmt er die Lebensmittel, die wir ihm zuteilen, immer gern. Neulich bin ich ihm vor der Kirche begegnet. Wir haben uns kurz unterhalten. Sicher, er ist alt. Aber er wirkt kräftig und erstaunlich klar im Kopf.
Der?, fragte der Apotheker erstaunt. Vor einiger Zeit wollte der einen Transporter stehlen. Ich habe ihn dabei erwischt, wie er sich an der Tür zu schaffen machte. Er hat so getan, als ob nichts wäre. Ziemlich durchtrieben, der Alte. Aber warum nicht? Soll er sich um den Verletzten kümmern.