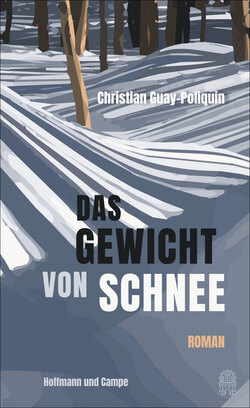Читать книгу Das Gewicht von Schnee - Christian Guay-Poliquin - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechsundfünfzig
ОглавлениеIch wache auf. Die Sonne steht schon hoch am Himmel, und die Kälte bringt den Schnee zum Funkeln. Ich habe in der Nacht schlecht geschlafen, meine Beine taten weh, als wären sie in Schraubstöcke gespannt.
Matthias kniet vor der Plastikwanne und wäscht Wäsche. Er seift unsere Kleidungsstücke ein, reibt sie kräftig, spült sie aus, hängt sie auf die Leine über dem Ofen.
Er geht mir auf die Nerven. Nicht nur weil er unermüdlich arbeitet, er ist auch noch ungeheuer beweglich. Er beugt sich vor, steht auf und dreht sich um, als wäre sein Alter nur Maskerade. Wenn ihm etwas aus der Hand rutscht, fängt er es häufig auf, bevor es den Boden berührt. Seine Bewegungen sind geschmeidig und kraftvoll. Mitunter langsam, aber immer geschmeidig und kraftvoll.
Meist arbeitet er schweigend, aber er kann auch geschwätzig sein. Wenn er meine Verbände wechselt, wenn er das Feuer schürt, wenn er in der Suppe rührt, wenn er abwäscht, brabbelt er oft vor sich hin, redet, erzählt. Er denkt laut. Vielleicht gebe ich deswegen nie eine Antwort. Die Welt, in der Matthias aufgewachsen ist, war unter dem Tagewerk begraben, davon erzählt er oft. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Straßen in seinem Dorf waren unbefestigt. Die Häuser voller Kinder, die die löchrigen Stiefel ihrer älteren Geschwister auftrugen. Im Mittelpunkt unseres Lebens standen schwere körperliche Arbeit und Gebete.
Das war eine andere Zeit, nimmt er den Faden seiner Erzählung wieder auf. Ich machte mich öfters aus dem Staub, wenn es zu Hause drunter und drüber ging, und besuchte den Schmied gegenüber. Am liebsten sah ich dabei zu, wie er das Eisen bearbeitete und mit den Pferden sprach. Wenn ich daran zurückdenke, höre ich wieder seine raue Stimme, rieche ich das verbrannte Horn, das Feuer und das glühende Eisen. In der Schmiede malte ich mir ein anderes Leben aus. Mir war, als könnte ich auf jedem frisch beschlagenen Pferd an einen fernen Ort reiten. Meine Eltern starben früh und nahmen ihre Epoche mit ins Grab, ich übernahm das Haus, und nach und nach verstummte die Vergangenheit. Das Feuer im Schmiedeofen erlosch. Die Zeitungen riefen die Zukunft aus, hochtrabende Versprechen wurden gemacht. Wenige Kilometer entfernt schoss das Gerippe einer Stadt in die Höhe. Die rauchenden Schlote spuckten Träume in den Himmel, und man schwärmte von Straßenbeleuchtungen, Tunneln und Gebäuden höher als jeder Kirchturm. Meine Kinder kamen zur Welt, Felder wurden zubetoniert, die Kirche verschwand in Hochhausschluchten. Das Haus der Familie verlor sich in einem Irrgarten aus Kreuzungen, Schnellstraßen und Werbetafeln. Überall ragten Kräne vor dem Horizont auf, der drückende Geruch von Teer lag über den Dächern, und auf den Straßen öffnete man der Stadt unermüdlich den Bauch, nur um ihn gleich wieder zuzuschütten. Von meinem Balkon aus hörte ich den Sirenengesang. Manchmal sah ich Krankenwagen mit Blaulicht vorbeirasen. Ein fernes, anonymes Unglück. Irgendwann zogen die Kinder aus, und mit einem Mal war das Haus groß und leer. Uhrenticken füllte die Zimmer. Wir waren allein, meine Frau und ich, blickten hinaus auf ewige Baustellen, auf Arbeiter mit schweißnasser Stirn und auf Bagger, die ächzend ihren Arm ausstrecken wie fügsame Bestien. Ich weiß noch, dass in jedem Sonnenstrahl Staubkörner schwebten. Kamen die Enkel zu Besuch, war es ein Fest. Meine Frau strahlte über das ganze Gesicht. Selbst nach fünfzig gemeinsamen Jahren war ich fasziniert von ihrer Schönheit, ihrem Charme, ihrer Anmut. Aber die Zeit ist tückisch. Meine Frau klammerte sich zunehmend an Routinen. Ihr Gedächtnis ließ nach, ihre Stimme verlor sich im Dickicht der Sätze. Sie verfiel in ein verstörtes, stures Schweigen. Ihre Bewegungen wurden abgehackter. Ihr Blick füllte sich mit Unsicherheit. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden den anderen als Erstes nicht wiedererkannte. Eines Tages fiel sie im Badezimmer hin. Ich spürte das nahe Ende. Ein Telefonat, dann das Warten auf den Krankenwagen. Sie wurde ein paar Straßen weiter in ein Gebäude gebracht, das nur aus Aufzügen und Fluren bestand. Ich besuchte sie jeden Tag. Bald verblassten ihre Pupillen, nichts schien sie noch zu behelligen. Sie fand ihr Lächeln wieder, aber es gab kein Anzeichen dafür, dass sie jemals von ihrer verwunschenen Insel zurückkehren wollen würde. Immerhin wusste sie, dass ich jeden Tag kam. Jeden Tag. Im Alter lässt das Zeitgefühl nach, und man fürchtet Erinnerungen mehr als das Vergessen. Ich brauchte eine Pause. Ich musste mal raus. Also fuhr ich weg, in meinem alten Auto, für eine Woche. Ich wollte etwas vom Land sehen und den Kopf freibekommen. Eine große Runde drehen und eine Woche später zu meiner Frau zurückkehren. Aber nach ein paar Tagen blieb mein Auto mitten in der Wildnis liegen. Ich ging zu Fuß weiter, auf der Suche nach einer Werkstatt, und landete hier. Dann fiel der Strom aus. Anfangs glaubte ich noch, meine Nachbarin würde mich abholen kommen. Ich habe sie angerufen, und sie hat es mir versprochen. Alles klar, hat sie gesagt, ich fahre heute Abend los und bin morgen da. Aber nach ein paar Tagen war sie immer noch nicht aufgetaucht. Mittlerweile waren die Telefonleitungen tot. Ich habe noch eine ganze Weile auf sie gewartet. Ich verstehe das nicht, sie war immer sehr verlässlich. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, einen Transporter zu stehlen, aber ich habe mich dumm angestellt, aus Unwissenheit. Außerdem war der Tank leer, irgendwer hatte das Benzin abgesaugt, und die Leute im Dorf bewachten ihre Spritvorräte mit Argusaugen. Es gab keinen Ausweg. Also bin ich hier eingezogen. Und eines Abends ist die Falle zugeschnappt. Die Dörfler brachten mir einen jungen Mann, einen Verletzten, der hohes Fieber hatte. Das warst du.
Matthias kniet immer noch vor der Plastikwanne, zwischen einem Kleiderhaufen und einem Eimer. Die Hosen, Hemden, Socken und Unterhosen auf der Leine über ihm ähneln säuberlich aufgehängten Lumpen.
Meine Frau wartet auf mich, erklärt er und hält mit den Händen im Wasser inne. Sie wartet darauf, dass ich sie besuche. Jeden Tag wartet sie darauf, dass ich sie besuche. Ich habe ihr ein Versprechen gegeben. Ich muss zurück in die Stadt. Zurück zu ihr. Ich kann nicht anders. Ich habe ihr ein Versprechen gegeben. Ich habe ihr versprochen, sie niemals im Stich zu lassen. Ich habe ihr versprochen, mit ihr zusammen zu sterben.
Matthias’ Stimme zittert. Er ist den Tränen nah.
Sieh mal, sagte er und zieht ein Foto aus der Hosentasche. Das ist sie.
Da ich nicht weiß, wie ich reagieren soll, greife ich zum Fernrohr und blicke hinaus auf die leblose Landschaft. Die Messlatte für den Schnee zeigt immer noch dasselbe an wie am Tag zuvor.