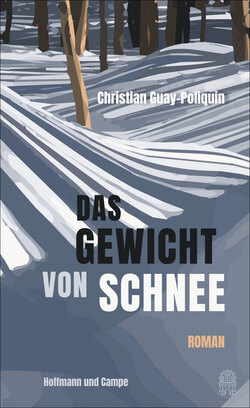Читать книгу Das Gewicht von Schnee - Christian Guay-Poliquin - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechsundfünfzig
ОглавлениеAm Abend frischt der Wind auf. Er rüttelt an der Veranda. Es schneit. Ich höre die Schneeflocken gegen die Fensterscheibe prallen wie von der Spiegelung getäuschte Vögel.
In der schwarzen Scheibe sehe ich mein Gesicht. Ein großer dunkler Fleck, eingesunkene Augen, fettiges Haar, struppiger Bart. Unter der Bettdecke das flache Relief meines mageren, nutzlosen Körpers.
Matthias sitzt im Schaukelstuhl. Er repariert den Lederriemen an einem seiner Schneeschuhe. Die Petroleumlampe flackert. Das Glas verrußt zunehmend. Der Docht müsste gekürzt werden, aber Matthias unternimmt nichts, er ist ganz in seine Arbeit versunken.
Wir sind fertig mit dem Essen. Das Geschirr ist gespült, der Boden gefegt, das Brennholz gestapelt. Der Raum ist sauber und aufgeräumt. Ich habe keine Ahnung, wie Matthias das macht. Die Stunden ziehen sich in die Länge, die Tage wiederholen sich, aber Matthias findet immer etwas, was er tun kann. Nie gönnt er sich eine Pause, außer, um zu lesen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ist er zugange, kocht, putzt. Er führt alle Arbeiten ruhig aus, ohne sich zu hetzen. Wie der fallende Schnee. Warum auch nicht. Man muss die Zeit ja irgendwie herumbringen. Draußen heult der Winter, der Stromausfall schickt uns weit in die Vergangenheit zurück, und die Untätigkeit ist unser größter Feind.
Auch wenn ich mit meinem Schicksal hadere, kann ich mich glücklich schätzen, hier gelandet zu sein. Ich werde vielleicht nie mehr laufen können, ich habe kein Interesse an Gesprächen, aber ich lebe noch. Fürs Erste jedenfalls.
Während Matthias den Riemen ausbessert, beobachtet er mich aus dem Augenwinkel.
Weißt du, im letzten Weltkrieg haben sich viele junge Männer dem Wehrdienst entzogen, sagt er. Einige haben schnell noch geheiratet, andere, wie mein Vater, haben sich im Wald versteckt. Das war keine leichte Entscheidung. Damals waren die Winter härter als heute. Rund um die Dörfer patrouillierten Kopfgeldjäger und hielten nach verräterischen Lebenszeichen Ausschau. Einem Schuss, einer Rauchsäule, einer frischen Spur im Schnee. Die Militärgerichte zahlten hohe Belohnungen für eine Denunziation oder für Hinweise zum Aufspüren und Ergreifen von Deserteuren. Dennoch halfen die meisten Dorfgemeinschaften ihnen heimlich. Die Leute brachten Lebensmittel zu einem vorab vereinbarten Versteck. Die Flüchtigen holten sie im Schutz der Dunkelheit dort ab und zogen sich sofort wieder in die Berge zurück. Der Überlebenskampf war hart. Auch im tiefsten Winter machten sie nur nach Einbruch der Dunkelheit Feuer, und in sternklaren Nächten war es zu gefährlich, die Glut vom Vorabend noch einmal anzufachen. In ihren Verstecken beschäftigten sich die jungen Männer, so gut es ging. Sie sahen zu, wie der Wald sich um sie schloss. Sie flickten ihre Kleidung, spielten Karten, schärften ihre Messer. Manchmal gab es Streit, zum Beispiel, wenn es darum ging, wer Wache halten musste. Sie beäugten sich misstrauisch, aber wussten, dass sie aufeinander angewiesen waren. Um zu überleben, mussten sie gemeinsam gegen Kälte, Hunger und Langeweile kämpfen. Ihnen wurde schnell klar, dass die wichtigste Aufgabe zweifellos das Erzählen von Geschichten war.
Draußen ist es windig. Die Böen zerren an Matthias’ Geschichte und lassen die Wände der Veranda knarren.
Kriegsdienstverweigerer oder Deserteur, das lief aufs Gleiche raus, fährt Matthias fort. Sie alle mussten den Winter in der Wildnis überstehen, ihre Kräfte schonen und auf den Frühling warten. Auf die Befreiung durch den Frühling. Mit jemandem wie dir, der hartnäckig schweigt, wäre das nicht gegangen. Wir beide wären entdeckt worden oder hätten uns gegenseitig zerfleischt. Um zu überleben, muss man miteinander reden.