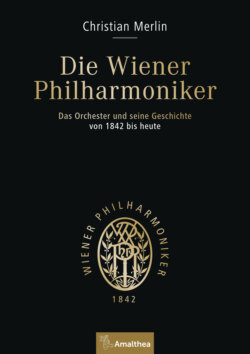Читать книгу Die Wiener Philharmoniker - Christian Merlin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеDie Wiener Philharmoniker üben eine Faszination aus, die weit über den Kreis von Musikliebhabern und -kennern hinausgeht. Das liegt nicht nur daran, dass die Übertragung ihres Neujahrskonzerts an jedem 1. Januar von über 50 Millionen Fernsehzuschauern in über 90 Ländern empfangen werden kann. Es liegt auch an den Mythen, die sich um diese Künstlergemeinschaft ranken, eine Gemeinschaft, die aufgrund ihrer ganz besonderen Regeln einem eigenen Mikrokosmos, ja fast einer Geheimgesellschaft gleicht.
Verhältnismäßig gibt es bis heute nicht viele Bücher über die Wiener Philharmoniker.1 Die meisten sind jahrzehntealt, nicht immer akribisch, und zeichnen sich durch ihre hagiografische Haltung und Bereitwilligkeit aus, die unangenehmen Themen zu verschweigen: Noch im Jahr 2006 beschreibt der einstige Konzertmeister Walter Barylli in seinen Erinnerungen das große Glück, sehr jung in das Orchester eintreten zu können, da 1938 einige Posten vakant geworden waren, ohne zu erwähnen, warum diese Stellen plötzlich zur Verfügung standen …2 Erst 1992 erschien das bisher umfangreichste Werk: die Demokratie der Könige von Clemens Hellsberg3, Primgeiger und damaliger Historischer Archivar der Philharmoniker, deren Vorstand er einige Jahre später werden sollte. Sein Werk basiert auf der systematischen Nutzung der Archivbestände mit dem Wissen eines Insiders. Hellsberg war außerdem der Erste, der sich der Aufgabe der Erinnerung stellte, der Erste, der den im Nationalsozialismus verfolgten Philharmonikern Gerechtigkeit widerfahren ließ.
Angesichts dieser Veröffentlichungen taucht unvermeidlich die Frage auf: Warum noch ein Werk, wenn das Wesentliche bekannt ist? Weil es noch eine Arbeit gibt, die bisher nicht geleistet wurde. Wie die meisten Werke über Orchester wurden auch fast alle Studien über die Wiener Philharmoniker aus demselben Blickwinkel geschrieben: Sie gehen von den Dirigenten aus, die das Orchester nacheinander geleitet haben, vom Repertoire und von der Institution als solcher. Nie von den Musikerinnen und Musikern.
Selbst die vorbildliche Geschichte der Pariser Société des concerts du conservatoire von Kern Holoman verbannt die Liste der Orchestermitglieder in den Anhang, ohne diesen auszuwerten. Aufgrund meiner Überzeugung, ein Orchester existiere nur durch seine Mitglieder, habe ich mein Buch Au cœur de l’orchestre geschrieben, das sich mit dem inneren Leben eines Orchesters befasst. Danach erschien es mir angebracht, diese Methode nicht mehr allgemein, sondern bei einer ganz besonderen Vereinigung anzuwenden. Ich habe also die Perspektive umgedreht und als Ausgangspunkt nicht die Geschichte der Wiener Philharmoniker als Kollektiv, sondern die Geschichte der Musikerinnen und Musiker gewählt. Diese Vorgangsweise wird durch den deutschen Namen des Orchesters unterstützt: Anders als im Französischen und Englischen (Orchestre Philharmonique de Vienne, Vienna Philharmonic Orchestra), spricht man nicht vom »Wiener Philharmonischen Orchester«, sondern von den »Wiener Philharmonikern«, eine Benennung, die sich eindeutig auf die individuellen Musiker bezieht und nicht auf ihre Struktur. Mein Vorhaben war auch gerechtfertigt, da sich die Gründung des Orchesters auf ein Vereinsmodell stützt, das auf Unabhängigkeit und Selbstverwaltung setzt, ein Modell, in dem die Mitglieder selbst ihren Dirigenten wählen und sich als Bewahrer einer bestimmten Tradition des Interpretationsstils sehen.
Historiker nennen »Prosopografie« die Biografie einer Gemeinschaft auf Basis der individuellen Biografien ihrer Mitglieder. In diesem Sinne habe ich zunächst eine Liste aller Mitglieder des Orchesters seit seiner Gründung 1842 erstellt und für jedes einzelne eine Datei angelegt: Seltsamerweise hatte sich in Österreich noch nie jemand diese Mühe gemacht. »Der muss verrückt sein«, hat ein Wiener Archivar gesagt, als er von dem Projekt hörte. Irgendwie hat er recht. Auf dieser Basis habe ich eine Genealogie der Wiener Philharmoniker erarbeitet, sowohl hinsichtlich der Familienbeziehungen als auch der aufeinanderfolgenden Besetzungen der einzelnen Pulte. Die Archivrecherchen nahmen vier Jahre in Anspruch, da sie sich auf wenige Wochen im Jahr beschränken mussten, befindet sich doch das Zentrum meiner beruflichen Tätigkeit in Paris. Es stellte sich schnell heraus, dass das Historische Archiv der Wiener Philharmoniker über keine Personalakten verfügt. So wird in den Registern und Mitgliederlisten nicht die Rangordnung innerhalb einer Instrumentengruppe, sondern nur das Instrument erwähnt: Man erfährt etwa nicht, wer die »Solobratsche«, die »zweite Klarinette« oder das »dritte Horn« ist, und es wird nicht zwischen Paukisten und Schlagwerkern unterschieden. Aus einem einfachen Grund: Im Verein der Wiener Philharmoniker herrscht Ranggleichheit unter den Vereinsmitgliedern. Dagegen gibt es im Wiener Staatsopernorchester sehr wohl eine Rangordnung der Posten. Denn die Wiener Philharmoniker und das Staatsopernorchester sind ein Personenverband, doch mit verschiedenen Statuten.
Das Staatsopernorchester besteht aus Angestellten des österreichischen Staates mit der Verpflichtung, am Abend im Orchestergraben der Staatsoper zu spielen. Parallel dazu sind diese Musiker Mitglieder eines privatrechtlichen Vereins unter dem Namen »Wiener Philharmoniker« und spielen Symphoniekonzerte: Als solche beziehen sie kein festes monatliches Gehalt, sondern teilen sich die Einnahmen. Um Philharmoniker zu werden, muss man zuerst Mitglied des Orchesters der Wiener Staatsoper sein: Nur das Opernorchester verfügt über Planstellen, schreibt sie aus und hält Probespiele ab. Hier, im Opernorchester, sind die Funktionen hierarchisch geordnet. Ich habe mich daher bemüht, Zugang zu Verträgen, Probespielprotokollen und Dienstbüchern zu bekommen, um zu erfahren, wer wer ist, und vor allem, wer auf wen gefolgt ist. Das wussten die Mitglieder manchmal selbst nicht!
Vor der Veröffentlichung meiner Forschungsergebnisse in Form eines Buches für ein breiteres Publikum habe ich sie als Habilitationsschrift an der Sorbonne eingereicht und im Dezember 2014 erfolgreich verteidigt. Das Ziel war, eine neue Methode auszuprobieren, mit der die Geschichte eines Orchesters vollständig zu erfassen ist, in der Hoffnung, dass diese Vorgehensweise von anderen Musikhistorikern weiterverfolgt und weiterentwickelt wird. Band II dieses Buchs besteht daher in einem Register, in dem alle Mitglieder des Orchesters seit der Gründung mit ihren wichtigsten persönlichen Daten aufgelistet sind.
Möglicherweise läuft man mit dieser Methode Gefahr, die Orchestergemeinschaft auf eine Kette von Individuen zu reduzieren und die kollektive Dimension zu vernachlässigen. Es ist ja kein Zufall, dass eines der häufigsten Synonyme für das Wort »Orchester« der »Klangkörper« ist. Nun ist aber dieser Klangkörper auch ein sozialer Körper, der nicht nur über eine komplexe Organisation und Hierarchie verfügt, sondern auch ein kollektives Gedächtnis, ja, eine kollektive Identität besitzt. Der Soziologe Maurice Halbwachs hat zwischen 1932 und 1944 an seinem Werk La Mémoire collective gearbeitet, das durch seine Deportation und seinen Tod in Buchenwald 1945 unvollendet blieb.4 Unter den von ihm untersuchten Beispielen für kollektive Gedächtnisse wendete er besondere Aufmerksamkeit den Orchestermusikern zu, in einem separaten, 1939 erschienenen Aufsatz5, der die permanente Interaktion zwischen dem individuellen und dem kollektiven Gedächtnis aufzeigt. Halbwachs konzentriert sich an erster Stelle auf den Unterschied zwischen dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft im Allgemeinen und dem spezifischer Gruppen, in diesem Falle am Beispiel der Musiker. Er verweist auf den Walkürenritt, um zu zeigen, dass Wagners Musik im sozialen Gedächtnis eng mit der Vereinnahmung durch das Hitler-Regime verbunden ist, während die Rezeption in der Expertengruppe der Musiker durchaus nicht auf die NS-Assoziation beschränkt ist. Anschließend reflektiert Halbwachs über die Natur des musikalischen Gedächtnisses: Bei Musikern stütze sich das Gedächtnis auf den Klang und nicht auf den Sinn, der sich im Theater über das Wort erschließt. Diese Behauptung bedarf allerdings einer Nuancierung bezüglich der Wiener Philharmoniker. Sie sind in erster Linie ein Opernorchester, dessen Musikerinnen und Musiker die Texte der Libretti auswendig können, sodass ihnen eine auf der Bühne gesungene Replik oft als Hinweis für ihren Einsatz dient.
Dieser Begriff des »Klanggedächtnisses«, der für ein Orchester mit so hohem Anspruch auf eine tradierte, besondere Tonqualität von entscheidender Bedeutung ist, wird einer meiner Leitfäden sein. Denn er ist untrennbar mit der Weitergabe von jahrhundertealten Traditionen über Generationen verbunden. Dies geschieht durch den direkten Kontakt von alten und jungen Musikern, aber auch durch Anmerkungen im Notenmaterial: Meistens spielen die Musiker aus Stimmen, die schon lange im Besitz des Orchesters sind und dementsprechend vollgeschrieben sind. So findet man in den Hornstimmen der Elektra noch die handschriftlichen Notizen von Musikern, die das Werk unter Richard Strauss gespielt haben.
Ebenso wichtig wie der Begriff des kollektiven Gedächtnisses, doch ideologisch heikler, ist der Begriff »kollektive Identität«. Ihre Bewahrung steht im Zentrum aller Bemühungen der Wiener Philharmoniker. 1947 schrieb Solooboist Alexander Wunderer: »Wir sind die Nachkommen derer, die von Beethoven künstlerisch erzogen wurden. Über dem Klang unseres Orchesters haben Brahms und Bruckner ihre Symphonien geschrieben.« Der Cellist Friedrich Dolezal meinte 1990, »der Grund für den einheitlichen wienerischen Stil der Streicher scheine wohl im Unbewussten zu liegen. Man spielt nicht wienerisch, man ist es.«
Die beiden Aussagen ergänzen sich, widersprechen einander aber auch: Der eine Musiker spricht von einem Erbe, ohne zu erklären, wie es sich überträgt (Durch Unterricht? Durch Nachahmung? Durch Vererbung?), der andere von einer Mentalität, die etwas mit dem Genius Loci zu tun hat. In keinem Fall darf man den Identitätsbegriff für bare Münze nehmen, sondern muss herausfinden, wie er sich zusammensetzt. Beide Musiker sprechen vom einzigartigen Charakter ihres Orchesters im Vergleich zu allen anderen: Die Wiener Philharmoniker leiten sich in direkter Linie von Beethoven, Brahms und Bruckner ab und berufen sich auf die lebendige Tradition einer unnachahmlichen Spielweise. Dieser Anspruch wird in Phasen der Bedrohung stärker betont. So werden Faktoren wie Globalisierung, Vereinheitlichung der Tonqualität, Internationalisierung des Repertoires und die zunehmende Qualität der konkurrierenden Orchester wiederholt als Gefahren empfunden.
Laut dem Soziologen Guy Michaud wird »die kollektive Identität von den Mitgliedern einer Gruppe subjektiv wahrgenommen. Sie entsteht durch das Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe und definiert sich vor allem durch ihre Opposition zu anderen und dadurch, dass sie sich von anderen unterscheidet.«6 Tatsächlich stehen die Philharmoniker in regelmäßigen Zeitabständen vor der Frage, ob sie ihren Spielstil ändern sollen, um sich der Zeit anzupassen, oder nicht. Sie berufen sich auf eine idealisierte Tradition, die sich jedoch ihrerseits im Lauf der Geschichte gewandelt hat, und haben in Wahrheit Angst, ihre Einzigartigkeit zu verlieren.
Im Lauf meiner Recherchen kam ich zu der Überzeugung, dass die Wiener Philharmoniker ursprünglich eine multikulturelle, multiethnische Vereinigung waren, der die Integration vieler Teilgruppen der Bevölkerung der Habsburgermonarchie unabhängig von deren kultureller Identität gelang. Erst später lief das Orchester Gefahr, die »Wiener Identität« sehr eng aufzufassen, was mitunter an Chauvinismus, Ausgrenzung und übersteigertes Selbstwertgefühl grenzte. In den letzten Jahren entwickelte es sich wieder verstärkt zu einer integrativen Gemeinschaft und knüpfte an den Geist der Gründungsjahre an.
Als roter Faden dieses Buches dient die Entwicklung des Personenstandes des Opernorchesters in quantitativer wie personeller Hinsicht. Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen ist eine regelmäßige Zunahme der Mitgliederzahl zu beobachten, mit einigen auffälligen Schlüsselphasen: 1869, 1922 und 1964. In diesen Jahren vergrößert sich das Orchester jeweils um circa 20 neue Stellen. Zu anderen Zeiten sind aufgrund massiver Abgänge Vakanzen auszufüllen. Das war nach dem Ersten Weltkrieg der Fall und vor allem nach dem »Anschluss« 1938, als es durch die nationalsozialistischen Säuberungen zu Vakanzen kam, die es sonst nie gegeben hätte. Manchmal, zum Beispiel unter der Direktion von Gustav Mahler in den 1900er Jahren oder unter Clemens Krauss zu Beginn der 1930er Jahre, wurden Schlüsselpositionen neu besetzt, um, wie es hieß, die Spielqualität zu verbessern. Denn immer wieder stellte sich im Lauf der Geschichte des Orchesters mehr oder weniger diplomatisch die Frage, wie sich die Traditions- und Senioritätspflege mit den steigenden spieltechnischen Erwartungen vereinen lässt, die an ein herausragendes Orchester gestellt werden.
Die großen Impulse für die Entwicklung der Wiener Philharmoniker gingen, besonders was die Anzahl der Musiker anging, von der Oper aus, deren Spielbetrieb vom Orchester getragen wird: Daher ist der Eindruck nicht falsch, hier eher die Geschichte des Orchesters der Wiener Oper zu lesen als die der Wiener Philharmoniker. Das Schicksal der Philharmoniker ist untrennbar mit dem der Oper verbunden: Je mehr das Orchester in der Oper eingesetzt wird, desto spürbarer wird der Personalbedarf, besonders wenn die Anzahl der Konzerte zur gleichen Zeit steigt. Zudem wird es bei jeder Vergrößerung des Opernorchesters für die Philharmoniker schwieriger, Neuankömmlinge in ihre Reihen aufzunehmen: Da ihre Organisation auf der Teilung der Einnahmen unter den Vereinsmitgliedern beruht, verringert sich der pro Kopf ausgeschüttete Betrag, je größer das Orchester wird … Die Philharmoniker sind zwar eine demokratische, aber keine philanthropische Gesellschaft.
Die Geschichte der Stellenbesetzungen ist zugleich Spiegelbild der allgemeinen Geschichte. Besonders während der österreich-ungarischen Monarchie stellt sich die Frage nach der Wiener Identität, einer übernationalen und multikulturellen komplexen Konstruktion. Ich habe versucht, alles über die Herkunft jedes Musikers in Erfahrung zu bringen, um herauszufinden, ob man bei der Stellenvergabe regionalen Präferenzen folgte. Gerade für die Zeit der Monarchie war dies eine schwierige Aufgabe. Erstens, weil vor dem Erwachen der Nationalitäten am Ende des 19. Jahrhunderts die Tatsache, ob ein Musiker aus Böhmen, Mähren oder Ungarn kam, nicht entscheidend war und das Völkermosaik der Habsburgermonarchie relativ unübersichtlich ist. Zweitens, weil nicht immer genügend zuverlässige Kriterien zur Verfügung standen. Der Familienname ist nicht immer ein Beweis für die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe: Viele seit Generationen eingebürgerte Wiener tragen einen tschechischen Namen, ebenso wie zahlreiche Moldauer oder Galizier ihre Namen eingedeutscht haben. Auch der Geburtsort ist nicht entscheidend: In Böhmen geboren zu sein, hieß noch lange nicht, dass man Tscheche oder Deutsch-Böhme war. Von den 736 Musikern, deren Geburtsort bekannt ist, sind 365, die Hälfte, in Wien geboren. Was also ist unter der viel beschworenen Wiener Identität zu verstehen? Vielleicht das, was Étienne Balibar eine »fiktive Ethnizität«7 nennt und Hartmut Esser »fiktive Abstammungsgemeinschaften«.
Die historischen Ereignisse treten mit dem Ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Kaiserreiches, mit dem Austrofaschismus, vor allem mit dem »Anschluss« und während des Nationalsozialismus in den Vordergrund. Gerade die Konsequenzen des Jahres 1938 sind für das Orchester einschneidend, sowohl in menschlicher als auch in kultureller Hinsicht. Mit neuer Schärfe wurde die Frage aufgeworfen, welche Stellung die österreichischen Musiker Deutschland, dem »verfreundeten Nachbarn«, gegenüber einnehmen sollten.
Ich war gerade in Wien, als es im Dezember 2012 zu einer Polemik um Medienaussagen des grünen Abgeordneten Harald Walser kam. Der Vorwurf, die Philharmoniker hätten ihre NS-Vergangenheit verschleiert, war zum Teil zutreffend, zum Teil ungerecht. Zutreffend insofern, als Österreich im Allgemeinen viel milder als Deutschland mit der Vergangenheitsbewältigung umgegangen war und es vorgezogen hatte, heikle Fragen beiseitezuschieben und sich mehr als Opfer denn als Mittäter darzustellen. Ungerecht insofern, als man sich bei dem Angriff auf Clemens Hellsberg ein falsches Ziel gewählt hatte, denn dieser hatte 1992 als Erster den Opfern des Holocaust ein Kapitel seines Werkes über die Philharmoniker gewidmet. Die Polemik hatte zwei positive Folgen: die Entdeckung von bislang unbekannten Dokumenten über die Orchestergeschichte während des Zweiten Weltkrieges in einem Depotraum der Wiener Philharmoniker im Keller der Staatsoper sowie die Bestellung einer Historikerkommission unter Oliver Rathkolb, der als anerkannter Spezialist für die NS-Zeit damit beauftragt wurde, die Rolle des Orchesters während des Nationalsozialismus unter die Lupe zu nehmen.
Die Zusammensetzung des Orchesters wird noch komplexer, wenn man den Anteil der jüdischen Mitglieder in Betracht zieht. Denn die jüdische Bevölkerungsgruppe wurde weder als eigene Nation noch als Tschechen, Ungarn oder Bukowiner angesehen: Man denke an Kafka, der sich überall fremd fühlte, ein Deutscher in den Augen der Tschechen, ein Jude in den Augen der Deutschen. Meinem eigenen Großvater erging es nicht anders: Er wurde 1903 in Bukarest von jüdischen Eltern geboren, die aus Czernowitz stammten, und fragte sich sein ganzes Leben lang, ob er vorrangig Jude, Rumäne oder Österreicher sei; er sprach besser Deutsch als Rumänisch. Die 1932 erhaltene französische Staatsbürgerschaft wurde ihm im Zweiten Weltkrieg vom Vichy-Regime entzogen, was ihn mit Ehefrau und kleiner Tochter in den Untergrund zwang, um dem Holocaust zu entkommen.
Ich bin mir somit wie kaum ein anderer bewusst, dass es im Grunde indiskutabel ist, Individuen nach ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit einzuordnen. Aber es schien mir wichtig, zumindest bis 1945 den Anteil der jüdischen Musiker bei den Wiener Philharmonikern festzustellen: nicht um einen genetisch bedingten Spielstil hervorzuheben, sondern um den Stellenwert der jüdischen Bevölkerung innerhalb des Wiener Kulturlebens bis zu ihrem gewaltsamen Ausschluss 1938 zu untersuchen und herauszufinden, inwieweit die Orchesterbesetzung Wiener Kultur und Mentaliäten reflektierte … Trotz lückenhafter Quellen bemühte ich mich, den Anteil von Juden, Böhmen, Ungarn und anderen Bevölkerungsgruppen Trans- und Cisleithaniens statistisch festzuhalten. Meine Aufstellungen sind zwar noch unvollständig, können aber als Grundlage für künftige Forschungen dienen.
Diese Recherchen erschließen darüber hinaus die Möglichkeit, den Begriff des »Wiener Stils« näher zu untersuchen. Mittels genealogischer Annäherung kann man sich mit der Bedeutung von Tradition, Erbe und Weitergabe auseinandersetzen: durch die Nachbesetzung der Stellen, die oft familiär bestimmt war, aber auch durch den Instrumentalunterricht. Auch über die Auswertung der Protokolle der philharmonischen Versammlungen und Komiteesitzungen und die manchmal mehr als turbulenten Beziehungen des Orchesters zu seinen Dirigenten lässt sich dem Mythos und der Realität des labilen Begriffs »Wiener Stil« auf die Spur kommen. Denn was sich viele als angeborene Eigenschaft vorstellen, kam mir im Lauf meiner Forschungen immer mehr wie eine pure Konstruktion vor.
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass mein Werk keinen Anspruch auf absolute Objektivität erheben kann. Die Deutungen, die in beiden Bänden zum Ausdruck gebracht werden, spiegeln letzten Endes meinen Standpunkt wider und beruhen neben klaren Fakten auf kritischem Urteil und persönlicher Stellungnahme.
Ich möchte von ganzem Herzen jenen Personen danken, die mir bei meiner Arbeit geholfen haben. An erster Stelle Clemens Hellsberg, dem langjährigen Vorstand der Wiener Philharmoniker, der meinem Projekt seine Aufmerksamkeit schenkte und mir seine Freundschaft. Ebenso seinem Nachfolger Andreas Großbauer, dessen uneingeschränkte Unterstützung die deutschsprachige Ausgabe dieses Buches möglich machte, und Wolfgang Plank als immer hilfsbereitem und warmherzigem Leiter des Historischen Archivs der Wiener Philharmoniker. Staatsoperndirektor Dominique Meyer, einem großen Verehrer »seines« Orchesters, der mich in jenen Depotraum im zweiten Untergeschoß der Staatsoper begleitete, ohne sich vor dem Staub zu fürchten. Karl Tautscher, Orchesterinspektor der Staatsoper, der mir die Schränke seines Büros öffnete, mir einen Tisch und einen Sessel hinstellte, damit ich die bis ins Jahr 1948 zurückreichenden Dienstverzeichnisse des Orchesters studieren konnte. Dem Notenarchivar der Philharmoniker, Andreas Lindner, der mir großzügigerweise Einblick in die von ihm ausgearbeiteten Musikerlisten gewährte, sodass ich nicht bei null beginnen musste. Hana Keller und ihrem Mitarbeiter Thomas Helesic im Österreichischen Staatsarchiv, die mir durch ihre Vorbereitungen die Arbeit unglaublich erleichtert haben. Lynne Heller und ihrem Mitarbeiter Erwin Strouhal, die für mich alle von späteren Philharmonikern besuchten Klassen an der Akademie für Musik und darstellende Kunst zwischen 1909 und 1940 durchgesehen haben. Ich danke auch Otto Biba für den freundlichen Empfang im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Ebenso wie Ingeborg Birkin, die immer bereit war, die Ergebnisse ihrer Forschungen zur Verfügung zu stellen. Und dem Musikkritiker Walter Dobner, der mir Zutritt zum nicht öffentlich zugänglichen Archiv von Willi Boskovsky verschafft hat, dessen Nachlassverwalter er ist.
Ganz speziell danke ich auch den ehemaligen Musikern des Orchesters, die mit mir ihre Erinnerungen geteilt haben: Franz Bartolomey, Wolfram Görner, Werner Hink, Roland Horvath, Günter Lorenz, Reinhard Öhlberger (der sich auch als aufmerksamer Lektor entpuppte), Peter Schmidl sowie den aktiven Musikern, die mir geduldig alle meine lästigen Fragen beantwortet haben: Gotthard Eder, Dieter Flury, Josef Hell, Martin Kubik, Raimund Lissy, Herbert Mayr, Wolf-Dieter Rath, Lars Michael Stransky, Christoph Wimmer. Viktor Velek, der alles über in Wien tätige tschechische Musiker weiß. Friedemann Pestel, der die deutsche Übersetzung mit kaum zu überbietender Akribie und Gründlichkeit inhaltlich geprüft hat, und last, but not least Silvia Kargl, Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Historischen Archivs der Wiener Philharmoniker, die sich – unsere geografische Entfernung überbrückend – als eine unerschöpfliche Quelle von Auskünften, eine immer hilfsbereite Unterstützerin, eine geistreiche Gesprächspartnerin und vor allem eine gute und treue Freundin erwies.