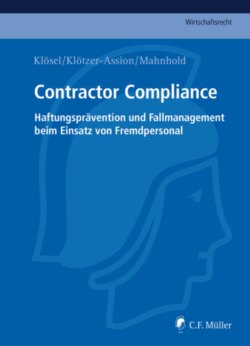Читать книгу Contractor Compliance - Christoph LL.M. Frieling - Страница 66
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung › 2. Kapitel Definition des sozialversicherungsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs › II. Abgrenzungskriterien: Parallelität und Unterschiede zum Arbeitsrecht
II. Abgrenzungskriterien: Parallelität und Unterschiede zum Arbeitsrecht
2
Ebenfalls parallel zum Arbeitsrecht bilden die im Rahmen einer sozialversicherungsrechtlichen Statusbewertung relevanten Grundsätze einen unveränderten Gegenstand langjähriger Rechtsprechung. Das BSG geht bei der Abgrenzung in ständiger Rechtsprechung von folgenden Grundsätzen aus:
„Beurteilungsmaßstab für das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung ist (…) § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV. Danach ist Beschäftigung die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV sind Anhaltspunkte für eine Beschäftigung eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) setzt eine Beschäftigung voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Bei einer Beschäftigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und er dabei einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Demgegenüber ist eine selbstständige Tätigkeit vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist, hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen. Maßgebend ist stets das Gesamtbild der Arbeitsleistung. Dieses bestimmt sich nach den tatsächlichen Verhältnissen, zu denen die rechtlich relevanten Umstände gehören, die im Einzelfall eine wertende Zuordnung zum Typus der abhängigen Beschäftigung erlauben.“[1]
3
Wie schon von der arbeitsrechtlichen Statusabgrenzung bekannt, ist auch hier eine Gesamtabwägung vorzunehmen, die sich an den tatsächlichen Verhältnissen orientiert. Auf dieser Basis hat die sozialgerichtliche Rechtsprechung zur Konkretisierung dieser Grundsätze ebenfalls mit Blick auf eine unüberschaubare Anzahl von Einzelfällen eine ganze Reihe von Abgrenzungskriterien entwickelt, die im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen sind. Sowohl die genannten Grundsätze als auch die im Einzelfall entwickelten Kriterien unterscheiden sich im Grundsatz nicht zu denen bei der arbeitsrechtlichen Statusbewertung, zum Teil greift das BSG zur Konkretisierung einzelner Kriterien sogar ausdrücklich auf die Rechtsprechung des BAG zurück:
4
„Soweit sich das LSG für seine Auffassung auf die Rechtsprechung des BAG stützt, kann dieser eine so weitreichende Bedeutung der Delegationsmöglichkeit zur Konkretisierung des Begriffs des Arbeitsverhältnisses nicht entnommen werden. Auch das BAG sieht eine solche Möglichkeit lediglich als ein nicht von vornherein ein Arbeitsverhältnis auszuschließendes Indiz an, insbesondere wenn die persönliche Leistungserbringung die Regel und die Leistungserbringung durch einen Dritten eine das Gesamtbild der Tätigkeit nicht wesentlich verändernde seltene Ausnahme darstellt. Die Möglichkeit, Dritte zur Leistungserbringung einsetzen zu dürfen, stellt dann lediglich ein Kriterium dar, dass im Rahmen einer Gesamtwürdigung mit zu berücksichtigen ist (BAG, Urteile vom 19.11.1997, 5 AZR 653/96, BAGE 87, 129, und vom 27.6.2001, 5 AZR 561/99, BAGE 98, 146).“[2]
5
Deshalb ist mit Blick auf den sozialversicherungsrechtlichen Status im Grundsatz auf die Ausführungen zum arbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriff sowie die konkreten Abgrenzungskriterien und deren Inhalt zu verweisen (vgl. 2. Teil 1. Kap. Rn. 13, 16 ff.).[3]
6
Im Zusammenhang mit der Statusfrage bei Fremdpersonaleinsätzen bestehen Unterschiede allenfalls im Detail.[4] In beiden Fällen ist das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit entscheidend, die sowohl im Arbeitsrecht als auch dem Sozialversicherungsrecht zunächst einmal tätigkeitsbezogen zu verstehen ist und zu den maßgeblichen Abgrenzungskriterien tätigkeitsbezogener Weisungen nach Inhalt, Ort und Zeit sowie einer betrieblichen Eingliederung führt; auch im Rahmen der oben zitierten Grundsätze des BSG werden diese Kriterien prominent erwähnt (vgl. 2. Teil 1. Kap. Rn. 77–81 und 86). Gerade im Bereich des Sozialversicherungsrechts wird allerdings vereinzelt eingefordert, dass die persönliche Abhängigkeit nicht zu allererst tätigkeitsbezogen verstanden werden sollte, sondern insbesondere wirtschaftlichen Parametern wie etwa einem unternehmerischen Risiko bei gleichzeitig erhöhten Verdienstchancen etc. mehr Gewicht zukommen müsse; begründet wird dies vor allem mit der generellen Schutzfunktion des Sozialversicherungsrechts, das gem. § 1 SGB I dem Schutz der wirtschaftlich und sozial schwächeren Bevölkerungsteile dienen solle.[5]
7
Die Sozialgerichte haben die Einbeziehung jedenfalls des Kriteriums einer wirtschaftlichen Abhängigkeit vordergründig zwar stets abgelehnt.[6] Ein genauerer Blick auf die sozialgerichtliche Rechtsprechung zeigt indes, dass weniger tätigkeitsbezogene und im Kern wirtschaftliche Abgrenzungskriterien wie das Tragen eines unternehmerischen Risikos, die Nutzung eigener Betriebsmittel oder sonstiger Modalitäten wie vereinbarten Vertragsstrafen mehr Raum im Rahmen der Abwägungsentscheidungen einnehmen als dies in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung der Fall ist.[7] Diese Kriterien sind zwar auch im Rahmen der arbeitsrechtlichen Statusabgrenzung von Bedeutung, allerdings nehmen sie hier im Rahmen der Gesamtabwägung zumeist nur eine untergeordnete Rolle ein (vgl. 2. Teil 1. Kap. Rn. 66 ff.).
8
Ein gutes Beispiel für einen derart verstärkten Fokus auf wirtschaftliche Parameter findet ich in der neueren Rechtsprechung des LSG Bayern zur sozialversicherungsrechtlichen Statusabgrenzung:
9
„In Würdigung der dokumentierten Tätigkeit des Beigeladenen zu 1) eine abhängige Beschäftigung sprechen folgende gewichtige Tatsachen: (i) Der Kläger hat dem Beigeladenen zu 1) für die insgesamt vier durchgeführten Fahrten das wesentliche Arbeitsmittel gestellt, nämlich den auf das Unternehmen des Klägers zugelassenen und für dieses versicherten Lkw, (ii) Der Kläger hat die für den Betrieb dieses wesentlichen Arbeitsmittels notwendigen Betriebsstoffe wie Kraftstoff, Schmiermittel allein getragen, (iii) der Kläger hat die Kosten von Unterhalt und Wartung des Lkw allein übernommen, (iv) der Beigeladene zu 1) ist in allen vier Fällen Routen gefahren, die der Kläger ihm nach Kundenaufträge des Klägers vorgegeben hatte, (v) die Tätigkeit des Beigeladenen zu 1), also die Ausführung der Fahrten, hat sich von der Tätigkeit der angestellten Fahrer des Klägers nicht wesentlich unterschieden und (vi) der Beigeladene zu 1) ist nach Außen ebenso wenig als Selbstständiger aufgetreten, wie die Fahrer des Klägers.
Zwar hat der Kläger ursprünglich geltend gemacht, dass die Lkw-Nutzungskosten in die Vergütung für die Fahrten mit einkalkuliert gewesen sei. Hierfür lassen sich jedoch keinerlei Anhaltspunkte finden, es ist nicht nachvollziehbar, ob oder in welchem Umfange Anschaffungs- und Betriebsausgaben des Klägers auf den Beigeladenen zu 1) im Verhältnis zu den ihm zuzuschreibenden Laufleistungen in irgendeiner rechnerischen Form einbezogen worden wären. Darüber hinaus hat der Beigeladene zu 1) im Ermittlungsverfahren glaubhaft angegeben, dass sich seine Vergütung an dem Lohn orientiert hatte, die die angestellten Fahrer des Klägers für entsprechende Fernfahrten erhalten hätten.
Demgegenüber sind im Falle der Tätigkeit des Beigeladenen zu 1) zwar auch Elemente zu erkennen, die für eine Selbstständigkeit der Fahrertätigkeit sprechen, wie der Kläger in der Berufung zu Recht geltend macht. Dies sind – das nicht vollständige in Anspruchnehmen der Arbeitskraft des Klägers, – das nur fallweise Tätigwerden, – die – wenn auch in geringem Maße – andere Vergütung als die der angestellten Fahrer, – die Haftung für unrechtmäßiges Verhalten sowie – das Fehlen der Entgeltfortzahlung im Urlaubs- und im Krankheitsfalle und – die Anmeldung eines eigenen Transportgewerbe angemeldet und die Zulassung als Transportunternehmer.“[8]
10
Dieses Beispiel zeigt, dass die im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Statusabgrenzung entscheidenden Kriterien vorliegender Weisungen nach Inhalt, Zeit und Ort sowie einer betrieblichen Eingliederung jedenfalls in dem hier geschilderten Fall – wenn überhaupt – nur eine unwesentliche Rolle für die Begründung des sozialrechtlichen Beschäftigtenstatus gespielt haben; entscheidende Bedeutung kam dagegen wirtschaftlichen Parametern zu, wie etwa der Stellung der wesentlichen Arbeitsmittel, den Kosten für die Instandhaltung sowie Nutzung dieser Arbeitsmittel, Haftungsfragen etc.
11
Dennoch können diese Unterschiede nicht überbewertet werden. Im Ergebnis kommt es auch im Sozialversicherungsrecht auf eine Gesamtabwägung der bekannten Abgrenzungskriterien an. Um bei dem Bespiel der Betriebsmittel zu bleiben: Zwar geht die Rechtsprechung des BSG davon aus, dass die Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs und die damit einhergehende Lastentragung für eine selbstständige Tätigkeit sprechen kann; unterliegt die Ausübung der Tätigkeit dennoch der Kontrolle des Auftraggebers, dessen Fahrdienstleiter das Fahrzeug gelegentlich begleiten und ist der Dienstverpflichtete gehalten, während der Tätigkeit für den Auftraggeber dessen Firmenschild anzubringen und macht der Auftraggeber zudem noch Vorschriften über die Beladung, tritt demgegenüber das Eigentum an Betriebsmitteln regelmäßig zurück.[9] Dagegen können selbst Piloten, die selbstredend in aller Regel nicht Eigentümer des wesentlichen Arbeitsmittels Flugzeug sind, selbstständig tätig sein, wenn diese Tätigkeit ohne die Aufnahme in fremdbestimmte Dienstpläne etc. im Wesentlichen weisungsfrei und ohne eine betriebliche Eingliederung erfolgt.[10]