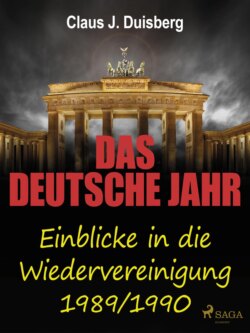Читать книгу Das deutsche Jahr - Einblicke in die Wiedervereinigung 1989/1990 - Claus J. Duisberg - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Besetzung der Ständigen Vertretung
ОглавлениеNicht immer freilich ließen sich die Zufluchtsfälle schnell und ohne Aufsehen regeln. Manchmal dauerte es Tage oder sogar Wochen, bis Vogel Zusagen machen konnte, die ungebetene Gäste zum Verlassen der Vertretung bewegten. Die Gründe konnten in der besonderen Natur des Falles liegen – einmal war es beispielsweise ein Deserteur der Nationalen Volksarmee –, aber auch darin, daß die DDR immer wieder versuchte, die Bremse zu ziehen. So mußte die Ständige Vertretung 1983 für einige Wochen geschlossen werden, nachdem sich dort mehr als fünfzig Zufluchtsuchende festgesetzt hatten.
Im Januar 1989 kamen wir fast wieder an diesen Punkt. Besucher, die eine Ausreisegenehmigung erzwingen wollten, weigerten sich, die Ständige Vertretung zu verlassen. Trotz aller Diskretion verbreitete sich die Nachricht, und andere drängten hinein, um sich der Gruppe anzuschließen. Vogel teilte mit, daß er kein Mandat habe, die Angelegenheit zu behandeln. Vorausgegangen war eine außerordentliche Zunahme der Zahl der Besucher unserer Ständigen Vertretung mit Ausreiseanliegen: 1988 waren insgesamt 6608 Personen aus diesem Grund in die Vertretung gekommen, von denen 379 erst nach Zusage von Vogel das Gebäude wieder verließen; 1987 waren es demgegenüber nur 825 Besucher mit 68 und 1986 nicht mehr als 312 mit 25 Zufluchtsfällen gewesen. In diesen Zahlen spiegelte sich der dramatisch wachsende Ausreisedruck, dessen die DDR verzweifelt, aber vergeblich Herr zu werden versuchte.
Vor diesem Hintergrund plädierte ich im Januar 1989 dafür, die Ständige Vertretung für das Publikum zu schließen, einmal um das aktuelle Problem zu begrenzen, zum anderen um die DDR, der ein solcher Schritt wegen des damit verbundenen auch internationalen Aufsehens – die Wiener KSZE-Folgekonferenz befand sich in ihrer Schlußphase – äußerst unangenehm sein mußte, zum Handeln zu bewegen. Die Minister Schäuble und Frau Wilms scheuten aber vor einer derart spektakulären Maßnahme zurück. Die DDR lenkte dann auch ohnedies ein; und in der Folgezeit gelang es in Gesprächen zwischen Walter Priesnitz, dem Staatssekretär im Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen, und Rechtsanwalt Vogel sogar, die Tarife im Rahmen der besonderen Bemühungen beträchtlich zu reduzieren.
Die wirkliche Krise kam dann aber im August 1989. Ich war am Montag, dem 7. August, nach einem Urlaub zum ersten Mal wieder im Büro und hoffte auf noch einige beschauliche Tage, weil der Bundeskanzler wie üblich zum Urlaub am Wolfgangsee war, der Chef des Bundeskanzleramts – seit April 1989 Bundesminister Rudolf Seiters – ebenfalls in Österreich Ferien machte und das Bundeskanzleramt wie jedes Jahr um diese Zeit in sommerlicher Ruhe vor sich hin dämmerte. Kurz nach Dienstbeginn aber rief mich der stellvertretende Leiter der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin, Jürgen Staab, an und unterrichtete mich, daß sich seit dem Ende der vorangegangenen Woche eine wachsende Zahl Ausreisewilliger in der Vertretung aufhielten, die ohne positive Entscheidung über ihre Ausreiseanträge das Gebäude nicht wieder verlassen wollten; inzwischen seien es bereits über 80 Personen, darunter Familien mit Kindern, und stündlich kämen weitere hinzu.
Ich bat Staab, bei der bisherigen Linie zu bleiben und allen eindrücklich vorzustellen, daß die Entscheidung über die Ausreise allein bei der DDR liege und die Bundesregierung darauf keinen Einfluß habe; andererseits dürfe aber niemand am Zugang gehindert oder gar gewaltsam wieder hinausgewiesen werden. Allerdings solle das Haus wie jeden Tag nach Ende der Besuchszeit für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Ich erfuhr dann, daß sich auch in unseren Botschaften in Budapest und Prag Gruppen von Ausreisewilligen festgesetzt hatten. Priesnitz hatte sich bereits um Kontakte mit Vogel bemüht, aber noch keine Reaktion erhalten. Im Laufe des Tages teilte Vogel mit, er habe nur ein eingeschränktes Mandat, das heißt, er könne den Leuten beim Verlassen der Vertretungen nur Straffreiheit zusichern, nicht dagegen auch eine wohlwollende Prüfung ihrer Ausreiseanträge.
Ich versuchte, Minister Seiters an seinem Ferienort zu erreichen, was erst nach einiger Zeit gelang, und schlug ihm vor, die Ständige Vertretung zu schließen, weil der Zustrom eher wachsen als abnehmen werde und wir bereits jetzt größere Probleme mit der Unterbringung und Versorgung der Menschen hätten. Nach weiteren Telefonaten zwischen Bonn, Berlin und Österreich konnte ich schließlich am Abend Staab die Weisung geben, die Ständige Vertretung am nächsten Tag für den Publikumsverkehr nicht zu öffnen und bis auf weiteres geschlossen zu halten. Die Zahl unserer Gäste hatte sich inzwischen auf 130 erhöht; einer kletterte später noch über die Mauer, so daß es 131 wurden.
Am 8. August erläuterten Priesnitz und ich die Entscheidung vor der Bundespressekonferenz. Unsere Linie war, die Angelegenheit nicht zu dramatisieren, um der DDR ein eventuelles Einlenken nicht zu erschweren und die Fortsetzung der bisherigen, auf praktische Zusammenarbeit gerichteten Politik nicht in Frage zu stellen. Die Information über die Situation in der Vertretung wurde auf die notwendigen Fakten beschränkt; eine Sensationsberichterstattung sollte möglichst vermieden werden. Ich wies deshalb auch die Mitarbeiter der Ständigen Vertretung zu strikter Enthaltsamkeit gegenüber der Presse an; und in der Folge legten wir unter Einbeziehung der Zufluchtsuchenden noch Regeln fest, nach denen ihr Kontakt mit der Außenwelt auf die sachlich erforderliche Kommunikation mit Angehörigen beschränkt wurde. Für Minister Seiters bereitete ich eine am 9. August veröffentlichte Erklärung vor, in der er an die Ausreisewilligen der DDR appellierte, nicht den Weg über die Vertretungen der Bundesrepublik zu gehen, weil dadurch »mehr Probleme geschaffen als gelöst« würden; dabei konnte auch darauf hingewiesen werden, daß 1989 bis Ende Juli bereits 4643 Bürger der DDR legal in die Bundesrepublik übersiedeln durften.
Selbst wollte ich so bald wie möglich nach Berlin fahren, zumal der neue Leiter der Ständigen Vertretung, Staatssekretär Franz Bertele, ebenfalls gerade auf Urlaub war, incommunicado in Norwegen. Außerdem erschien es mir dringlich, daß ein Vertreter der Bundesregierung auf politischer Ebene mit der DDR, dann aber vor allem auch mit den Menschen in der Ständigen Vertretung sprach. In der DDR war ebenfalls Urlaubszeit, so daß ich erst am 11. August einen Termin bei dem stellvertretenden Außenminister Kurt Nier erhielt; der zuständige Abteilungsleiter beim Zentralkomitee der SED, Gunter Rettner, ließ sich verleugnen. Ich hielt es für richtig, mit einer persönlichen Botschaft des Bundeskanzlers für Honecker nach Berlin zu reisen, in der einerseits unsere Bereitschaft zur Fortsetzung der bisherigen Politik betont, andererseits aber die dringliche Aufforderung an die DDR gerichtet wurde, auf politischer Ebene zu einer Lösung des Problems beizutragen. Der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers, Ministerialdirektor Horst Teltschik, der vertretungsweise das Bundeskanzleramt leitete und in ständigem Kontakt mit dem Kanzler stand, übermittelte ihm meinen Vorschlag. Der Kanzler war einverstanden, legte aber aufgrund von Erfahrungen in anderen Fällen Wert darauf, die DDR zugleich zu warnen, Lösungen nicht auf parteipolitischen Wegen, das heißt über die SPD, ins Auge zu fassen.
Nier war im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR für Westeuropa zuständig, ein trockener, hölzerner Mann, nicht unfreundlich, aber wenig beweglich. Das Gespräch mit ihm verlief im Ton verbindlich, in der Sache hart. Im Auftrag des Bundeskanzlers erklärte ich, daß die Menschen rechtmäßig in unsere Vertretungen gekommen seien und wir sie auf keinen Fall gewaltsam daraus vertreiben würden. Wir wollten zwar wie bisher auf sie einzuwirken suchen, die Vertretungen freiwillig zu verlassen; nach Lage der Dinge bestünde jedoch keine Aussicht, daß sie das aufgrund einer Zusage lediglich von Straffreiheit tun würden. Eine Lösung werde deshalb nicht möglich sein, ohne daß die DDR dazu einen Beitrag leiste. Ich betonte, daß wir unverändert zu einer vernünftigen Weiterentwicklung der Beziehungen bereit seien und in keiner Weise Druck auf die DDR ausüben wollten; der Chef des Bundeskanzleramts könne die notwendigen Gespräche unter Wahrung voller Diskretion mit einem dafür von der DDR-Regierung Beauftragten führen.
Nier hielt dagegen, es sei allein Sache der Bundesregierung, die Menschen, die sich widerrechtlich in unseren Vertretungen aufhielten, wieder loszuwerden. Unsere Vertretungen seien nicht befugt, für DDR-Bürger tätig zu werden. Die DDR erwarte, daß ihre Souveränität respektiert werde und die Bundesregierung das Nötige tue, damit die DDR-Bürger unsere Vertretungen verließen. Die DDR könne es nicht hinnehmen, daß durch Aufnahme in unsere Vertretungen die Hoffnung erweckt würde, eine Sonderregelung für die Ausreise zu erreichen 13 . Dies war der entscheidende Satz: Die DDR wollte offensichtlich versuchen, den Sonderweg endgültig zu schließen.
Im Anschluß an das Gespräch ging ich mit Bertele, der im Radio von den Ereignissen gehört und seinen Urlaub sofort abgebrochen hatte, in die Ständige Vertretung zu den dort Wartenden. Sie kampierten seit nun fast einer Woche im euphemistisch so genannten »Gartenhaus«, einem hinter das Hauptgebäude in den Hof gesetzten Zweckbau für Vorträge und gesellschaftliche Veranstaltungen. Über hundert Gesichter waren auf mich gerichtet, und die Luft war dicht mit ihren Erwartungen. Ich hatte nichts zu geben, mußte im Gegenteil auf Ernüchterung hinwirken, weil niemand wissen konnte, ob und wann sich die DDR zu einer Lösung bereit finden würde. Ich sagte daher, daß die Bundesregierung alles in ihren Kräften Stehende für die Zufluchtsuchenden tun würde, daß dies aber nicht viel sei, weil die Entscheidung über die Ausreise letztlich bei der DDR liege und diese sich sehr hart stelle. Daher sollten sich alle überlegen, ob sie nicht doch die Vertretung wieder verlassen wollten. Sie könnten sicher sein, daß wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter um sie kümmern würden.
Die Stimmung wurde gedämpfter, es kam zu Fragen; manche erzählten über ihr persönliches Schicksal. Es waren Menschen ganz verschiedener Herkunft, Bildung und sozialer Stellung. Was hatte sie bewogen, sich von ihrem bisherigen Leben loszusagen? Vielfach stand am Anfang ein geringfügiger Anlaß, ein leichtes Kratzen an der Wand der Konformität, das nicht toleriert, sondern sofort hart unterdrückt wurde und in der Folge zu weiterer Auflehnung und weiterer Repression führte, bis der Betroffene im sozialen Abseits stand. Hatte er ursprünglich nie daran gedacht, die DDR zu verlassen, blieb ihm zuletzt kaum eine andere Wahl. Ein wenig Verständnis und Entgegenkommen zur rechten Zeit hätte manchmal genügt, die Menschen zu halten. Jetzt standen sie am Ende des Weges und hatten alle Brücken hinter sich abgebrochen, ihre Wohnungen aufgegeben und die persönliche Habe verkauft oder verschenkt. Nur die Ausreise aus der DDR schien hier noch denkbar. Dennoch wäre es unredlich gewesen, Hoffnungen zu wecken, deren Erfüllung zu dieser Zeit in hohem Maße ungewiß war. Sechzehn Personen, vor allem Mütter mit Kindern, verließen dann auch zwei Tage später die Ständige Vertretung, ließen allerdings Angehörige dort zurück, die für sie die Sache weiter durchstehen wollten.
Mir war klar, daß wir uns darauf einrichten mußten, die verbleibenden 115 Menschen für längere Zeit zu beherbergen. Mit außergewöhnlichem persönlichen Einsatz organisierten Bertele und seine Mitarbeiter die Versorgung, wobei die DDR im übrigen keine Schwierigkeiten machte. Nicht einfach war es, mit den inneren Belastungen fertig zu werden, die sich aus der Situation und der heterogenen Zusammensetzung der Gruppe bei längerer Dauer notwendigerweise ergaben. Erwachsene und Kinder, einzelne und Familien waren in einem großen, nur notdürftig unterteilbaren Raum mit unzureichenden sanitären Anlagen zusammengesperrt, ohne größere Bewegungsmöglichkeit, ohne Beschäftigung und vor allem ohne feste Aussicht auf das Ende dieses Zustands. Spannungen waren da unvermeidlich. Ich bat den Bonner Psychologen Dr. Meyer-Lindenberg, der bereits früher in einer ähnlichen Situation in der Botschaft Prag das Auswärtige Amt beraten hatte 14 , um Mithilfe. Er besuchte zweimal die Vertretung, sprach mit den Menschen, machte die Mitarbeiter auf Problemlagen aufmerksam und gab ihnen Verhaltensregeln.
Vor allem mußten die Menschen wenigstens geringfügig beschäftigt werden. Einige waren gelernte Köche und übernahmen die Küche, andere wechselten sich beim Küchendienst und den Reinigungsarbeiten ab, wieder andere bildeten Spielgruppen für Kinder und für Erwachsene, und im Hof konnte etwas Gymnastik getrieben werden. Die Vertretung besorgte Spiele und Bücher, ein Mitarbeiter organisierte sogar einen englischen Sprachkurs. Dadurch und mit ständigen Gesprächen gelang es Bertele und seinen Mitarbeitern unter sehr aktiver Mithilfe von Frau Bertele und anderen Ehefrauen, die Lage bis zuletzt stabil zu halten.
In Bonn entstand inzwischen – wie immer in kritischen Lagen – ein Druck, daß etwas geschehen müsse, gleichgültig was. Der Bundeskanzler solle mit Honecker telefonieren, wurde schon nach wenigen Tagen gefordert. Honecker lag allerdings, wie wir wußten, nach einer Operation im Krankenhaus – Hinweisen zufolge war er an Krebs erkrankt. Ich hielt nichts davon, ihn anzurufen, weil ich nicht erwartete, daß die DDR kurzfristig nachgeben würde und ein solches Gespräch ihr nur den Eindruck vermitteln könnte, daß wir allzu dringlich an einer Lösung interessiert seien.
Teltschik, der stets vornehmlich die innenpolitischen Wirkungen im Auge hatte, war anderer Meinung, und so erhielt ich schließlich den Auftrag, ein Telefongespräch zu vermitteln. Das kam dann aber doch nicht zustande, weil Honecker – wie mir der Leiter seines Büros, Staatssekretär Frank-Joachim Herrmann, mitteilte – wegen seiner Krankheit zur Zeit nicht telefonisch erreichbar sei. Darauf wurde statt dessen am 14. August eine schriftliche Botschaft des Bundeskanzlers mit dem erneuten Vorschlag diskreter Gespräche übermittelt 15 . Am 17. August kam die Antwort 16 , daß am nächsten Tag der Erste Stellvertretende Außenminister, Staatssekretär Dr. Herbert Krolikowski, zur Verfügung stehe. Krolikowski war ein älterer, sehr erfahrener Angehöriger der DDR-Führung – sein jüngerer Bruder war Mitglied des Politbüros, er selbst gehörte dem Zentralkomitee der SED an –, dessen eigentliches Aufgabengebiet die Beziehungen mit der Sowjetunion und den Staaten des Warschauer Pakts war. Er war im allgemeinen um Sachlichkeit und Vermeidung von Schärfen bemüht, und seine Gesprächsführung zeigte immer über die vorgegebene Linie hinaus eigenes Nachdenken. Ich begleitete Minister Seiters zu dem Gespräch, das sehr sachlich und intensiv verlief, aber keine Änderung der Haltung der DDR erkennen ließ.
Seiters legte dar, daß die Probleme in unserer Ständigen Vertretung und einigen Botschaften ihren Grund in der DDR hätten und auch nur von dort gelöst werden könnten. Wir bemühten uns zwar, die Zufluchtsuchenden zum freiwilligen Verlassen der Vertretungen zu bewegen, würden aber niemanden gewaltsam hinausweisen. Eine Lösung werde nur möglich sein, wenn die DDR einen Beitrag dazu leiste. Krolikowski erklärte demgegenüber, daß die Probleme in den Vertretungen von uns zu verantworten seien, da wir die Menschen eingelassen hätten und ihnen dort den Aufenthalt gestatteten. Die DDR gewährleiste den freien Zugang, billige aber nicht den Aufenthalt dieser Menschen dort. Man verlange von uns zwar nicht, daß wir mit Gewalt gegen sie vorgingen, wir müßten sie jedoch nachdrücklich zum Verlassen der Vertretungen bewegen und alles unterlassen, was ihnen Hoffnung machen könnte, auf diesem Weg für sich eine Sonderregelung zu erhalten. Auch zu nur begrenzten Zusicherungen, die über die Zusage bloßer Straffreiheit hinausreichten, war Krolikowski nicht bereit. Seiters erwiderte, daß sich unter diesen Umständen an der jetzigen Lage nichts ändern werde und wir uns darauf einstellen müßten, über längere Zeit ein größeres Problem zu haben. Auch wenn die Bundesregierung unverändert an einer konstruktiven Weiterentwicklung der Beziehungen interessiert sei, werde aus objektiven Gründen eine starke Belastung kaum zu vermeiden sein. Die Bundesregierung werde aber in jedem Fall auf allen Ebenen weiterhin gesprächsbereit bleiben 17 .
Bei dem anschließenden Besuch in der Ständigen Vertretung und dem Gespräch mit den Flüchtlingen zeigte sich Seiters, der sehr warmherzig und sensibel war, zutiefst angerührt. Er war fest entschlossen, diesen Menschen auf jeden Fall zu helfen, und Bertele und ich mußten ihn zurückhalten, damit er sich gegenüber den Flüchtlingen selbst und in der Öffentlichkeit nicht allzu entschieden auf die Notwendigkeit einer Lösung festlegte, was unsere Position gegenüber der DDR nur geschwächt hätte.
Das negative Ergebnis des Gesprächs zwischen Seiters und Krolikowski wurde von der DDR sofort bekanntgegeben, weil sie hoffte, durch demonstrative Härte eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Ihr Problem war nämlich, daß sie es nicht allein mit den Zufluchtsfällen in der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin zu tun hatte. Auch in unseren Botschaften in Budapest, Prag und – in geringerem Maße – Warschau drängten sich Menschen aus der DDR. Am 13. August mußte die Botschaft in Budapest, wo sich mehr als 180 Deutsche aus der DDR aufhielten, geschlossen werden, am 22. August auch die Botschaft in Prag, wo sich 140 Flüchtlinge festgesetzt hatten.
Es war Urlaubszeit, und Tausende von Deutschen aus der DDR waren unterwegs. Ungarn, ohnehin ein beliebtes Reiseziel, war in diesem Jahr besonders attraktiv, nachdem es schon im Mai die Sicherungsanlagen an der Grenze zu Österreich abgebaut hatte 18 . Viele versuchten, die Ferienreise zum Dauerurlaub von der DDR zu nutzen und illegal über die ungarische Grenze in den Westen zu gehen. Soweit das nicht gelang, sammelten sie sich in wachsender Zahl vor der geschlossenen westdeutschen Botschaft und forderten, in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen zu dürfen. Sie blieben dort in ihren Autos, in Zelten und Notunterkünften und wurden von den Angehörigen der Botschaft, vom Malteser Hilfsdienst und vom deutschen wie vom ungarischen Roten Kreuz betreut und notdürftig versorgt.
Sowohl Ungarn als auch Polen und die Tschechoslowakei waren vertraglich verpflichtet, Staatsangehörigen der DDR nicht ohne deren Genehmigung die Ausreise in das sogenannte nichtsozialistische Ausland zu gestatten, und mußten Flüchtlinge, die illegal die Grenze zu überschreiten suchten, an die DDR überstellen. Es war aber nicht zu übersehen, daß besonders Ungarn und auch Polen, die beide den Weg zu inneren Reformen eingeschlagen hatten und sich vorsichtig außenpolitisch zu emanzipieren suchten, diese Verpflichtung zunehmend als lästig empfanden. Offiziell erklärten sie, das Problem müsse zwischen den beiden deutschen Regierungen gelöst werden; intern wußten sie, daß es essentiell ein Problem der DDR war.
Die ungarische Regierung ließ in Gesprächen zwischen Staatssekretär Sudhoff vom Auswärtigen Amt und dem ungarischen Außenminister Gyula Horn zunehmend Verständnis für unsere Position erkennen. Am 19. August wurden auf einer Veranstaltung der Paneuropa-Union an der ungarisch-österreichischen Grenze von der Menschenmenge vorübergehend Grenzsperren beseitigt. Dabei gelang 661 DDR-Bürgern die Flucht nach Österreich, und die ungarischen Grenzposten taten nichts, um das zu verhindern. Wenig später, am 24. August, durften 108 DDR-Bürger, die sich in unserer Botschaft in Budapest aufgehalten hatten, mit Papieren des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz nach Österreich ausreisen. Andere suchten auf eigenes Risiko – vielfach mit Erfolg – in den Westen zu gelangen.
Die DDR mußte daher befürchten, daß bei Konzessionen gegenüber den Flüchtlingen in der Ständigen Vertretung in Berlin die Schranken in Budapest, Warschau und womöglich auch in Prag ganz fallen würden. Krolikowski hatte gegenüber Seiters bereits deutlich gemacht, daß die DDR eine Lösung wolle, bei der Wiederholungen ausgeschlossen würden. Mit diesem Ziel nahm sie am 23. August das Gespräch mit uns wieder auf. Der amtierende Leiter der für die Bundesrepublik Deutschland zuständigen Abteilung im Außenministerium, Schindler, schlug Bertele eine Regelung vor, die im Kern darauf hinauslief, daß wir alle DDR-Bürger, die mit Reise- und Ausreiseanliegen in unsere Vertretungen kämen, an die allein zuständigen DDR-Behörden verweisen und ihnen den Verbleib in den Vertretungen nicht gestatten sollten. Als Gegenleistung stellte Schindler in Aussicht, daß die Zufluchtsuchenden nach freiwilliger Rückkehr in ihre Heimatorte »ordentlich« behandelt würden, Rechtsmittel gegen ablehnende Ausreisebescheide einlegen und sich anwaltlich vertreten lassen könnten. Bertele empfahl, auf dieser Grundlage das Gespräch weiterzuführen, auch wenn er Zweifel hatte, daß die recht vagen Zusicherungen der DDR die Zufluchtsuchenden dazu bewegen würden, unsere Vertretung zu verlassen 19 .
Auch von anderer Seite wurde der Bundesregierung nahegelegt, durch Zusicherungen gegenüber der DDR eine Lösung zu erreichen. Am 23. August drückte Egon Bahr in einem Gespräch mit Minister Seiters, an dem ich teilnahm, seine Beunruhigung über eine möglicherweise unkontrollierbare Entwicklung aus, die sowohl die Entspannung als auch die Handlungsfähigkeit der DDR beeinträchtigen könnte. Bahr war in der SPD-Fraktion für die deutschlandpolitischen Fragen zuständig und hatte in den vergangenen Jahren für die SPD eine eigene DDR-Politik betrieben. Er verband die Fähigkeit zu scharfer politischer Analyse mit unkonventionellem Denken und der Gabe für einprägsame Formulierungen. Als geistiger Vater der von Willy Brandt eingeleiteten neuen deutschen Ostpolitik hatte er seinerzeit allein und weitgehend selbständig die dafür grundlegenden Verträge mit der Sowjetunion und Polen sowie mit der DDR ausgehandelt 20 , war dann aber zunehmend auch zum nachdrücklichen Verteidiger des darin festgehaltenen Status quo geworden, in dem er die Grundlage für außenpolitische Stabilität in Europa sah. Wie Gorbatschow erkannte er zwar, daß Stabilität auf Dauer nicht ohne Wandlungen möglich war, meinte aber, daß der Wandel sich auf die innere Ordnung beschränken solle, das äußere Gefüge dagegen intakt bleiben müsse.
Bahr hielt deshalb zwar die Einleitung eines wirklichen Dialogs zwischen Partei und Regierung der DDR einerseits und der Bevölkerung andererseits jetzt durchaus für erforderlich. Zur Lösung der aktuellen Probleme in den Vertretungen sah er dagegen nur zwei Möglichkeiten: eine kleine Lösung mit Zusicherung der Ausreisegenehmigung für die Zufluchtsuchenden durch die DDR gegen unsere Zusicherung, in künftigen Fällen von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen, das heißt, sie bei Dienstende aus dem Hause zu weisen; und eine große Lösung mit Herstellung absoluter Reisefreiheit, wobei die Bundesregierung jedoch zusichern sollte, nur diejenigen auf Dauer aufzunehmen, die mit Genehmigung der DDR-Behörden übersiedelten, während über andere allenfalls im Asylverfahren zu entscheiden wäre.
In ähnlicher Richtung dachte Konsistorialpräsident Manfred Stolpe, mit dem ich am 5. September bei dem Bevollmächtigten der EKD, Bischof Binder, zu einem längeren Gespräch zusammenkam. Stolpe war gleichsam der Kardinalstaatssekretär der evangelischen Kirche in der DDR, ein eminent politischer Kopf mit feinem Gespür für Macht. Weniger ein Mann fester Prinzipien als der flexiblen Kompromisse, hatte er für seine Kirche die ambivalente Formel von der »Kirche im Sozialismus« gefunden, die als bloße Ortsbestimmung ebenso wie als Angebot zu einer begrenzten Kooperation mit dem kommunistischen System gedeutet werden konnte. Er vertrat die Kirche beim Staat und wohl auch diesen bei der Kirche, ohne daß seine kirchlichen Oberen vermutlich immer so genau wußten oder wissen wollten, wie weit er sich mit der anderen Seite eingelassen hatte.
Stolpe kam regelmäßig zu Schäuble ins Bundeskanzleramt und berichtete aus seinen offensichtlich intensiven Kontakten mit staatlichen Stellen und mit Spitzenfunktionären der SED über die innere Lage in der DDR. Ich hatte dabei stets den Eindruck, daß er sich – wenngleich mit mentalen Vorbehalten – auf Dauer im sogenannten Sozialismus eingerichtet hatte; es war ihm weniger um die deutsche Einheit zu tun als um eine innere Reform der DDR und damit verbunden eine Erweiterung des kirchlichen Freiraums. So schlug er mir in dem Gespräch am 5. September auch eine Regelung unter Einschaltung der evangelischen Kirche in der DDR vor, bei der die Bundesregierung zusichern sollte, Vorkehrungen gegen eine erneute Besetzung der Vertretungen zu treffen, während die DDR ihrerseits größere Reisefreiheit einschließlich der Behandlung von Problemfällen in Aussicht stellen würde.
Sowohl Bahrs wie Stolpes Vorschläge liefen darauf hinaus, daß die Bundesregierung von ihrer Grundsatzposition abweichen sollte, Menschen aus der DDR vorbehaltlos als Deutsche im Sinne des Grundgesetzes zu behandeln. Ich konnte beiden deshalb nur sagen, daß gerade das nicht möglich war. Weder konnten wir rechtlich noch wollten wir politisch irgendeine Verpflichtung eingehen, Zufluchtsuchende zum Verlassen unserer Vertretungen zu nötigen; und schon gar nicht wollten wir mit der DDR eine allgemeine, auch für künftige Fälle geltende Vereinbarung treffen. Ich bat daher auch Bertele, in seinem nächsten Gespräch mit Schindler eindeutig zu erklären, daß wir zwar wie bisher allen Besuchern raten würden, unsere Vertretungen zu verlassen und sich mit ihrem Ausreiseanliegen an die zuständigen Stellen der DDR zu wenden, daß wir aber auch in Zukunft niemanden, der nicht freiwillig gehe, vor die Tür setzen würden 21 . Bertele trug das am 30. August vor und erhielt am folgenden Tag auf Einzelfragen noch einige Präzisierungen zu dem, was den Zufluchtsuchenden an – nicht sehr weitreichenden – Zusicherungen gegeben werden könnte. Laut Schindler gab es eine Entscheidung der gesamten Führungsspitze der DDR, keine über die Straffreiheit hinausgehenden Zusagen zu machen 22 .
Nach interner Abstimmung, insbesondere mit dem Auswärtigen Amt, wies ich am 6. September Bertele an, im Außenministerium der DDR zu erklären, wir seien zwar grundsätzlich bereit, den Zufluchtsuchenden in der Ständigen Vertretung die von der DDR gegebenen Zusicherungen mit den dazu mitgeteilten Erläuterungen und Präzisierungen zur Kenntnis zu bringen; doch sollten die Gespräche in Anwesenheit von Rechtsanwalt Vogel geführt werden, der auch seinerseits die Position der DDR darlegen und Fragen beantworten müßte. Wir wollten jedoch noch einmal klarstellen, daß eine Lösung aus unserer Sicht nur in der Weise möglich sei, daß die Zufluchtsuchenden selbst freiwillig die Vertretung verließen; die Bundesregierung könne und wolle sich insoweit zu nichts verpflichten. Die zwischen uns und der DDR geführten Gespräche bezögen sich im übrigen ausschließlich auf die Personen, die sich jetzt in unserer Vertretung aufhielten, nicht auf andere 23 .