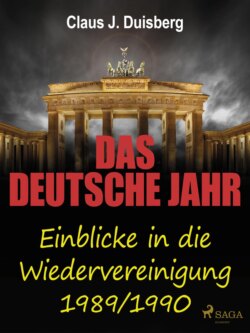Читать книгу Das deutsche Jahr - Einblicke in die Wiedervereinigung 1989/1990 - Claus J. Duisberg - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Wir sind das Volk!«
ОглавлениеNeben einzelnen Oppositionsgruppen formierte sich – man kann es nicht anders sagen – auch das Volk. Ausgangspunkt war Leipzig. Dort fanden sich seit geraumer Zeit an jedem Montag in der Nikolaikirche Menschen zu einem Gebet für den Frieden zusammen; die meisten waren Gegner des Systems, viele bemühten sich darum, die DDR zu verlassen. Am 4. September entschlossen sie sich, im Anschluß an die Andacht gemeinsam auf die Straße zu gehen, und zogen in einem schweigenden Marsch durch die Innenstadt. Dasselbe wiederholte sich am folgenden Montag und von da an jeden Montag unter wachsender Beteiligung. Am 2. Oktober waren es schon 20 000, am 9. Oktober 70 000 und eine Woche später 120 000, die durch die Straßen zogen und für Reformen in der DDR demonstrierten.
Nach dem Leipziger Vorbild gab es bald auch in anderen Städten Montagsdemonstrationen für demokratische Erneuerung. Erstaunlich und für alle Beobachter tief beeindruckend war der friedliche Charakter dieser Volksbewegung. Wie von unsichtbarer Hand diszipliniert, unterließen die Demonstranten jegliche Gewaltanwendung. Die Ruhe war ihre Stärke, der Ruf »Wir sind das Volk!« ihre Waffe. Als am 7. Oktober, dem Gründungstag der DDR, in Berlin die Partei- und Staatsführung sich im sogenannten Palast der Republik selbst feierte, stand das Volk mit diesem Ruf draußen auf der Straße. Tausende demonstrierten an diesem Tag in zahlreichen Städten der DDR für Meinungsfreiheit und Reformen. Polizei und Staatssicherheit gingen mit großer Brutalität gegen diese Demonstrationen vor; mehr als tausend Demonstranten wurden festgenommen, Gerät und Material westlicher Journalisten und Fernsehteams wurden beschlagnahmt oder zerstört.
Insgesamt aber ließen die Reaktionen der staatlichen Organe eher Unsicherheit erkennen. Der Versuch, der Bewegung ein für allemal Herr zu werden, wurde nicht gemacht. Angeblich wollte Erich Mielke, der Chef der Staatssicherheit, bei der Montagsdemonstration in Leipzig am 9. Oktober eine Entscheidung erzwingen. Die Stadt erlebte an diesem Tag ein massives Aufgebot von Polizei, Staatssicherheit und Kampftruppen der Armee. Die Krankenhäuser waren angewiesen worden, vorsorglich Betten freizuhalten, Blutkonserven bereitzustellen und sich auf die Behandlung von Schußwunden einzurichten. Aber der Befehl zum Eingreifen blieb aus. Egon Krenz, im Politbüro der SED für die Sicherheit verantwortlich, nahm später für sich in Anspruch, ihn verhindert zu haben.
Statt des Zusammenstoßes verbreiteten drei Sekretäre der SED-Bezirksverwaltung in Leipzig gemeinsam mit dem Chefdirigenten des Gewandhausorchesters Kurt Masur, dem Pfarrer Peter Zimmermann und dem Kabarettisten Bernd-Lutz Lange einen Aufruf, in dem ein »freier Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Lande« mit der Regierung für notwendig erklärt und alle Leipziger um Besonnenheit gebeten wurden, damit ein friedlicher Dialog möglich würde.
In den folgenden Tagen gab es Anzeichen dafür, daß die politische Führung vorsichtig zurückwich. In einer Erklärung des Politbüros der SED zur aktuellen Situation in der DDR am 11. Oktober 34 wurden alle Bürger dazu aufgerufen, Gedanken und Vorschläge zur Weiterentwicklung des Sozialismus einzubringen; dabei war von »demokratischem Miteinander«, »leistungsgerechter Bezahlung«, Reisemöglichkeiten und einer gesunden Umwelt die Rede. Der Chefideologe der SED, Kurt Hager, sprach in der sowjetischen Wochenzeitung »Moskowskije Nowosti« von der Notwendigkeit einer Konzeption zur Verwirklichung erforderlicher Neuerungen; die Bevölkerung müsse dabei aktiv einbezogen werden. Wie später deutlich wurde, liefen intern Vorbereitungen für eine Palastrevolution.
Entscheidend für die Entwicklung in diesen Wochen war die Haltung der Sowjetunion. Am 17. Juni 1953 in Berlin und drei Jahre später in Ungarn hatten sowjetische Panzer und Truppen Volksaufstände blutig niedergeworfen. Viele Menschen in der DDR hatten das im Gedächtnis, nicht wenige es selbst erlebt; in frischer Erinnerung war auch noch die Intervention in der Tschechoslowakei im Sommer 1968. Im Herbst 1989 bestand daher durchaus – und nicht unbegründet – Angst vor einem erneuten sowjetischen Eingreifen. So hätte es nicht einmal eines großen Einsatzes bedurft, sondern wohl schon genügt, sowjetische Panzer sichtbar in Stellung zu bringen, um die Menschen nachhaltig einzuschüchtern und den Demonstrationen ein Ende zu machen. Statt dessen blieben die sowjetischen Truppen auffällig bewegungslos in ihren Garnisonen, erkennbar bemüht, sich aus dem Konflikt herauszuhalten.
Schewardnadse hat später erklärt, es habe innerhalb der sowjetischen Führung starke Tendenzen gegeben zu intervenieren; er habe dies aber verhindert. Es mag zutreffen, daß in Kreisen der sowjetischen Führung tatsächlich mit dem Gedanken einer Intervention gespielt worden ist. Dagegen dürfte aber – abgesehen von dem nachwirkenden Afghanistan-Trauma – vor allem die Überlegung gesprochen haben, daß damit dem gerade wieder wachsenden sowjetischen Ansehen in der Welt nachhaltig Schaden zugefügt und die für die wirtschaftliche Erneuerung als unerläßlich angesehene Zusammenarbeit mit dem Westen auf geraume Zeit verhindert worden wäre. Überdies ging man noch davon aus, daß mit auch aus sowjetischer Sicht unerläßlichen Reformen die Entwicklung eingefangen und die DDR unter neuer Führung gehalten werden könnte.
Als Gorbatschow zu den Jubiläumsfeiern am 6. und 7. Oktober nach Berlin kam, verhehlte er im Gespräch mit Honecker und dem SED-Politbüro nicht seine Auffassung, daß Veränderungen in der DDR nicht zuletzt in Richtung auf mehr Demokratie erforderlich seien. In der Öffentlichkeit, wo er von den Menschen begeistert als Hoffnungsträger begrüßt wurde, tat er am 7. Oktober den später immer wieder zitierten Ausspruch: »Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.« Dann weiter: »Gefahren warten nur auf diejenigen, die nicht auf das Leben reagieren.«
Honecker schien diese Gefahren nicht wahrzunehmen; er sah nicht, daß die Wellen der Bewegung aus dem Volk die Dämme seines Systems bereits überspülten. Nicht die Demonstranten waren für ihn repräsentativ, sondern die Mitglieder der FDJ – nach amtlichen Angaben über 100 000 –, die am Abend des 6. Oktober noch einmal – zum letzten Mal! – von den geübten Organisatoren der Partei in Berlin zu einem Fackelzug auf die Straße geführt wurden. Anderen erschien gerade dieser Fackelzug gespenstisch, ärger noch als die Demonstration vermeintlich martialischer Stärke bei der Militärparade am folgenden Tag und die steife Lustbarkeit, zu der sich die Prominenz von Partei und Staat am Nachmittag im »Palast der Republik« versammelte.
Der tschechische Schriftsteller und spätere Präsident Václav Havel, der in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, allerdings zu der Feier am 15. Oktober nicht nach Frankfurt reisen durfte, sagte in seiner Dankesrede, die in der Paulskirche von dem Schauspieler Maximilian Schell verlesen wurde, daß Staaten wie Menschen nicht auf Dauer in der Unwahrheit leben könnten. Das traf den Wesenskern der sogenannten sozialistischen Systeme. Sie beruhten nicht nur auf Repression, sie waren auch, und gerade deshalb, in allen ihren Äußerungen innerlich unwahr. Das Gespinst der Lüge erstickte schließlich die Herrschenden selbst. So stand am Anfang des Untergangs – wie so oft – Verblendung.
Für Deutschland aber war es eine glückliche Fügung, daß Honecker in diesen Wochen durch Krankheit und Alter bereits geschwächt und der tatsächlichen Entwicklung etwas entrückt war. Im Vollbesitz seiner Kräfte wäre er wohl imstande gewesen, auch ohne Rücksicht auf die Sowjetunion seine Armee marschieren und die Demonstranten zusammenschießen zu lassen und damit möglicherweise auch den großen Verbündeten doch noch zum Handeln zu zwingen. Seine Genossen aber besaßen nicht mehr ein vergleichbares Maß an Ruchlosigkeit; sie wollten wohl sich selbst und das System retten, schreckten aber vor dem Äußersten zurück. Ohne Einwirkung von außen sind Revolutionen immer dann erfolgreich, wenn das Aufbegehren von unten auf inneren Verfall und Schwäche der bisher Herrschenden trifft.