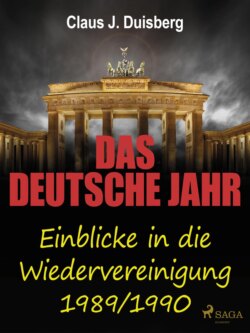Читать книгу Das deutsche Jahr - Einblicke in die Wiedervereinigung 1989/1990 - Claus J. Duisberg - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Werben um Hilfe
ОглавлениеWenige Tage später, am 24. Oktober, erschien Dr. Alexander Schalck-Golodkowski in Bonn zu einem Gespräch mit den Ministem Schäuble und Seiters. Was Vogel für das Humanitäre, war Schalck fürs Geld. Offiziell war er Staatssekretär im Außenhandelsministerium der DDR, doch mit dieser Amtsbezeichnung wurde seine Funktion nur höchst unzulänglich beschrieben. Abgesehen davon, daß er dem zuständigen Minister Gerhard Beil in keiner erkennbaren Weise unterstellt war, sondern ganz autonom agierte, war er Herr über ein in seinen vielfachen Verflechtungen unter der Bezeichnung »Kommerzielle Koordinierung« (»Ko-Ko«) erst später vollständig bekanntgewordenes Imperium in- und ausländischer Firmen, deren Zweck vornehmlich darin bestand, der DDR auf legalem und paralegalem Wege dringend benötigte »Valuta«, das heißt Hartwährung oder nur in Hartwährung zu erhaltende Güter, zuzuführen. Das reichte vom Antiquitäten- bis zum Waffenhandel, schloß aber noch vieles andere ein; auch die finanzielle Abwicklung der »Besonderen Bemühungen« fiel in seine Zuständigkeit.
Schalck war der Bundesregierung schon 1974 von der DDR-Führung als Unterhändler für besondere Angelegenheiten benannt worden. In der Folge handelte Staatssekretär Günter Gaus, der erste Leiter unserer Ständigen Vertretung in Ost-Berlin, mit ihm die Vereinbarungen über die Grunderneuerung der Autobahn zwischen Helmstedt und Berlin, eine Autobahnverbindung von Berlin nach Hamburg und eine Reihe anderer Verkehrsprojekte aus, alle nach demselben Muster, daß nämlich die DDR ihre Arbeits- und Dienstleistungen auf eigenem Gebiet mit einem gehörigen politischen Aufpreis an die Bundesrepublik gegen Zahlungen in Deutscher Mark verkaufte.
Die Verhandlungen hatten einen bizarren Zug insofern, als alle wesentlichen Sachgespräche im geheimen mit Schalck unter vier Augen geführt wurden, daneben aber eine offizielle Verhandlungsebene beim Außenministerium der DDR bestand, auf der ebenfalls Gespräche stattfanden, die jedoch ohne jede Bedeutung waren. Nach Abschluß der Verhandlungen trat Schalck ins Dunkel zurück, während der offizielle Vollzug im Lichte der Öffentlichkeit durch das – vorher sachlich kaum beteiligte – Außenministerium der DDR erfolgte.
Später verkehrte Schalck unmittelbar mit dem Chef des Bundeskanzleramts und daneben besonders mit dem bayrischen Ministerpräsidenten, wobei die Kommunikation zwischen diesen beiden Gesprächspartnern oft zu wünschen übrigließ. Auch die Vorbereitung des Honecker-Besuchs im Sommer 1987 lief über Schalck, der in mehreren Gesprächen mit Schäuble die Einzelheiten des Programms und die Grundzüge der Ergebnisse aushandelte. Dies war übrigens das einzige Mal, wo Schalck erkennbar bedauerte, an dem Ereignis selbst nicht beteiligt zu sein, sondern nach den Vorgesprächen wieder in den Hintergrund treten zu müssen.
Als Verhandlungspartner war Schalck diskret und absolut zuverlässig. Er verfügte über einen kleinen, sehr effizient arbeitenden Stab und hatte unmittelbaren Zugang zu Honecker, so daß er immer außerordentlich schnell verbindliche Verhandlungspositionen präsentieren konnte. Auf unserer Seite ließ die Schwerfälligkeit der interministeriellen Abstimmung eine rasche Reaktion dagegen gewöhnlich nicht zu; nur in Ausnahmefällen, wo sich – wie im Sommer 1987 – alles im kleinen Kreis, d.h. praktisch in Schäubles und meinem Büro vollzog, konnten wir zügig vorgehen.
Schalck besaß eine hellwache Intelligenz und viel Witz. Er war genau, aber nicht kleinlich, hart im Geschäft, aber umgänglich. Ihm eignete eine burschikose Jovialität, die er im Gespräch – oft mit einem berlinisch gefärbten Wortschwall – taktisch gut zur Geltung zu bringen wußte. Obwohl unbedingt loyal gegenüber seinem System, war er alles andere als ein Apparatschik und sprach mit oft erstaunlicher Offenheit über die Schwächen der DDR, die er freilich wie kaum ein anderer kannte. Vielleicht vor dem Hintergrund seiner Verbindung mit dem Staatssicherheitsdienst, wohl aber auch aus persönlicher Neigung gab er Treffen mit ihm gerne den Anstrich des Konspirativen. Kontakte mußten auf besonderem Wege über bestimmte Personen hergestellt, Begegnungen auch gegenüber sonstigen Vertretern der DDR abgeschirmt werden. Als ich ihn einmal 1988 zum Abschluß von Verhandlungen aufsuchen mußte, erhielt ich kurz vorher die Beschreibung eines Wagens (es war ein BMW der Luxusklasse), der zu einer bestimmten Zeit vor meinem West-Berliner Hotel wenige Minuten auf mich warten würde und der mich dann auch ohne Anhalten und Kontrollen durch die sich wie von Geisterhänden öffnenden Schranken des Übergangs an der Invalidenstraße nach Ost-Berlin und später ebenso wieder zurückbrachte.
Am Flughafen Köln-Bonn hatten wir mit einiger Mühe ein besonderes Verfahren entwickelt, bei dem einer meiner Mitarbeiter Schalck unmittelbar an der Maschine in Empfang nahm und unter Umgehung aller Kontrollen ins Bundeskanzleramt brachte. Am 24. Oktober holte ich Schalck allerdings selbst ab und fuhr mit ihm ins Innenministerium. Auf der Fahrt und später auch auf dem Rückweg schilderte er mir bereits in aller Breite die sich dramatisch verschlechternde wirtschaftliche Lage der DDR. Im Gespräch mit Schäuble und Seiters wurde er noch deutlicher: Ohne eine Liquiditätshilfe von 8 bis 10 Mrd. DM in Form ungebundener Finanzkredite und einer massiven Beteiligung an den Kosten für die Westreisen würde die DDR in Kürze das Ende ihrer Möglichkeiten erreichen.
Schalck stellte andererseits die Freigabe der Reisen, zusätzliche Leitungen im Telefonverkehr und die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit auf sämtlichen Ebenen in Aussicht. Im übrigen warb er um Vertrauen für Krenz, der jetzt dem Kurs von Gorbatschow folgen wolle, sich allerdings nicht an den Modellen Ungarns und Polens orientieren werde. Beabsichtigt seien zunächst – neben der Einführung völliger Reisefreiheit – eine Amnestie für Republikflüchtige sowie der Abbau der Privilegien für die Nomenklatura. Insgesamt brauchten die Reformen jedoch Zeit und sollten jedenfalls nicht den Sozialismus und die führende Rolle der SED in Frage stellen; eine pluralistische Entwicklung mit Zulassung von Oppositionsparteien, wie SDP und Neues Forum, komme nicht in Betracht.
Zwei Wochen später, am 6. November, war Schalck erneut in Bonn und warb bei Seiters und Schäuble wieder um wirtschaftliche Unterstützung, wofür er eine breit angelegte Zusammenarbeit, Liberalisierung des Reiseverkehrs und Entgegenkommen in anderen Bereichen in Aussicht stellte. Im Gespräch mit Schäuble zeichnete Schalck diesmal freilich ein noch düstereres Bild von der wirtschaftlichen und politischen Lage der DDR und ließ deutlich erkennen, daß die Führung jetzt selbst damit rechnete, die Macht nur noch für eine Übergangszeit halten und sich auf Dauer freien Wahlen unter Zulassung neuer Parteien nicht widersetzen zu können. Schalck, der allzuviel wußte und wohl auch leicht für vieles verantwortlich gemacht werden konnte, fürchtete dabei zugleich um seine eigene Sicherheit; denn er fragte Schäuble auch, ob er selbst nötigenfalls in der Bundesrepublik Schutz finden könnte.
Die Sondierungen von Schalck eröffneten für die Bundesregierung jedenfalls die Möglichkeit, auf die interne Entwicklung in der DDR in der Phase des Umbruchs Einfluß zu nehmen. Nach Rücksprache mit dem Bundeskanzler ließ Seiters Schalck am 7. November telefonisch wissen, daß die Bundesregierung zu einem konstruktiven Dialog bereit sei, falls die DDR-Führung ihrerseits den Weg echter Reformen gehen wolle. In die Erklärung des Bundeskanzlers zur Lage der Nation am nächsten Tag wurde folgende Passage aufgenommen:
»Ich erkläre gegenüber der neuen DDR-Führung meine Bereitschaft, einen Weg des Wandels zu stützen, wenn sie zu Reformen bereit ist. Kosmetische Korrekturen genügen nicht. Wir wollen nicht unhaltbar gewordene Zustände stabilisieren. Aber wir sind zu umfassender Hilfe bereit, wenn eine grundlegende Reform der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR verbindlich festgelegt wird. Die SED muß auf ihr Machtmonopol verzichten, muß unabhängige Parteien zulassen und freie Wahlen verbindlich zusichern. Unter dieser Voraussetzung bin ich auch bereit, über eine völlig neue Dimension unserer wirtschaftlichen Hilfe zu sprechen.« 35