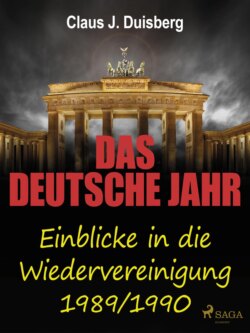Читать книгу Das deutsche Jahr - Einblicke in die Wiedervereinigung 1989/1990 - Claus J. Duisberg - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. KAPITEL
DIE DDR ÖFFNET SICH Wachsende Unruhe
ОглавлениеWie erwartet, beruhigte sich die Lage in der DDR nach dem Wechsel an der Spitze nicht. Die Bürgerbewegung sah den Rücktritt Honeckers vielmehr als ersten Erfolg und fühlte sich ermutigt, ihre Forderungen mit zusätzlichem Nachdruck zu erheben. Vertreter der Kirchen, gesellschaftlicher Organisationen und schließlich auch die Blockparteien schlossen sich an.
Bereits am 19. Oktober forderte der katholische Bischof von Berlin, Georg Sterzinsky, freie Wahlen in der DDR. Einen Tag später stellte der evangelische Landesbischof Johannes Hempel vor der Synode der sächsischen Landeskirche in Dresden offen den Führungsanspruch der SED in Frage. Am Abend vor der Wahl von Krenz zum Staatsratsvorsitzenden fanden sich in Leipzig über 100 000, nach manchen Schätzungen fast 300 000 Menschen zusammen, die für freie Wahlen und gegen eine neue Machtkonzentration demonstrierten. Nach der – im Gegensatz zu früher mit Gegenstimmen und Enthaltungen erfolgten – Wahl kam es in Berlin und anderen Orten zu Protestdemonstrationen gegen Krenz. Die Blockparteien versuchten, ebenfalls auf Distanz zum bisherigen System und zu ihrer eigenen Vergangenheit zu gehen. Die Liberaldemokratische Partei (LDPD) forderte in einem Papier, das am 22. Oktober bekannt wurde, die Zulassung des »Neuen Forums«; und die DDR-CDU veröffentlichte am 28. Oktober ein Diskussionspapier, in dem unter anderem freie und geheime Wahlen verlangt wurden. Schließlich sogar bat am 4. November das DDR-Fernsehen unter Eingeständnis seiner Mitverantwortung für die früheren Verhältnisse die Bevölkerung ausdrücklich um Entschuldigung.
Partei und Regierung versuchten zunächst, den Druck mit Einzelmaßnahmen aufzufangen, gerieten aber zunehmend in die Defensive und wichen schließlich auf breiter Front zurück. Zahlreiche führende Funktionäre wurden von ihren Posten entbunden, und am 7. November trat erst die Regierung, dann am 8. November das Politbüro der SED geschlossen zurück. In den Vordergrund traten stattdessen Personen, die den Dialog mit der Bürgerbewegung nicht scheuten und sich bereit zeigten, den Weg der Veränderung zu gehen. Prominenz erlangten der Dresdener Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer, der sich schon frühzeitig, erstmals am 16. Oktober, den Bürgerrechtsgruppen zum Gespräch gestellt hatte, und Hans Modrow, Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung in Dresden, dem der Ruf reformerischer Neigungen sowie persönlicher Integrität und Bescheidenheit vorausging und der auf der Sitzung des Zentralkomitees am 8. November zum neuen Ministerpräsidenten bestimmt wurde.
In Berlin verkündete Günter Schabowski, Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung und im Politbüro jetzt für Informationswesen und Medienpolitik zuständig, am 29. Oktober bei einer Bürgerdiskussion vor dem Rathaus, daß Demonstrationen künftig auch in Berlin zur politischen Kultur gehören sollten. Wie zur Bestätigung versammelten sich darauf am 4. November rund eine halbe Million Menschen auf dem Alexanderplatz zu der bis dahin größten freien Kundgebung, die – ein weiteres Novum – vollständig vom DDR-Fernsehen übertragen wurde. Eingeladen hatten die Künstlerverbände der DDR; Redner waren vor allem Schriftsteller, darunter Christa Wolf und Stefan Heym, aber auch Funktionäre der SED, insbesondere Schabowski und bemerkenswerterweise der ehemalige Leiter der Hauptabteilung Aufklärung im Staatssicherheitsdienst Markus Wolf. Während die Funktionäre vielfach ausgepfiffen wurden, artikulierte Stefan Heym das neue Selbstbewußtsein, indem er vom aufrechten Gang sprach, den die Menschen in der DDR wieder lernen müßten. Gefordert wurde eine neue, bessere DDR, ein Staat mit menschlichem Gesicht sowie Freiheit und Demokratie bei sozialer Gerechtigkeit. In den folgenden Tagen unterzeichneten Künstler und Mitglieder von Oppositionsgruppen einen Appell, den Christa Wolf am 8. November im Fernsehen verlas und in dem alle aufgefordert wurden, in der DDR zu bleiben und beim Aufbau einer »wahrhaft demokratischen Gesellschaft« zu helfen. Weitgehend die gleichen Kreise veröffentlichten am 26. November einen Aufruf »Für unser Land«, in dem für die Eigenständigkeit der DDR und die Entwicklung einer solidarischen Gesellschaft mit sozialer Gerechtigkeit, Freiheit des einzelnen, Freizügigkeit und Bewahrung der Umwelt geworben und vor einem Ausverkauf der materiellen und moralischen Werte der DDR und Vereinnahmung durch die Bundesrepublik gewarnt wurde.