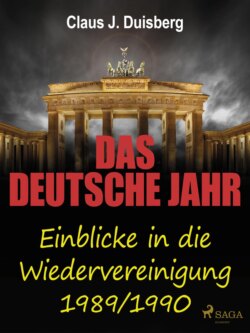Читать книгу Das deutsche Jahr - Einblicke in die Wiedervereinigung 1989/1990 - Claus J. Duisberg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stimmungen
ОглавлениеKaum etwas anderes stand so sehr im Mittelpunkt der Wünsche der Menschen in der DDR wie die Reisefreiheit. Die Kritik an den Verhältnissen entzündete sich fast immer an dem Verbot von Reisen in den Westen; und vielfach, auch bei uns, entstand der Eindruck, das Leben in der DDR könnte erträglich werden, wenn wenigstens auf diesem Gebiet etwas mehr Freiheit gegeben würde.
Über die Jahre war die Stimmung in der Bevölkerung kontinuierlich gesunken, ohne daß sich dafür immer konkrete Gründe ausmachen ließen. Objektiv hatte sich die Lage nicht einmal verschlechtert, war in einzelnen Bereichen sogar besser geworden. Das System war zwar unverändert totalitär und auf Unterdrückung individueller Freiheiten gegründet, auch war das Netz der Überwachung und Bespitzelung durch die allgegenwärtige Staatssicherheit mit den Jahren immer dichter geworden; rein äußerlich ging das Regime aber vielfach behutsamer vor, seine Machtäußerungen waren geregelter und setzten etwas mehr auf indirekten Zwang als auf offene Unterdrückung.
Wenngleich an der Grenze weiterhin auf Flüchtlinge scharf geschossen wurde, Regimekritiker unnachsichtig verfolgt und alle, die in das Räderwerk gerieten, mit rücksichtsloser Brutalität zermahlen wurden, waren im Alltag reine Willkürakte seltener, zumindest weniger offensichtlich geworden; die staatlichen Organe zeigten sich vielmehr im allgemeinen um eine barsche Korrektheit im Umgang mit den Bürgern bemüht. Die Versorgung mit Konsumgütern war zwar nach wie vor durch ständigen Mangel gekennzeichnet, insgesamt war das Niveau jedoch besser und das Angebot – wenn man es zu finden wußte – vielfältiger geworden. Mit den erweiterten Reisemöglichkeiten wurde schließlich auch der Bewegungsraum für den einzelnen etwas größer. Dennoch wuchs die Unzufriedenheit. Soweit es reale Verbesserungen gab, genügten sie doch nie den ihnen immer vorauseilenden Erwartungen.
Andererseits war es auch nicht so, daß die Menschen ständig die Faust in der Tasche ballten. Wer – und das war die große Mehrzahl – sich in den Bedingungen, wie sie nun einmal waren, eingerichtet hatte, sich anzupassen verstand und vermied aufzufallen, konnte in der DDR erträglich und sogar mit manchen Annehmlichkeiten leben. Selbst Dissidenten wurden – wenn sie nicht offen aufbegehrten oder besonders prominent waren – in ihrem privaten Rückzugsbereich zwar überwacht, doch im übrigen weitgehend unbehelligt gelassen. Das Auskommen war bescheiden, aber sicher. Initiative war nicht gefragt, und Anstrengungen konnte man mit etwas Geschick ausweichen. Das Leben verlief insgesamt ohne große Höhen, dafür war es vorhersehbar; es war – wie man sagte – gekennzeichnet durch ein dreifaches »L«: es war langsamer, leichter und langweiliger als andernorts.
Nichtsdestoweniger gab es einen sich allmählich anstauenden Unmut, der oft aus trivialen Anlässen des Alltagslebens gespeist wurde und sich mit der wachsenden Überzeugung verband, daß in der DDR im kleinen wie im großen nichts wirklich funktionieren könne. Fand man in den siebziger Jahren noch überall Menschen, die sich ehrlich für den Erfolg des Systems einsetzten und sich betrübten, daß dieses ihnen dabei so viele Hindernisse in den Weg legte, so überwogen zum Ende der achtziger Jahre Resignation und Gleichgültigkeit, nicht selten gepaart mit zynischem Opportunismus.
Zugleich ging auch in der DDR die Saat der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) auf. Der mit der Schlußakte von Helsinki 1975 begonnene Prozeß führte in allen Staaten des Warschauer Paktes, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, zu einer systemkritischen Diskussion, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. In der DDR standen dabei die Zusicherungen zur Reisefreiheit und Familienzusammenführung im Vordergrund, später aber zunehmend auch Forderungen nach Meinungs- und Informationsfreiheit, schließlich ganz generell nach politischer Freiheit. Daneben und teilweise damit verbunden bildeten sich vornehmlich unter dem Dach der Evangelischen Kirche Friedensgruppen, die mit der Losung »Schwerter zu Pflugscharen« für allgemeine Abrüstung im Osten wie – wohlgemerkt – auch im Westen eintraten.
Auf diese Stimmung traf die von einigen Staaten des Warschauer Paktes ausgehende und von der Sowjetunion unter Gorbatschow aufgenommene Reformdiskussion, verbunden mit eigener Anschauung und neuartigen Erfahrungen aus Besuchen im Westen. Das Gefühl, daß politisch und wirtschaftlich durchgreifende Reformen auch in der DDR erforderlich seien, wurde zunächst von einigen am Rande der evangelischen Kirche angesiedelten Friedens- und Menschenrechtsgruppen artikuliert, verbreitete sich dann aber und reichte bis in Parteikreise hinein, ohne daß freilich über Inhalt und Richtung solcher Reformen mehr als diffuse Vorstellungen bestanden. Es wuchs jedoch – und das war das Entscheidende für die weitere Entwicklung – die Bereitschaft, sich auch öffentlich zu einer kritischen Haltung und zu Reformforderungen zu bekennen.
Das zeigte sich zum ersten Mal eindrucksvoll am 17. Januar 1988 bei der jährlichen Demonstration zum Todestag von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Mit Spruchbändern, auf denen das Wort von Rosa Luxemburg »Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden« stand, forderten Mitglieder regimekritischer Gruppen in subtiler Weise eine Reform des Systems. Dieses reagierte zunächst mit der herkömmlichen Methode: Die Staatssicherheit griff ein und verhaftete zahlreiche Demonstranten, gegen die massive strafrechtliche Anklagen erhoben wurden. Das Aufsehen, das die Vorgänge in der westlichen Öffentlichkeit erregten, und die dort ausgelösten Proteste bewogen die DDR-Führung dann jedoch zum Einlenken. Dabei half die evangelische Kirche durch eine in der Sache feste, in der Form behutsame Vermittlung, Brücken zu bauen, über die dem Staat ein Zurückweichen ermöglicht wurde.
Die Krise endete schließlich damit, daß alle Festgenommenen aus der Haft entlassen und außer Verfolgung gesetzt und einige oppositionelle Leitfiguren – zum Teil gegen ihren Willen – nach Westdeutschland oder vorübergehend ins Ausland abgeschoben wurden. Maßgeblich dürfte der Wunsch gewesen sein, das mühsam und nicht zuletzt mit dem Honecker-Besuch erworbene internationale Ansehen der DDR nicht weiter zu beschädigen, aber wohl auch die Sorge, allein mit repressiven Maßnahmen der Entwicklung nicht mehr beikommen zu können.
Insgesamt vermittelte die Partei- und Staatsführung bereits damals den Eindruck von Unsicherheit. Im Apparat löste die mangelnde Konsequenz des Vorgehens Verwirrung aus, im Verhältnis zur Bevölkerung wurden die Probleme nicht gelöst, die latenten Spannungen eher verstärkt.
Das andere herausragende Ereignis für die Entwicklung der Opposition in der DDR war die Kommunalwahl am 7. Mai 1989. Weniger wegen der Tatsache, daß mehr als sonst Wahlberechtigte der Wahl fernblieben, ungültige Stimmzettel abgaben oder ausdrücklich gegen die Einheitsliste stimmten, sondern vor allem weil oppositionelle Gruppen es mit Erfolg unternahmen, das Regime der Wahlfälschung zu überführen. Mitglieder dieser Gruppen gingen als Beobachter in die Wahllokale – was nach dem Wahlgesetz der DDR möglich, aber bis dahin kaum praktiziert worden war – und registrierten das nach Auszählung der Stimmen von dem Wahlleiter verkündete örtliche Ergebnis. Durch Addition ermittelten sie dann die Gesamtzahlen für einzelne Wahlkreise, um dabei festzustellen, daß die realen Zahlen nicht unerheblich von dem jeweiligen amtlichen Endergebnis abwichen. Denn obwohl immer noch über 90% ihre Stimme für die Einheitsliste abgegeben hatten, hielten Vertreter des Regimes es für notwendig, das Ergebnis zu korrigieren und den Prozentsatz der Dissidenten kleiner erscheinen zu lassen.
Das eigentlich Bemerkenswerte aber war, daß es bei dieser Gelegenheit erstmals zu einem organisierten überörtlichen Zusammenwirken oppositioneller Kräfte kam. Opposition war nicht mehr bloß eine individuelle Haltung, die sich im geschlossenen Kreis Gleichgesinnter manifestierte, sondern man suchte nun miteinander Verbindung aufzunehmen und Fäden der Kommunikation durch das ganze Land zu ziehen. Mit de m Austritt aus der Isolierung begann die Opposition zu einem politischen Faktor zu werden.