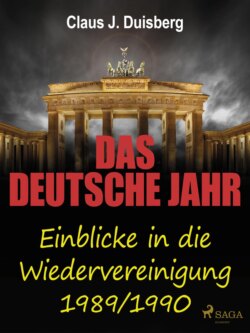Читать книгу Das deutsche Jahr - Einblicke in die Wiedervereinigung 1989/1990 - Claus J. Duisberg - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Reisedevisenfonds
ОглавлениеMit dem Fall der Mauer war die DDR in Sachen des Reiseverkehrs zum Petenten geworden. Bisher konnten Westreisende dort nicht mehr als einmal jährlich 15,- DM im Verhältnis 1:1 eintauschen; es war allen Verantwortlichen klar, daß es dabei in der neuen Situation nicht bleiben konnte. Die DDR mußte dringend einen Weg finden, um ihre Bürger wenigstens etwas besser für Westreisen ausstatten zu können. An sich verfügte sie allein aus dem innerdeutschen Reise- und Straßenverkehr über nicht unbeträchtliche Deviseneinnahmen von annähernd 2,3 Mrd. DM jährlich – 860 Mio. DM aus der Transitpauschale, 55 Mio. DM aus der Pauschale für die sonstige Straßenbenutzung und 12 Mio. DM aus Visagebühren in Berlin sowie weitere von uns allerdings nur zu schätzende Beträge aus dem Mindestumtausch (ca. 500 Mio. DM), den privaten Ausgaben der Besucher (ca. 800 Mio. DM) und den Visagebühren für Westdeutsche (ca. 50 Mio. DM). Doch waren alle diese Einnahmen bereits anderweitig verplant, weil sie für Einfuhren dringend benötigt wurden.
Auch die Bundesrepublik stand jedoch in einem Zugzwang. Mit dem wachsenden Reiseverkehr kamen auf jeden Fall höhere Kosten auf sie zu, schon deshalb, weil jeder Besucher aus der DDR unabhängig vom Alter ein sogenanntes Begrüßungsgeld erhielt, das 1987 aufgrund einer persönlichen Entscheidung des Bundeskanzlers auf 100,- DM angehoben worden war. Bei Annahme von zehn Millionen Besuchern im Jahr machte das 1 Mrd. DM aus. Zusammen mit dem bereits vereinbarten Verzicht auf einen Teil des Saldenausgleichs im Eisenbahnverkehr, anderen Einnahmeausfällen durch Sondervergünstigungen auf der Eisenbahn sowie den Aufwendungen für die nach dem bestehenden Gesundheitsabkommen unentgeltliche Gesundheitsfürsorge war mit Kosten von insgesamt 1422,7 Mio. DM im Jahr zu rechnen, ein Betrag, der sich bei einer größeren Zahl von Reisenden vor allem wegen des Begrüßungsgeldes leicht auf bis zu 2 Mrd. DM erhöhen konnte.
In dieser Situation war für uns zu entscheiden, ob wir uns weiterhin auf das Begrüßungsgeld beschränken oder vorübergehend einen Beitrag zur zusätzlichen Devisenentlastung der DDR leisten oder durch Ablösung des Mindestumtausches etwas für die Entlastung der Westdeutschen und der West-Berliner tun oder ob wir eine Verbindung aus diesen drei Positionen suchen sollten. Zu berücksichtigen war dabei auch unser Interesse an Verbesserungen der Infrastruktur der DDR, vor allem im Bereich der Telekommunikation, des Gesundheitswesens und des Umweltschutzes, an Erleichterungen im innerdeutschen Verkehr und nicht zuletzt an einer Legalisierung der DDR-Flüchtlinge aus den vergangenen Monaten. Schließlich wollten wir etwas für den nichtkommerziellen Zahlungsverkehr erreichen. Dabei ging es um die Überweisung privater Guthaben aus dem einen in das andere Gebiet; und da die Anträge auf Transfer aus der DDR in die Bundesrepublik aus naheliegenden Gründen stets in der Überzahl waren, konnten sie in einem nennenswerten Umfang überhaupt nur abgewickelt werden, wenn die DDR dafür Devisenbeträge zur Verfügung stellte, wozu sie sich in den voraufgegangenen Jahren auf unser Drängen allerdings nur in sehr begrenztem Umfang bereit gefunden hatte. Infolge der vermehrten Übersiedlungen hatte sich das Problem nun aber noch weiter verschärft.
In einem Ministergespräch beim Bundeskanzler am 15. November ging die überwiegende Meinung dahin, daß die Bundesregierung nicht umhin könne, einen Beitrag zur finanziellen Absicherung der nunmehr eröffneten innerdeutschen Reisefreiheit zu leisten; andererseits bestanden – besonders bei Finanzminister Theodor Waigel – aber auch Bedenken, durch größere Zahlungen ein an sich marodes Regime zu stützen.
Am 16. November verhandelte ich über Einzelheiten in Ost-Berlin mit dem Leiter der BRD-Abteilung im Außenministerium, Botschafter Karl Seidel, der im Gespräch eine eher konservative Position vertrat, aber immerhin bereits eine Reihe von Erleichterungen für den innerdeutschen Reiseverkehr zugestand, sich auch für eine Generalbereinigung der Probleme bei den bisherigen Übersiedlern aufgeschlossen zeigte und – ein Novum – in bezug auf sonstige Fragen der Zusammenarbeit erklärte, daß die Einbeziehung Berlins nicht mehr wie bisher zum Stolperstein werden sollte 40 . Zu den finanziellen Fragen konnte ich lediglich erklären, daß ein Beitrag der Bundesregierung zur Reisefinanzierung über das Begrüßungsgeld hinaus nur unter der Voraussetzung in Betracht gezogen werden könne, daß die DDR nicht nur auf den Mindestumtausch verzichte und Erleichterungen im West-Ost-Verkehr zugestehe, sondern auch selbst einen substantiellen finanziellen Beitrag leiste. Im übrigen seien wir bereit, die bis 1990 in Höhe von 200 Mio. DM festgeschriebene Postpauschale anzuheben, wenn die gesamte Summe zweckgebunden zur Modernisierung des Telefonnetzes der DDR und für die Verbesserung der Verbindungen verwendet werde. 41
Am 20. November begleitete ich Seiters zu dem vereinbarten Gespräch mit Krenz, das im Staatsratsgebäude in Ost-Berlin stattfand 42 . Auf Seiten der DDR saßen neben Außenminister Fischer, Schalck, Neubauer und Seidel vor allem der neue Ministerpräsident Hans Modrow am Tisch, der in starkem Maße das Gespräch führte und deutlich machte, daß die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten künftig nicht mehr wie bisher Sache des Parteivorsitzenden und des Außenministeriums, sondern vor allem des Ministerpräsidenten seien. In seiner ruhigen, pragmatischen, wenngleich etwas weitschweifigen Art wirkte er – nicht zuletzt auch im Gegensatz zu Krenz – solide und in gewisser Weise vertrauenswürdig. Die Probleme der DDR sprach er mit erstaunlicher Offenheit an, wobei er keinen Hehl daraus machte, daß er ihre Dimension selbst noch nicht voll übersah. Jedoch war er sich der Schwere der vor ihm liegenden Aufgabe durchaus bewußt, ebenso der Notwendigkeit, einen neuen Anfang zu machen und dafür vieles auch an den bestehenden Strukturen in Frage zu stellen. Er sagte, daß bis zum nächsten Frühjahr die Verfassung geändert und ein neues Wahlgesetz verabschiedet werden sollte, das die Zulassung aller politischen Parteien und Gruppierungen ermöglichen würde; als Termin für Neuwahlen zur Volkskammer nannte er den Zeitraum zwischen Herbst 1990 und dem Frühjahr 1991.
Sowohl Modrow wie Krenz waren sich wohl darüber im klaren, daß die DDR die dringend benötigte Wirtschaftshilfe, wenn überhaupt, nur von der Bundesrepublik Deutschland erhoffen konnte. Das Werben um Unterstützung durchzog das Gespräch deshalb wie ein roter Faden. Deutlich war auch das Interesse an privaten westlichen Kapitalbeteiligungen in Form von gemeinsamen Unternehmen (Joint-ventures), worüber die DDR möglichst bald im Rahmen einer noch zu bildenden gemeinsamen Wirtschaftskommission sprechen wollte. Krenz betonte zwar immer wieder die Eigenständigkeit der DDR und bezeichnete Bestrebungen zur Wiedervereinigung als nicht aktuell, erkannte zugleich aber die Besonderheiten des deutsch-deutschen Verhältnisses an, das sich nach seinen Worten »von einer Verantwortungsgemeinschaft für den Frieden zu einer Vertragsgemeinschaft für die Beziehungen« entwickeln sollte, eine Formulierung, die Modrow kurz vorher in einer Regierungserklärung am 17. November 43 erstmals gebraucht hatte und die in der Folgezeit in den DDR-Vorschlägen immer wieder aufgegriffen wurde. Die volle Einbeziehung Berlins, bisher stets ein zentrales Problem, wurde von beiden nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt.
Im Verlauf des Gesprächs entwickelte Modrow Vorstellungen für eine umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit, die größere Umweltprojekte, den Ausbau des Verkehrsnetzes und in Verbindung mit Neuverhandlungen über die Postpauschale eine Modernisierung des gesamten Kommunikationssystems der DDR einschließen sollte. Zum Reiseverkehr kündigte Krenz an, daß bis zum 24. November insgesamt 93 Übergänge an der innerdeutschen Grenze und in Berlin geöffnet würden, und erklärte die Bereitschaft zu weitreichenden Erleichterungen im Reiseverkehr, insbesondere durch Wegfall des Mindestumtauschs und der Visagebühren sowie die Erteilung von Mehrfach-Sichtvermerken für das gesamte Gebiet der DDR. Als Gegenleistung verlangte er die Beteiligung der Bundesrepublik an einem Reisefonds durch Übernahme der Kosten für einen Umtausch von 100,- DM pro Reisendem und Jahr zusätzlich zur Weiterzahlung des Begrüßungsgeldes; ferner sollten die Rückfahrkosten bei der Eisenbahn übernommen werden. Unter diesen Voraussetzungen werde die DDR ihrerseits auch die Mittel für den Guthabentransfer aufstocken.
Minister Seiters antwortete unter Bezug auf die Erklärung des Bundeskanzlers im Bericht zur Lage der Nation, daß nämlich die Bundesregierung zu umfassender Hilfe und Zusammenarbeit unter der Voraussetzung eines grundlegenden politischen Wandels und der notwendigen wirtschaftlichen Reformen in der DDR bereit sei. Auch an einem Devisenfonds würden wir uns beteiligen – allerdings zeitlich und der Höhe nach begrenzt und nur, wenn die DDR außer dem Verzicht auf den Mindestumtausch und Erleichterungen im West-Ost-Reiseverkehr bis hin zum Verzicht auf Sichtvermerke ebenfalls einen substantiellen finanziellen Beitrag dazu leiste.
Es wurde vereinbart, die Fragen unter fachlichen Gesichtspunkten weiterzubehandeln, bevor – in der Woche vom 4. Dezember – wieder ein Gespräch auf höherer Ebene stattfinden sollte. Krenz nannte auch bereits einen Termin für das Treffen mit dem Bundeskanzler, und zwar – unter Hinweis auf einen für Mitte Dezember vorgesehenen Parteitag der SED – die Vorweihnachtswoche.
In den folgenden Tagen gab es auf verschiedenen Ebenen informelle Kontakte, insbesondere mit Schalck, wobei schließlich Verhandlungen für den 29. November vereinbart wurden. Zwei Tage zuvor überbrachte Neubauer noch einmal modifizierte Vorschläge der DDR: Sie wollte auf den Mindestumtausch und Visagebühren verzichten und 750 Mio. DM pro Jahr in den Reisefonds einzahlen. Die Bundesrepublik Deutschland sollte ebenfalls 750 Mio. DM und zusätzlich den bisher für das Begrüßungsgeld aufgewendeten Betrag einbringen, womit ein Umtausch von 200,- DM pro Person und Jahr – Kinder unter 14 Jahren die Hälfte – ermöglicht werden sollte; für den Umtausch selbst wurde ein gespaltener Kurs vorgeschlagen. Die DDR erklärte sich ferner bereit, gegebenenfalls ihren Einschuß beim nicht-kommerziellen Zahlungsverkehr von 75 Mio. DM auf 100 Mio. DM zu erhöhen.
Innerhalb der Bundesregierung wurde in intensiven Gesprächen eine Position abgestimmt, die substantielle Erleichterungen im West-Ost-Reiseverkehr mit der Bereitschaft zu einer begrenzten Beteiligung an dem Reisefonds verband. Wir wollten – und zwar unterschiedslos für das Bundesgebiet und West-Berlin – den Verzicht auf Mindestumtausch und Visagebühren, nach Möglichkeit auch den Verzicht auf Sichtvermerke, außerdem sonstige Erleichterungen und eine Generalbereinigung für die Probleme der Flüchtlinge und Übersiedler. Dafür waren wir bereit, auf zwei Jahre eine Umtauschmöglichkeit von einmal jährlich 200,- DM pro Person – für Kinder unter 14 Jahren 100,- DM – zu 65 oder 70 %, allenfalls auch 75 % – was faktisch dem DDR-Vorschlag entsprach – mitzufinanzieren. Ein gespaltener Umtauschkurs – 100,- DM im Verhältnis 1:1, der Rest mindestens 1:4,40 – bei Umtausch wahlweise auf beiden Seiten schien uns akzeptabel. Der Gegenwert in Mark der DDR sollte einvernehmlich für Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere für Verkehr und Stadtsanierung verwendet werden. Auch beim Eisenbahnsaldenausgleich wollten wir der DDR entgegenkommen. Beim nicht-kommerziellen Zahlungsverkehr schließlich wünschten wir außer einer Erhöhung des jährlichen Zuschusses der DDR eine einmalige Zusatzleistung von 60 Mio. DM, um bereits aufgelaufene Anträge abzuarbeiten. Bei der Postpauschale war der Finanzminister zu einer vom Postministerium vorgeschlagenen Erhöhung von 200 auf 400 Mio. DM unter der Bedingung bereit, daß der gesamte Betrag zur Modernisierung des Telefonnetzes der DDR und des innerdeutschen Fernsprechverkehrs verwendet würde.
Auf dieser Grundlage verhandelten wir am 29. November unter völliger Geheimhaltung im Bundeskanzleramt mit einer von Schalck angeführten Delegation und erzielten auch weitgehend Einigung. Bei einem weiteren Besuch von Minister Seiters in Berlin sollte in der folgenden Woche das abschließende Ergebnis besiegelt werden. Am 2. Dezember bestätigte Schalck gegenüber Minister Seiters telefonisch das Verhandlungsergebnis.
Kurz darauf aber verließ er zusammen mit seiner Frau die DDR und bat in West-Berlin um Aufnahme. Der Boden war ihm zu heiß geworden, und er befürchtete seine – in der Tat bevorstehende – Verhaftung. In West-Berlin wurde er zunächst vorsorglich in Haft genommen, bevor er Gelegenheit erhielt, Teile seines vielfältigen Wissens dem Bundesnachrichtendienst zu offenbaren.
Seine Flucht setzte beide Seiten in begreifliche Verlegenheit; die DDR ließ uns jedoch wissen, daß es bei dem für die folgende Woche am 5. Dezember vorgesehenen Besuch von Minister Seiters in Ost-Berlin bleiben sollte. Ich war an dem Wochenende bei der Ditchley Foundation in der Nähe von Oxford zu einer schon seit Anfang des Jahres vorbereiteten und nun unerwartet aktuell gewordenen Tagung über die Deutschlandfrage. Seiters rief mich dort an und bat, möglichst vorzeitig zurückzukommen, um vor seinem Besuch noch in Ost-Berlin die Verhandlungen über den Devisenfonds abzuschließen.
Am frühen Nachmittag des 4. Dezember traf ich im Gästehaus des DDR-Außenministeriums mit dem amtierenden Abteilungsleiter Schindler, einem seiner Mitarbeiter sowie einem Vertreter des Innenministeriums der DDR zusammen. Schindler legte großen Wert auf die Feststellung, daß ungeachtet der Vorgänge um Schalck-Golodkowski das bisher Besprochene weiterhin Bestand habe. Schalck habe völlig im Rahmen seiner Vollmachten gehandelt; die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bezögen sich nicht auf die Gespräche mit der Bundesregierung.
Wir verständigten uns dann abschließend über die einzelnen Punkte der zu treffenden Vereinbarung, wobei der Vertreter des Innenministeriums zu meiner Überraschung schon den völligen Verzicht auf Sichtvermerke für West-Ost-Reisen an allen Grenzübergängen ab 1. Januar 1990 in Aussicht stellte; bei der Einreise und in etwas anderer Form auch beim Transit nach West-Berlin sollten lediglich noch Zählkarten ausgegeben werden. In einem von uns ausgearbeiteten Entwurf für eine gemeinsame Pressemitteilung wurden neben der Aufhebung der Sichtvermerkspflicht die weiteren Vereinbarungen zum Reiseverkehr, insbesondere über den Devisenfonds, festgehalten; im übrigen war vorgesehen, die Gespräche über Zusammenarbeit in der Wirtschaft, beim Umweltschutz sowie über Verbesserungen im Post- und Telefonverkehr einschließlich einer Modernisierung des Telefonnetzes der DDR und über den Bau einer Eisenbahnschnellverbindung zwischen Hannover und Berlin zu beschleunigen bzw. kurzfristig aufzunehmen.
Ich brachte dieses Ergebnis noch abends spät ins Bundeskanzleramt zu Seiters, der sich der Billigung des Bundeskanzlers versicherte. Am nächsten Mittag flogen wir wieder nach Berlin zu dem vereinbarten Gespräch 44 , das auf seiten der DDR nun nur noch von Modrow geführt wurde, nachdem Krenz am 3. Dezember auf einer außerordentlichen Sitzung des Zentralkomitees der SED zusammen mit dem gesamten – erst kürzlich erneuerten – Politbüro vom Parteivorsitz zurückgetreten war (am 6. Dezember mußte er auch auf den Posten als Staatsratsvorsitzender verzichten). Modrow sprach gleich zu Anfang und erneut am Schluß des Gesprächs die Belastung durch den Fall Schalck an und stellte noch einmal fest, daß sich die gegen Schalck erhobenen Vorwürfe nicht auf die Verhandlungen mit der Bundesregierung bezögen. Er bat, auch wir möchten deutlich machen, daß die Gespräche dadurch nicht belastet worden seien. Ich mußte darauf hinweisen, daß allerdings auch bei uns jetzt Fragen nach Funktion und Tätigkeit der zum Zuständigkeitsbereich von Herrn Schalck gehörenden Firmen gestellt würden und es sehr zu wünschen wäre, wenn diese Firmen sich nun wirklich auf den kommerziellen Bereich beschränkten. Modrow sagte, daß er das angeordnet habe, aber auch jetzt noch nicht alles zu dem Komplex wisse.
Die vorbereitete Pressemitteilung mit den darin enthaltenen Vereinbarungen wurde dann mit geringen Ergänzungen gebilligt 45 . Zum Devisenfonds erklärte Minister Seiters, daß unser Beitrag durch die Zahl der Umtauschberechtigten nach oben begrenzt werde; diese Zahl wurde von der DDR mit 16,2 Millionen, einschließlich 3,5 Millionen Kinder unter 14 Jahren, angegeben. Bei einem Gesamtvolumen von knapp 2,9 Mrd. DM hätte die jährliche Belastung der Bundesrepublik Deutschland demnach maximal 2,14 Mrd. DM betragen.
Neben der Reiseregelung wichtigstes Thema war der im Prinzip bereits vereinbarte Besuch des Bundeskanzlers, der nun für den 19. Dezember festgelegt wurde. Wir hatten als Tagungsort Dresden vorgeschlagen, auch deshalb, weil der Bundeskanzler angeblich aus Rücksicht auf den Status nicht nach Berlin kommen wollte. Modrow erklärte sich einverstanden und entwickelte seine Vorstellungen zum Inhalt des Gesprächs, wonach man zunächst den sich aus der europäischen und internationalen Entwicklung ergebenden Rahmen abstecken, sich dann aber nicht an Fernzielen orientieren, sondern dem zuwenden sollte, was man konkret erreichen könne. Erforderlich sei die Konzentration auf das Nächstliegende und Machbare. Einen Tag zuvor war er in Moskau gewesen und berichtete aus seinen Gesprächen mit Gorbatschow, daß er Unterstützung für das Konzept einer Vertragsgemeinschaft gefunden habe, daß jedoch alle Wiedervereinigungsideen nachdrücklich abgelehnt würden. Man müsse weiter von der Existenz zweier unabhängiger deutscher Staaten ausgehen, sagte er, in deren Beziehungen es aber neue Aspekte geben könne. Beim Besuch des Bundeskanzlers sollte man sich daher auf die Ausfüllung einer Vertragsgemeinschaft konzentrieren, wobei es vor allem um wirtschaftliche Fragen gehe. Seiters erwiderte, daß die Struktur Deutschlands in die Gesamtstruktur Europas eingefügt werden müsse. Unsere Vorstellungen dazu sowie zur Überwindung der europäischen und der deutschen Trennung seien bekannt; letztlich komme es nun aber auf die Entscheidung der Bevölkerung der DDR an.
Auf das unmittelbar Notwendige eingehend, sprach Seiters noch das Problem der politischen Häftlinge an, die immer noch – überwiegend wegen Fluchthilfe – in DDR-Gefängnissen saßen, ferner die Regelung des Status der Flüchtlinge und Übersiedler sowie schließlich auch die Zulassung des Vertriebs westdeutscher Zeitungen und Zeitschriften in der DDR. Modrow sicherte zu, daß alle diese Fragen geprüft würden, und stellte mehr oder minder konkret auch befriedigende Lösungen in Aussicht. Er berichtete dabei über die zahlreichen Gesetzgebungsvorhaben, zu denen nicht zuletzt eine Strafrechtsreform und ebenfalls das Wahlgesetz gehörten, beide sollten jetzt ohne Verzögerung ausgearbeitet werden.
Die Dinge waren erkennbar im Fluß. Wie bald er zum reißenden Strom werden sollte, wurde uns selbst erst allmählich bewußt. Tatsächlich war die mit großem Aufwand erzielte Vereinbarung über den Reisedevisenfonds die letzte innerdeutsche Vereinbarung herkömmlicher Art. Was noch vor einem Jahr von grundlegender Bedeutung gewesen wäre, war jetzt nur noch Episode. Es war absehbar, daß eine Regelung von so begrenztem Umfang den Erfordernissen des innerdeutschen Verkehrs in seinen neuen Dimensionen nicht wirklich gerecht werden, sondern allenfalls für eine Übergangszeit Abhilfe schaffen konnte. In Wirklichkeit sollte ihre Geltungsdauer noch viel geringer sein, als wir damals annahmen.