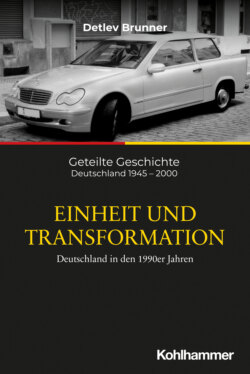Читать книгу Einheit und Transformation - Detlev Brunner - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Nation und »innere Einheit«
Оглавление»Während sich der Lustgarten, traditionsreicher Ort vieler Aufmärsche der revolutionären Arbeiter, füllte, sangen Zehntausende die Kampflieder mit, die aus den Lautsprechern ertönten.«1 Mit diesem Satz eröffnete das SED-Zentralorgan »Neues Deutschland« nicht etwa einen Bericht aus den 1950er Jahren, sondern einen Artikel über eine Kundgebung am 10. November 1989 in Berlin. Es war der Abend nach der Maueröffnung. Wer die Wochenendausgabe des »ND« vom 11./12. November 1989 zur Hand nahm, konnte sich in vergangenen Zeiten wähnen. »Kommuniqué der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED«; »150.000 Genossen bei Kundgebung in Berlin«, so lauteten die Überschriften auf der Titelseite des Parteiorgans, das im Titel noch immer das Motto aus dem Kommunistischen Manifest von 1848 führte: »Proletarier aller Länder vereinigt euch!«. Während am historischen Platz vor dem Alten Museum und dem Berliner Dom Grundorganisationen der SED zusammen mit dem amtierenden Generalsekretär Egon Krenz über die Erneuerung der SED sprachen, fand einige Kilometer westlich eine andere Kundgebung statt. Vor dem Schöneberger Rathaus, dem Regierungssitz des West-Berliner Senats, hatten sich mehrere 10.000 Menschen versammelt; auf dem Podium stand Politprominenz aus der Bundesrepublik und aus Berlin (West); Bundeskanzler Kohl hatte eigens seine Polen-Reise unterbrochen und in Berlin Station gemacht. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Walter Momper (SPD), sprach auf dieser Kundgebung den viel zitierten Satz aus, die Deutschen seien nun »das glücklichste Volk der Welt«2. Die Veranstaltung schien das nicht zu bestätigen. Sie endete in einem Pfeifkonzert gegen den Bundeskanzler. Eine musikalisch reichlich verunglückte Darbietung der Nationalhymne durch die Spitzenpolitiker auf der Bühne geriet zur unfreiwilligen Kabarettnummer. Die Berliner Tageszeitung »taz« ließ die Melodie auf Schallplatte pressen, der spöttische Titel: »Deutschland-Lied. Schöneberger Fassung«.3 In der »taz« war am 11. November 1989 ein Kommentar zu den beiden Veranstaltungen zu lesen: »Am vergangenen Abend, als sich die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner im Westen tummelte«, habe das neugewählte Politbüro in den Lustgarten gerufen, »und 150.000 kamen. […] Die Herren benahmen sich, als hätten sie dem Volk gerade einen Schnuller in den Mund gesteckt und könnten jetzt zur Tagesordnung übergehen. […] Während sich die einen im Lustgarten beklatschen ließen, wurden vier andere auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses ausgepfiffen. Die Verhältnisse entgleiten uns.«4
Die Rede vom »glücklichsten Volk« stieß nicht nur auf das Missfallen des mehrheitlich jungen und links orientierten Publikums auf der Schöneberger Kundgebung, sondern auch auf die Ablehnung westdeutscher Persönlichkeiten aus dem linksliberalen Lager. In einem im September 1990 abgeschlossenen Sammelband mit dem Titel »Geteilte Ansichten über eine vereinigte Nation« schrieb der langjährige ARD-Korrespondent in Moskau, Ost-Berlin und Washington, Fritz Pleitgen: »Das bloße Vorrücken der Bundesrepublik an die Oder/Neiße macht noch keine glückliche Nation.«5 Noch vor der Grenzöffnung bekannte der Chefredakteur des »Spiegel«, Erich Böhme, am 30. Oktober 1989, dass er mit Blick auf die deutsche Geschichte nicht wiedervereinigt werden wolle. »Laßt uns diesen Unfug der ›Wieder‹-Vereinigung vergessen […]«.6
In der deutschen Erinnerungskultur hat sich ein Narrativ etabliert, das die Maueröffnung und die deutsche Einheit als Ereignisse der nationalen Freude präsentiert. Ohne Zweifel war die Öffnung der bislang undurchlässigen Grenze ein Glücksmoment vor allem für viele der Ost-Berlinerinnen und -Berliner und bald auch all jener, die aus der DDR an die nun geöffneten Grenzübergänge strömten. Dem Ziel der Wiedervereinigung gegenüber kritisch gestimmte Einschätzungen der Zeit werden dabei ausgeblendet; sie gab es über die genannten Beispiele der Medienvertreter hinaus. Die bundesdeutschen Grünen wie die West-Berliner »Alternative Liste« lehnten die Perspektive einer Wiedervereinigung ab, in der westdeutschen Sozialdemokratie gab es ebenfalls skeptische Stimmen und in der ostdeutschen Bürgerbewegung war der Gedanke an eine Wiedervereinigung lange nicht präsent. Überhaupt entspricht das Bild, alle Ostdeutschen seien sofort an die Grenze gestürmt, um in den Westen zu gelangen, nicht der Realität. Nicht wenige hatten das historische Ereignis schlicht verschlafen, weil sie am nächsten Morgen früh zur Arbeit mussten.7