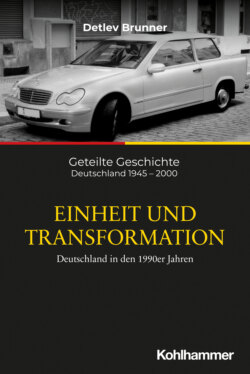Читать книгу Einheit und Transformation - Detlev Brunner - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.1 Einheitswunsch
ОглавлениеWie stark der Wunsch nach der Einheit der beiden deutschen Staaten ausgeprägt war, lässt sich für die DDR angesichts der Ereignisse ab Herbst 1989 und des Wahlergebnisses vom 18. März 1990 und für Gesamtdeutschland anhand demoskopischer Befragungen ermessen.
Waren die Oppositionsbewegung und die Demonstrationen der Friedlichen Revolution ab September 1989 von dem Willen geprägt, eine Demokratisierung und grundlegende Reform der DDR durchzusetzen, so wandelten sich seit der Öffnung der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze die Parolen der Demonstrationen zu Forderungen nach nationaler Einheit. Mit der Entscheidung der DDR-Wahlberechtigten, die in der »Allianz für Deutschland« vereinten Parteien CDU, Demokratischer Aufbruch (DA) und Deutsche Soziale Union (DSU) mit 48 Prozent der Stimmen zu wählen, war der Wille zur Einheit der beiden deutschen Staaten unterstrichen. Auch die SPD und die Liberalen, die zunächst in eine Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Lothar de Maizière (CDU) eintraten, standen für die Option der deutschen Einheit. All diese Parteien stimmten in der Nachtsitzung der Volkskammer vom 22. auf den 23. August 1990 für die Variante des Beitritts zum Grundgesetz nach Artikel 23.8
In der Bundesrepublik war jenseits der kritischen Debatten im politischen Raum und in den Medien der Wunsch nach Wiedervereinigung ebenfalls verbreitet. Nach einer Befragung von 1.109 Personen ab 16 Jahren im Februar 1990 gaben 69 Prozent an, für die Wiedervereinigung zu sein, 11 Prozent waren dagegen und 20 Prozent unentschieden. Besonders ausgeprägt (80 Prozent) war der Wunsch bei Menschen, die 60 Jahre und älter waren. Im politischen Spektrum waren vor allem Anhänger der CDU/CSU dafür (79 Prozent), die geringste Zustimmung lag bei Anhängern der Grünen (48 Prozent).9 Allerdings rangierte das Thema Wiedervereinigung deutlich hinter anderen Themen. In der Rangliste der besonders dringlichen Regierungsaufgaben lag es hinter Umweltschutz, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Wohnungsbau und Sicherung der Renten auf Platz 5.10
25 Jahre nach der Herstellung der staatlichen Einheit zogen West- wie Ostdeutsche eine alles in allem positive Bilanz der Wiedervereinigung. Nach Umfragedaten vom Herbst 2014 gaben 80 Prozent der Ostdeutschen und 79 Prozent der Westdeutschen an, dass die Vorteile der Wiedervereinigung für Deutschland überwögen. 77 Prozent der Ostdeutschen und 62 Prozent der Westdeutschen erlebten demnach die Wiedervereinigung für sich persönlich als vorteilhaft.11 Bei der Frage nach dem Vergleich zwischen der Zeit vor und nach 1990 zeigte sich jedoch, dass zahlreiche Ost- und Westdeutsche auch Verschlechterungen seit 1990 wahrnahmen. Beklagt wurde, dass der »Zusammenhalt der Menschen« schlechter geworden sei. 70,4 Prozent der Ostdeutschen über 35 Jahre und 59,4 Prozent der unter 35-jährigen Ostdeutschen waren dieser Meinung, aber auch rund ein Drittel der westdeutschen Befragten. Etwa die Hälfte der Älteren – aus Ost und West – gaben zudem an, dass sich die soziale Absicherung (47,6 Ost/49,0 West) und die soziale Gerechtigkeit verschlechtert hätten (56,1 Ost/47,2 West).12 Diese Aussagen werfen ein ambivalentes Bild auf die Einheitsbilanz; gerade jene Generationen, die die beiden Systeme vor 1990 bewusst erlebt hatten, erkannten offenkundig nicht nur positive Veränderungen durch die Vereinigung. Dies gilt besonders für die Ostdeutschen, aber auffälliger Weise auch für mehr als ein Drittel der westdeutschen Befragten.
Die ostdeutsche Bevölkerung zog bereits nach dem ersten Jahr der Einheit eine zwiespältige Bilanz der Wiedervereinigung. Ganz oben auf der Skala der Verbesserungen standen das Warenangebot, die Reisemöglichkeiten, die Auswahl an Medien (jeweils Nennungen von über 90 Prozent der Befragten) sowie die Meinungsfreiheit (73 Prozent). Negativ zu Buche schlugen jedoch die Entwicklungen, mit denen die Ostdeutschen im Zuge der umwälzenden Prozesse konfrontiert waren: 61 Prozent war der »Überblick, daß man weiß, was man tun soll« erschwert; 67 Prozent vermissten die »geregelte Ordnung«. »Der Zusammenhalt zwischen den Leuten« habe abgenommen, so 77 Prozent; dass die Mietpreise sich erhöht hätten, gaben 94 Prozent an.13 Ähnliche Punkte listete der Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages »Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit« vom 10. Juni 1998 auf.14 Auffallend ist, dass eine Reihe von Einschätzungen – im positiven wie im negativen – eine erstaunliche Kontinuität aufweist. In einer Umfrage anlässlich »30 Jahre Mauerfall« vom Oktober 2019 gaben 63 Prozent der befragten Deutschen ab 18 Jahren an, mit der Wiedervereinigung habe sich die Freiheit des Individuums und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, verbessert; 53 Prozent hoben die Meinungsfreiheit und 51 Prozent die Möglichkeit demokratischer Mitbestimmung als Verbesserungen hervor. Aber 43 Prozent beklagten einen geringeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.15 Der Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit 2019 zitierte eine Umfrage, der zufolge die ostdeutsche Bevölkerung der Wiedervereinigung ebenfalls ein schlechtes Zeugnis ausstellte. Demnach hielten nur rund 38 Prozent der Befragten im Osten die Wiedervereinigung für gelungen. Bei Menschen unter 40 waren es sogar nur rund 20 Prozent, die dieser Meinung waren.16