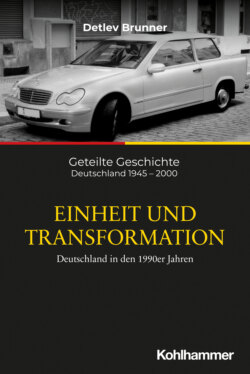Читать книгу Einheit und Transformation - Detlev Brunner - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5 Eine »normale« Nation?
ОглавлениеNeben den Kontroversen um »Leitkultur« fanden im vereinten Deutschland seit den späten 1990er Jahren weitere Diskurse statt, die sich in das Streben nach einer definitorischen Justierung dessen, was Nation sei, einordneten. Eine zentrale Konstante im deutschen »Nationaldiskurs« spielte und spielt die Frage, ob Deutschland angesichts seiner Vergangenheit, der Verantwortung für zwei Weltkriege und den Holocaust eine »normale Nation« sein könne, mit »normalen« patriotischen Emotionen, oder ob es sich angesichts dieser Geschichte geradezu verbiete, ein unbefangenes Nationalgefühl zu entwickeln?
In diese äußerst sensible Gemengelage platzierte der Schriftsteller Martin Walser eine Rede, die er am 11. Oktober 1998 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche hielt. Eine Kernpassage lautete:
»Kein ernst zu nehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, daß sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an wegzuschauen. Ich möchte verstehen, warum in diesem Jahrzehnt die Vergangenheit präsentiert wird wie noch nie zuvor. Wenn ich merke, daß sich in mir etwas dagegen wehrt, versuche ich, die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin abzuhören, und bin fast froh, wenn ich glaube, entdecken zu können, daß öfter nicht mehr das Gedenken, das Nichtvergessendürfen das Motiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken. Immer guten Zwecken, ehrenwerten. Aber doch Instrumentalisierung. Jemand findet die Art, wie wir die Folgen der deutschen Teilung überwinden wollen, nicht gut und sagt, so ermöglichten wir ein neues Auschwitz. Schon die Teilung selbst, solange sie dauerte, wurde von maßgeblichen Intellektuellen gerechtfertigt mit dem Hinweis auf Auschwitz. […]«46
Instrumentalisierung von Auschwitz, Dauerpräsentation »unserer Schande« mit der Folge des Wegschauens – so lautete Walsers Botschaft.
»Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch solche Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität Lippengebet. Aber in welchen Verdacht gerät man, wenn man sagt, die Deutschen seien jetzt ein normales Volk, eine gewöhnliche Gesellschaft?«47
Als Walser seine Rede beendet hatte, stand das Publikum wie üblich bei diesem Anlass auf zu stehenden Ovationen. Nur wenige blieben sitzen, darunter Ignatz Bubis, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland.48 Bubis bezeichnete Walsers Rede am nächsten Tag als »geistige Brandstiftung« und wiederholte seine Kritik in einer Rede zum Gedenken an den 9. November 1938 in Berlin. Martin Walser sei einer der führenden Schriftsteller der Nachkriegsrepublik, er müsse es sich deshalb gefallen lassen, dass man seiner Sprache und seinem Duktus mehr Aufmerksamkeit schenke als der Sprache und dem Duktus eines »gewöhnlichen Sterblichen wie mir«. Walser spreche »für eine Kultur des Wegschauens, die im Nationalsozialismus mehr als üblich war und die wir uns heute nicht wieder angewöhnen dürfen. […] Wer nicht bereit ist, sich diesem Teil der Geschichte zuzuwenden, sondern es vorzieht, wegzudenken oder zu vergessen, muß darauf gefaßt sein, daß Geschichte sich wiederholen kann.«49 Bubis‹ Replik war auf das Vergessenwollen, das Wegschauen konzentriert – Walsers Rede war allerdings nicht einfach auf das übliche »Schluss damit« der Stammtische zu reduzieren, er äußerte seinen Unmut über Ritualisierungen, die in der Tat zu einer Routine des Erinnerns führen konnten. Dies konzedierte auch der Historiker Saul Friedländer, der in seiner Dankrede beim Empfang des Geschwister-Scholl-Preises in München am 23. November 1998 ebenfalls kritisch auf Walsers Rede einging. »Die Deutschen sind jetzt ein normales Volk, eine gewöhnliche Gesellschaft wie jede andere. Niemand, der dies ausspricht, sollte und würde deswegen in irgendeinen Verdacht geraten. Aber ist eine normale Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Erinnerung, eine, die sich der Trauer entzieht, eine, die sich von der eigenen Vergangenheit abwendet, um nur noch in der Gegenwart und Zukunft zu leben?« Friedländers Vorschlag: »Wäre es nicht historisch und moralisch verständlich und notwendig, daß eine vollkommen normale Gesellschaft einer vollkommen unnormalen Vergangenheit auf außergewöhnliche Weise gedächte?«50
Die Kontroverse um die Walser-Rede wurde auch als Debatte einer bestimmten Generation gedeutet. Walser und Bubis, beide Jahrgang 1927, und weitere Debattenteilnehmer wie der ehemalige Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (Jahrgang 1928) gehörten einer Generation an, die noch persönlich in die zur Diskussion stehende Vergangenheit involviert war. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog resümierte in einer Rede zum Gedenktag an die Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1999, die ältere Generation habe »wieder einmal über ihre eigenen Entwicklungen und Verkrampfungen diskutiert« und nicht darüber, »was das alles für die Jugend bedeutet und welche Konsequenzen diese aus der Geschichte ziehen soll«.51 Frank Schirrmacher, Herausgeber einer Dokumentation der »Walser-Bubis-Debatte«, konstatierte, »dass hier die Protagonisten einer Generation Abschied nehmen«.52 Abgesehen von diesem Verweis auf den Generationenzusammenhang gibt es noch eine weitere Deutungsvariante, die einen Zusammenhang mit der deutschen Einheit herstellt. Es hatte schon vor 1989/90 Versuche gegeben, die Erinnerung an den Nationalsozialismus zu relativieren und die deutsche Geschichte mit dem Verweis auf andere (kommunistische) Menschheitsverbrechen zu entlasten – der Historikerstreit in der alten Bundesrepublik der Jahre 1986/87 ist dafür ein herausragendes Beispiel.53 Aber nährte die wieder gewonnene Einheit, die Wiederherstellung einer gewissen »Normalität« den Impuls, auch eine »normale« Geschichte zu haben? Konrad Jarausch hat das Streben »rechtspopulistischer Intellektueller« beschrieben, die mit dem »Rückenwind der Vereinigung« einer »Renationalisierung« das Wort redeten. Die Nation sollte so als »Wertmaßstab und emotionale Bindung« rehabilitiert werden. »Der von außen geforderten Schuldbekenntnisse und Demutsbezeugungen überdrüssig, wollten sie den Stolz auf das eigene Land wiederbeleben.«54 Nun waren die NS-Verbrechen, der Vernichtungskrieg im Osten und die Ermordung der Juden und die Millionen weiterer Opfer nicht zu leugnen, man konnte sich allerdings Entlastung verschaffen, in dem man – wie Walser – von ermüdender Ritualisierung sprach, von Instrumentalisierung des Gedenkens. Und man konnte die Frage nach Tätern und Opfern völlig neu stellen und die Deutschen als Opfer stärker in den Blick rücken. Genau dies war das Kernthema der Debatte um das Mitte 1999 als Projekt des Bundes der Vertriebenen (BdV) vorgestellte »Zentrum gegen Vertreibungen«. Der Streit nahm nach vorübergehender Pause der Debatte vor allem ab 2003 einen äußerst kontroversen Charakter an, in dem sich drei Positionen gegenüberstanden; zum einen der BdV mit dessen Vorsitzender Erika Steinbach (CDU), die das Zentrum als Gedenkort für deutsche Opfer von Flucht und Vertreibung ab 1945 in Berlin errichten wollten, zum zweiten eine Gruppe um den SPD-Bundestagsabgeordneten Markus Meckel, die eine europäische Lösung anstrebte und als Standort das polnische Wrocław ins Gespräch brachte und schließlich eine dritte Gruppe von Wissenschaftlern, die ein derartiges Zentrum grundsätzlich ablehnte. Die Intention des BdV hatte Steinbach bereits im Mai 2000 gegenüber der »Leipziger Volkszeitung« unverblümt offenbart. Das Zentrum sollte in Berlin in »geschichtlicher und räumlicher Nähe« zum Holocaust-Mahnmal entstehen. Steinbach stellte die deutschen Vertriebenen in ihrem Opferstatus auf eine Stufe wie die ermordeten Juden. »Im Grunde genommen ergänzen sich die Themen Juden und Vertriebene miteinander. Dieser entmenschte Rassenwahn hier wie dort, der soll auch Thema in unserem Zentrum sein.«55 Mit dieser Gleichstellung der Opfer, die die gravierenden Unterschiede zwischen Völkermord und Vertreibung verwischte, ging eine Entkontextualisierung einher, die die jeweiligen Zusammenhänge vollkommen ausblendete, denn die Vertreibungen der Deutschen gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hatten eine Vorgeschichte: NS-Volkstums- und Vernichtungspolitik. 2008 wurde die »Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung« auf Beschluss der Bundesregierung errichtet. Der Standort Berlin, in dem im Sommer 2021 die Dauerausstellung des neuen Dokumentationszentrums eröffnen soll, ist geblieben. Doch der Auftrag war nun keine von der NS-Geschichte losgelöste Opfergeschichte mehr, sondern »im Geiste der Versöhnung die Erinnerung und das Gedenken an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert im historischen Kontext des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik und ihren Folgen wachzuhalten«.56