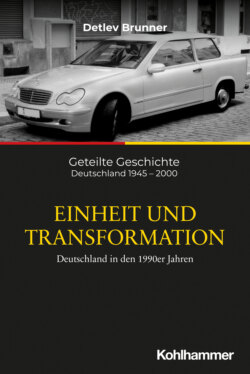Читать книгу Einheit und Transformation - Detlev Brunner - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Innere Einheit
Оглавление»Die soziale Einheit ist inzwischen im Wesentlichen hergestellt.« Dieses Ergebnis präsentierte die Bundesregierung in ihren »Materialien zur Deutschen Einheit« am 8. September 1995 dem Deutschen Bundestag.17 Angesichts von Arbeitslosenquoten, die in den neuen Bundesländern in der ersten Hälfte der 1990er Jahre Werte um die 16 Prozent erreichten und damit doppelt so hoch lagen wie in den alten Bundesländern, musste diese Feststellung Erstaunen auslösen.18 Zwei Jahre später konstatierte der Bericht der Bundesregierung: »Noch nicht alle Deutschen fühlen sich zur Zeit in ihrem Land zu Hause.« Der Einigungsprozess sei erst abgeschlossen, »wenn neben der materiellen Einheit die innere Einheit« vollendet sei.19 Aber auch in den folgenden Jahren war der Zustand »innerer« Einheit offenkundig nicht erreicht. In Ostdeutschland sei noch immer »das Gefühl der Entfremdung und der Enttäuschung« zu spüren, so Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) in seiner Regierungserklärung zum 10. Jahrestag des Mauerfalls am 11. November 1999.20
Was ist »innere Einheit«? Welches Ziel ist damit beschrieben? Ist die »innere Einheit« ein »Irrglaube«, der die Probleme des Einheits- und Transformationsprozesses verdeckt?21 Kann ein Zustand »innerer Einheit« erreicht werden? Und ist dies überhaupt erstrebenswert angesichts der föderalen Vielfalt in Deutschland? Die »innere Einheit« – ein »Phantom, das gottlob nie ein Wesen aus Fleisch und Blut werden wird«?22
»Innere Einheit« lässt sich nicht nur am Vorhandensein gemeinsamer Werte und Grundhaltungen bemessen, sondern auch an gesellschaftlichen Verhältnissen, dem Bemühen um soziale Ausgewogenheit und dem Streben nach gleichwertigen Lebensverhältnissen. Im Grundgesetz war in seiner Fassung bis 1994 das Prinzip der »Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet« festgeschrieben (Artikel 72, Satz 3) – ein Grundsatz, der im Oktober 1994 von der Formulierung der »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse« abgelöst wurde.23 Anlass dieser Änderung waren die sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in den alten Bundesländern einerseits und den neuen Ländern andererseits. Im Übrigen waren die Lebensverhältnisse in den verschiedenen Bundesländern und Regionen der »alten« Bundesrepublik und auch in der DDR keinesfalls »einheitlich« und unterschieden sich insbesondere hinsichtlich der infrastrukturellen Ausstattung und ökonomischer Leistungsfähigkeit. Für die ostdeutsche Bevölkerung stand seit 1990 die Angleichung der Lebensverhältnisse an westliche Standards im Vordergrund, die traditionellen und durch die jahrzehntelange Teilung zusätzlich gewachsenen Ungleichheiten (»Zonenrandgebiete« und Grenzregionen) wurden dabei nicht ins Kalkül gezogen. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bekannte anlässlich des 20. Jahrestages der deutschen Einheit, er habe das Ziel der »Angleichung der Lebensverhältnisse« immer für falsch gehalten. Er wolle nicht in einem Staat leben, »in dem die Lebensverhältnisse gleich sind – eine schreckliche Vorstellung in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft.« Der Bundesinnenminister hielt die Kombination der Begriffe »Beitritt« (zum Geltungsbereich des Grundgesetzes), der alternativlos gewesen sei, und »Angleichung der Lebensverhältnisse« auf dem Resonanzboden, den sie in der DDR gefunden habe, für einen der »Grundfehler des Einigungsprozesses«.24
Trotz derart differenzierender Sichten bemühten sich die Bundesregierungen seit Beginn der 1990er Jahre um ein Bild der zunehmenden Annäherung und Angleichung von Ost und West. Und dieses Bild schien auch mit den Stimmungslagen in der deutschen Bevölkerung übereinzustimmen. Das Allensbacher Demoskopie-Institut stellte im September/Oktober 2012 folgende Frage: »Neulich sagte uns jemand: ›20 Jahre nach der Wiedervereinigung hat es keinen Sinn mehr, immer noch auf den Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschen herumzureiten. Natürlich gibt es da auch Probleme, aber alles in allem ist es doch gut so, wie es jetzt ist.‹ Sehen Sie das auch so, oder sehen Sie das nicht so?«. Darauf antworteten mehr als zwei Drittel aller 1.636 Befragten, darunter 72 Prozent im Westen (1.143 Befragte) und 57 Prozent im Osten (493 Befragte), dies sei auch ihre Ansicht.25 Weitere Umfragen in den 2010er Jahren präsentierten Ergebnisse, die gerade der jungen Generation attestierten, dass sich die Deutschen in Ost und West aneinander anglichen, jedenfalls die gefühlten Unterschiede immer geringer wurden. Der »Spiegel« titelte am 3. Oktober 2014: »Ost und West? Egal! Auf Nord und Süd kommt es an.«26 Seitens der Politik, namentlich von Bundeskanzlerin Angela Merkel und von Bundespräsident Joachim Gauck wurden solche Ergebnisse dankbar aufgenommen, schienen sie doch die eigene Politik als erfolgreich zu bestätigen. Die Tendenz, die Entwicklung der inneren Einheit in einem positiven Licht zu zeichnen, ließ jedoch die nach wie vor bestehenden Unterschiede in den Hintergrund rücken.
Eine Studie, die das Empfinden von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen West- und Ostdeutschen im Zeitverlauf von 1992 bis 2012 untersuchte, zeigte, dass die Anzahl jener, die die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen als größer als die Gemeinsamkeiten ansahen, bei manchen Schwankungen jeweils in einer klaren Mehrheit waren; im Osten Deutschlands war dies deutlicher ausgeprägt als im Westen ( Abb. 1 und 2).27 Einzige Ausnahme war das Jahr 2006, jenes Jahr, als sich viele Deutsche im Zeichen des »Sommermärchens« der in Deutschland stattfindenden Fußballweltmeisterschaft in einem nationalen Taumel befanden.
Abb. 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten – Westdeutschland. Frage: »Wenn Sie einmal die Deutschen im Osten des Landes mit den Deutschen im Westen vergleichen: Überwiegen da die Unterschiede oder überwiegen da die Gemeinsamkeiten?« (an 100 fehlende Prozent: »Hält sich die Waage« oder unentschieden; Basis der Umfrage: Bundesrepublik Deutschland, westdeutsche Bevölkerung ab 16 Jahre; Quelle: Allensbacher Archiv, lfD-Umfragen)
Abb. 2: Unterschiede und Gemeinsamkeiten – Ostdeutschland. Frage: »Wenn Sie einmal die Deutschen im Osten des Landes mit den Deutschen im Westen vergleichen: Überwiegen da die Unterschiede oder überwiegen da die Gemeinsamkeiten?« (an 100 fehlende Prozent: »Hält sich die Waage« oder unentschieden; Basis der Umfrage: Bundesrepublik Deutschland, ostdeutsche Bevölkerung ab 16 Jahre; Quelle: Allensbacher Archiv, lfD-Umfragen)
Beim genaueren Hinsehen verschwanden also die gefühlten Unterschiede zwischen Ost und West nicht, und dies eben nicht nur im Sinne üblicher Merkmale eines föderalen Systems mit unterschiedlichen regionalen Identitäten. Bei allen Angleichungsprozessen des Lebensstandards und der Lebensstile blieben Unterschiede in der gegenseitigen Wahrnehmung bestehen – und dies bis in die Gegenwart. Neueste Umfrageergebnisse im Zeichen der 30-jährigen Jubiläen von Mauerfall und Einheit verweisen auf weiter bestehende Ressentiments zwischen Ost und West. Dass sich 57 Prozent der befragten Ostdeutschen als »Bürger 2. Klasse« fühlen, war im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit von 2019 zu lesen.28 Der Bericht nannte mögliche Gründe: »Eine der Ursachen dafür ist die schmerzhafte und tiefe Umwälzung des Lebens im Osten nach dem Ende der DDR. Viele Debatten, die im Osten geführt werden, zeigen, dass ein Teil der Menschen in den neuen Ländern […] noch eine distanziertere Perspektive auf Demokratie und Marktwirtschaft [hat] – und damit auf Eckpfeiler der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland – als ihre Landsleute im Westen. Aus ihrer Sicht sind das individuell oft keine Erfolgsgeschichten. Das prägt ihren besonderen Blick auf die Bundesrepublik.«29