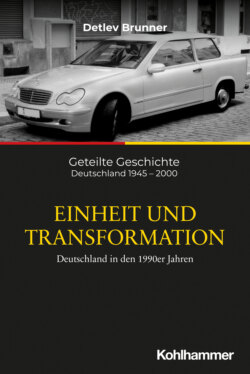Читать книгу Einheit und Transformation - Detlev Brunner - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Nationalgefühl oder regionale Identität?
ОглавлениеSeit den 1970er Jahren war es in der alten Bundesrepublik zunehmend verpönt und in der DDR sollte es allenfalls im Rahmen der »sozialistischen Nation« verspürt werden: das Nationalgefühl. Mit der Wiedervereinigung erfuhr es eine Renaissance. Angefangen vom Ruf »Wir sind ein Volk« bis hin zum verstärkten und schließlich auch unbekümmerten Gebrauch nationaler Symbolik, wie dem Zeigen der Deutschlandflagge, rückte das Thema »Nation« nicht nur in politischen Diskursen, sondern auch im Alltag auf die Tagesordnung.
Die deutsche Einheit hatte Befürchtungen vor einem neuen deutschen Nationalismus geschürt – im In- und Ausland. Die Sorge vor einem »Vierten Reich« war nicht nur eine überspitzte Metapher linker Aktivisten, sondern beispielsweise auch von britischen Kommentatoren.30 Die Ausschreitungen gegen ausländische Arbeitnehmer und Asylsuchende 1991/92, auf denen Rufe wie »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus« skandiert wurden, wurden auch als Zeichen eines neuen »Nationalismus« gedeutet. Der Historiker Heinrich August Winkler sah 1993 in den neuen Bundesländern ein Reservoir für einen »nachholenden Nationalismus«.31 Die Grenzen zwischen nationalem Bekenntnis, Nationalismus und Rechtsradikalismus waren nicht immer leicht auszumachen und zuweilen waren sie fließend.
Nationalstolz war allerdings keine Domäne der Ostdeutschen. In Befragungen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage (Allbus) in den Jahren 1996 bis 2010 gaben in Ost- wie Westdeutschland bei gewissen Schwankungen jeweils mehr als zwei Drittel an, generell stolz Deutscher zu sein.32 Legt man diese Daten zu Grunde, so war ein allgemeines Nationalgefühl in den neuen Bundesländern in diesem Erhebungszeitraum offenkundig nicht stärker als im Westen Deutschlands ausgeprägt. Korreliert man diese Ergebnisse jedoch mit weiteren Daten, etwa zur Ausprägung interkultureller Kontakte oder zu die Migration betreffende Haltungen, so lassen sich weitere Rückschlüsse auf die Ausprägung des Nationalgefühls ziehen, das im Hinblick auf die neuen Bundesländer mit einer geringeren Präsenz kultureller Vielfalt verbunden war.33
Angesichts des ausgeprägten allgemeinen Nationalstolzes scheint die ebenfalls verbreitete regionale Identität als Ostdeutsche widersprüchlich zu sein. Die Frage, wer eigentlich »ostdeutsch« ist und welche Geschichte und Bedeutung diese Zuschreibung hat, ist wiederholt gestellt worden. »Die Ostdeutschen – gibt es die überhaupt?«, so fragte Wolfgang Engler 2002. »Entstiegen die Einwohner der DDR dem von ihnen selbst zum Einsturz gebrachten Staatsgebäude als Deutsche oder als Ostdeutsche?«34 Dass die Zuschreibung »Ostdeutsche« ein Konstrukt sei und dass eine »Ost-Identität« als kollektive Identität erst mit dem Ende der DDR entstanden sei, ist mehrmals beschrieben worden.35 Doch diese Konstruktion verfing offensichtlich in der Selbstbeschreibung »der Ostdeutschen« durchaus, auch als Selbstverortung im Zuge der Transformationsprozesse.36
Abb. 3: Das Gefühl einer Ost-Identität schwindet. Frage: »Fühlen Sie sich im Allgemeinen eher als Deutscher oder mehr als Ostdeutscher? Was überwiegt?« (Basis: Bundesrepublik Deutschland, ostdeutsche Bevölkerung ab 16 Jahre)37
In Umfragen des Allensbacher Instituts für Demoskopie aus den Jahren 1992 bis 2012 geht hervor, dass die ostdeutschen Befragten sich mehrheitlich eher als Ostdeutsche denn als Deutsche fühlten, Ausnahme war auch hier wiederum das Jahr 2006 (Fußballweltmeisterschaft), das gesamtdeutsche Emotionen hervorrief. Nach abermaligem Überwiegen der ostdeutschen Identität stieg die Identität als »Deutsche« in den Jahren bis 2012. Bei den westdeutschen Befragten gibt es keine in diesem Ausmaß vergleichbare Differenzierung zwischen Deutsch und Westdeutsch.
Regionale Identitäten und nationale Identität müssen sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Im Falle »ostdeutscher« Identität und gleichzeitig zu konstatierendem, teils bis zu Nationalismus gesteigertem Nationalgefühl zeigt sich eine Mischung aus (auch überlieferten) Prägungen einer »eingekapselten Gesellschaft« (Steffen Mau) der DDR, und der Reaktion auf An- und Überforderungen durch einen umfassenden Wandel ab 1990 – Abwehr von Fremdem, Bewahrung des Eigenen. »Viele Ostdeutsche«, so der Berliner Soziologe Steffen Mau, hätten sich ihren Platz und Status im vereinten Deutschland mühsam erarbeiten müssen und hätten dabei viel aufgegeben. »Nun verlangen sie von Neuankömmlingen, sich anzupassen und ihre Ansprüche zurückzunehmen.« Statt auf Liberalität und Großzügigkeit treffe man so vielerorts auf eine Mentalität des »Aufrechnens«.38